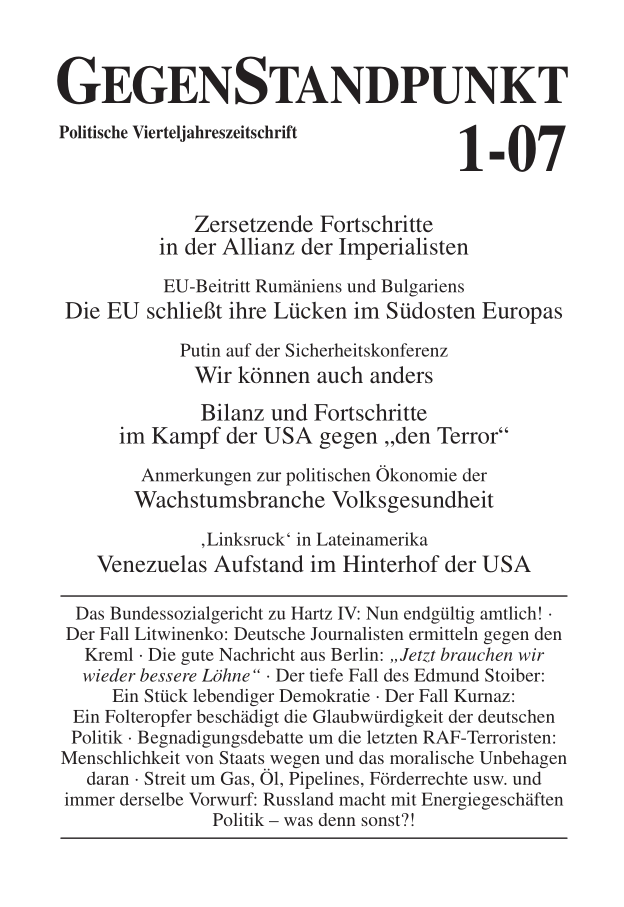Anmerkungen zur politischen Ökonomie der
Wachstumsbranche Volksgesundheit
sowie zu Grund und Zielen der aktuellen Reform des bundesdeutschen Gesundheitswesens
Wer krank ist, wird gepflegt und nach den Regeln der ärztlichen Kunst therapiert; was dafür und zur Vorbeugung gegen Verschleiß und Verfall von Soma und Psyche sowie an einschlägiger Forschung und Technologie nötig ist, wird mit Priorität in den gesellschaftlichen Arbeitsaufwand eingeplant … So einfach ist es selbstverständlich nicht mit Krankheit und Gesundheit in der sozialen Marktwirtschaft. Da organisiert die öffentliche Gewalt ein flächendeckendes Gesundheitswesen, das aus lauter gegensätzlichen und konkurrierenden Interessen zusammengesetzt und grundsätzlich immer zu teuer ist. Da wird im Auftrag des Sozialstaats in einem Umfang Geld verdient und ein Kapitalwachstum erzielt, dass die Leistungsfähigkeit der dafür in Anspruch genommenen Finanzquellen beständig überfordert wird. Da entsteht laufend und aus gar nicht medizinischen Gründen ein permanenter Reformbedarf, mit jeder Reform ein neuer.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Anmerkungen zur politischen Ökonomie der
Wachstumsbranche Volksgesundheit
sowie zu Grund und Zielen der aktuellen Reform des bundesdeutschen Gesundheitswesens
Wer krank ist, wird gepflegt und nach den Regeln der ärztlichen Kunst therapiert; was dafür und zur Vorbeugung gegen Verschleiß und Verfall von Soma und Psyche sowie an einschlägiger Forschung und Technologie nötig ist, wird mit Priorität in den gesellschaftlichen Arbeitsaufwand eingeplant ... So einfach ist es selbstverständlich nicht mit Krankheit und Gesundheit in der sozialen Marktwirtschaft. Da organisiert die öffentliche Gewalt ein flächendeckendes Gesundheitswesen, das aus lauter gegensätzlichen und konkurrierenden Interessen zusammengesetzt und grundsätzlich immer zu teuer ist. Da wird im Auftrag des Sozialstaats in einem Umfang Geld verdient und ein Kapitalwachstum erzielt, dass die Leistungsfähigkeit der dafür in Anspruch genommenen Finanzquellen beständig überfordert wird. Da entsteht laufend und aus gar nicht medizinischen Gründen ein permanenter Reformbedarf, mit jeder Reform ein neuer. Und da wird auch dauernd geändert und korrigiert – damit im Prinzip alles so bleibt, wie es gemeint ist.
1.
Die Versorgung, Pflege und medizinische Behandlung seiner Kranken überlässt das moderne Gemeinwesen grundsätzlich nicht mehr freischaffenden Medizinmännern auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Familiensinn, der Mildtätigkeit seiner Mitglieder und dem privaten Vermögen der Betroffenen, sich entsprechende Dienste zu kaufen. Der bürgerliche Sozialstaat nimmt sich beider Seiten an: Er organisiert ein komplettes medizinisches Versorgungswesen und teilt Beitragspflichten wie Rechtsansprüche auf Betreuung im Bedarfsfall zu.
Zu ihrer Bürgerschaft nimmt die Staatsgewalt damit ein Verhältnis ein, das ein starkes materielles Interesse an deren Leistungsfähigkeit verrät. Denn mit ihrem Engagement übernimmt sie nicht einfach das Geschäft der Heilkünstler und Scharlatane und schon gar nicht den moralischen Idealismus barmherziger Schwestern und Brüder: Sie nimmt die gesundheitliche Verfassung ihres Volkes als dessen Reproduktionsbedingung ernst, als eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass ihre Leute den bürgerlichen Lebenskampf durchstehen, den sie denen aufgibt und den die sich zumuten und von dessen Produktivität sie selber abhängt. In ihrem Eigeninteresse an einem marktwirtschaftlich brauchbaren und nützlichen Volk macht sie sich zuständig für das Interesse aller Schichten und Klassen ihrer Gesellschaft an der erfolgreichen Bewältigung der marktwirtschaftlichen Existenzbedingungen, die sie vorgibt; und im Sinne dieser Verantwortung erhebt sie – neben etlichen anderen allgemeinen Voraussetzungen bürgerlicher Konkurrenztüchtigkeit wie etwa Bildung oder Mobilität auch und nicht zuletzt – die Gesundheit der Bürger zum hochrangigen politischen Sorgeobjekt.[1] Dabei nimmt der Sozialstaat die Kategorie der Voraussetzung für ein bürgerliches Leben in der Weise ernst, dass er seine Fürsorge grundsätzlich nicht von den besonderen Zwecken, die einer in seinem bürgerlichen Alltag verfolgt, geschweige denn von dem Erfolg oder Misserfolg abhängig macht, zu dem der Einzelne es bringt. Er lässt sich auf die Eigengesetzlichkeit dieser Voraussetzung, auf die immanenten Erfordernisse und Notwendigkeiten eines intakten Organismus und seiner Wiederherstellung im Krankheitsfall ein und inszeniert ein medizinisches Versorgungswesen, das – erst einmal – keinem anderen Auftrag folgt als eben dem, den Leuten ohne Ansehen der Person ihre Gesundheit zu erhalten bzw. wieder zu verschaffen bzw. zu einem Rest an Lebenstüchtigkeit zu verhelfen. Dabei ist die Frage nach einem zählbaren Nutzen der medizinischen Betreuung marktwirtschaftlich nutzloser Zeitgenossen dem sozialpolitischen Denken, dem professionellen Sachverstand der Zuständigen ebenso wie der Konkurrenz-Moral des ehrbaren Bürgers, keineswegs fremd. Für seine normalen sittlichen Verhältnisse verbietet und verbittet sich der bürgerliche Sozialstaat jedoch, nötigenfalls ausdrücklich, eine Sortierung der Klienten seines Gesundheitswesens nach ihrer Stellung im marktwirtschaftlichen Erwerbsleben, eine Triage nach Nutzen-Gesichtspunkten. Sein materielles Interesse an einem brauchbaren, leistungsfähigen und -bereiten Volk gebietet in dem Punkt konsequente Abstraktion.
Das Ergebnis ist ein flächendeckendes Betreuungswesen, gegründet auf die von Staats wegen vorangebrachte Fortentwicklung der Medizin von einem Kombinat aus erfahrungsgeleiteter Heilkunst, Moral und Magie zu einer anwendungsorientierten Naturwissenschaft mit daraus abgeleiteten Behandlungstechnologien, differenziert nach Organen, nach Gesundheitsgefahren – Arbeit, Umwelt, Gifte, Unfälle, Krieg nicht zu vergessen ... –, nach Einsatzfeldern usw. Und weil die so etablierte „Schulmedizin“ viel von dem schuldig bleibt, was die leidende Menschheit sich von ihr verspricht – was nur zum Teil an den falschen Erwartungen der Kundschaft liegt und auch nur zum Teil daran, dass die Medizin als Wissenschaft noch lange nicht fertig ist; von den anderen Gründen wird im Folgenden noch die Rede sein –, behauptet daneben eine Menge „Alternativmedizin“ ihr – zum Teil sogar staatlich anerkanntes – Recht: altchinesische Weisheit neben neuester euro-amerikanischer Scharlatanerie.
2.
Bei der Bereitstellung eines modernen Gesundheitswesens macht der bürgerliche Sozialstaat keine Ausnahme vom Prinzip seiner politischen Ökonomie, der Herrschaft des Geldes: Jede einzelne ärztliche Dienst- und pflegerische Betreuungsleistung, jede Arznei und jede „Anwendung“ hat ihren Preis. Und der ist für die große Masse der Gesellschaft in dem Maße zu hoch, wie einer den entsprechenden Dienst nötig hat: Für umfänglichere Versorgungsleistungen im Krankheitsfall reicht ein Einkommen aus unselbstständiger Arbeit, also im Rahmen unternehmerischer Gewinnkalkulation, allemal nicht; und wenn es so schlimm kommt, dass der Mensch als Arbeitskraft überhaupt außer Gefecht gesetzt ist, dann entfällt damit erst einmal das Arbeitsentgelt überhaupt. Ausgerechnet für die lohnabhängige Mehrheit im marktwirtschaftlichen Gemeinwesen, für die ein Mindestmaß an Gesundheit nicht bloß die wichtigste Voraussetzung jeder Lebensqualität, sondern unentbehrliches materielles Reproduktionsmittel ist, ist dessen Wiederherstellung unerschwinglich, sobald sie einmal fällig wird.
Aus ebendiesem Grund organisiert der moderne Sozialstaat nicht bloß ein umfassendes Angebot an medizinischen Dienstleistungen, sondern auch die nötige Finanzmasse für den Unterhalt des ganzen Systems sowie den geordneten Zugriff auf dessen Leistungen für alle, die sich diese Dienste gerade im Bedarfsfall nicht von sich aus leisten können. Systemtreue Sozialisten, in Großbritannien z.B., haben dafür schon mal den geradlinigen Weg gewählt, aus Steuermitteln Personal und Sachmittel zu bezahlen und alle, die eine Behandlung brauchen, gratis behandeln zu lassen. So einfach haben es sich die meisten bürgerlichen Sozialpolitiker aber nicht gemacht; mittlerweile ist eine derartige „Staatsmedizin“ überhaupt als systemwidriger Eingriff in den eigentlich wünschenswerten freien Markt für Gesundheits-Dienstleistungen in Verruf gebracht worden; und im vorbildlichen deutschen Fall, an dem die Große Koalition gerade nachdrücklich herumreformiert, funktioniert die Gesundheitsökonomie überhaupt anders.
Hier lässt der Sozialstaat den Selbstständigen und den Besserverdienenden – die entsprechende Einkommensgrenze wird periodisch angepasst – die Freiheit, sich privat gegen die Kosten medizinischer Gesundheitspflege und eines Krankheitsfalls abzusichern; geschäftstüchtige Versicherungsunternehmen betreuen diesen Markt gerne und mit Gewinn, indem sie ihr Risiko für jeden Einzelfall gut durchkalkulieren. Bei den unselbstständigen Schlechterverdienenden geht derselbe Sozialstaat davon aus, dass die das Geld für solche kostendeckenden und gewinnbringenden Versicherungsprämien nicht übrig haben; schon gleich nicht, wenn nicht nur ihre Reproduktion als Arbeitskraft, sondern im Sinne von Gesundheit als allgemeiner Lebensbedingung das gesamte Arbeitnehmerdasein auch über die Phase des aktiven Gelderwerbs hinaus und noch dazu die in ihrer Reproduktion vom Lohn mit abhängige Familie abgesichert sein sollen. Diese große Mehrheit der Gesellschaft braucht Nachhilfe, um sich in ein ausreichendes Versicherungsverhältnis einzukaufen. Und die lässt der Staat ihr auch zukommen, in einer interessanten Mischung von Zwang und Begünstigung: Ein prozentualer Anteil vom Brutto-Arbeitsentgelt wird vom Arbeitnehmer, eine gleich große Summe zusätzlich zum nominellen Bruttolohn vom Arbeitgeber eingezogen. So stiftet der Gesetzgeber zum einen zwangsweise eine schöne Solidarität innerhalb der lohnabhängigen Masse, nämlich denen mit besseren Gehältern und denen mit schlechteren Löhnen – zum Verdruss der relativ besser Verdienenden, die mit den Prozenten ihres höheren Einkommens für die Ärmeren, aus denen der gleiche Prozentsatz nur kleine Summen herausquetscht, mitzahlen und sich deswegen schlechter stellen als die noch besser verdienenden Privatversicherten. Zum andern würdigt die bürgerliche Staatsgewalt äußerst gerecht und ganz ohne ideologische Vorbehalte den Umstand, dass in ihrer Klassengesellschaft die Gesundheit der Individuen ebenso sehr deren ökonomisches Reproduktionsmittel wie das Geschäftsmittel der lohnzahlungspflichtigen Benutzer und Nutznießer der gesellschaftlichen Arbeitskraft ist. Derart angepasst an die Logik des Gelderwerbs im Kapitalismus verschafft dieser Sozialstaat seinem Gesundheitswesen die erforderliche Finanzbasis in Gestalt von gesetzlichen Krankenkassen mit einem Zugriffsrecht auf einen hinreichenden Teil dessen, was der nationalen Wirtschaft ihr menschlicher Produktionsfaktor wert ist.[2]
Das Gesundheitswesen seinerseits steht unter der gesetzlichen Direktive, dass tatsächlich mit jeder einzelnen Dienstleistung und jedem einzelnen Medikament ganz marktwirtschaftlich Geld verdient werden soll. Wer Leistungen erbringt, Pillen herstellt oder Rollstühle produziert, soll damit ein Geschäft machen und ein Einkommen erzielen, so wie in der Privatwirtschaft und in Anlehnung an die dort herrschende klassengesellschaftliche Erwerbshierarchie; also einen anständigen oder auch schon mal unanständig hohen Verdienst als akademisch ausgebildeter Verantwortungsträger und ärztlicher Kleinunternehmer, einen mindestens ortsüblichen Profit als Pharma- und Gerätehersteller, ein eher proletarisches Entgelt als Hilfs- und Pflegekraft. Freilich bedarf ein solches medizinisches Geschäftsleben nach dem Vorbild des kapitalistischen Marktes für Waren und Dienstleistungen im Unterschied zu diesem in jedem Punkt rechtlicher Festlegungen. Was da an Preisen, Profiten, Praxiseinnahmen usw. zustande kommt, ist nicht das Ergebnis einer gesetzlich freigesetzten Konkurrenz autonom kalkulierender Geschäftsleute um die beschränkte Kaufkraft einzelner Kunden. Jede Vergütung wird ausgehandelt zwischen den Kassen als autorisierten Sachwaltern einer kollektiven Gesamtkaufkraft und den verschiedenen Fraktionen des Gesundheits- und Krankenversorgungsgewerbes. Und was dabei herauskommen soll, ist eine Versorgung, die gerade nicht im Sinne des sonst allenthalben herrschenden marktwirtschaftlichen Zynismus auf ausgenutzter Zahlungsfähigkeit beruht, individuelle Zahlungsunfähigkeit respektvoll wie eine freiwillige Verzichtsentscheidung behandelt und so die Verteilung von Armut und Reichtum in der Gesellschaft widerspiegelt. Vielmehr soll jedem Patienten ohne Ansehen von Person und individuellen Einkommensverhältnissen, rein nach den immanenten Kriterien des medizinischen Wissens und der ärztlichen Kunst, das für seinen Organismus Notwendige zukommen – das allerdings wiederum so, dass damit allenthalben schöne Geschäfte zu machen sind.
In diesem Sinne gibt der Sozialstaat sich große Mühe, in seinem medizinischen Versorgungswesen als maßgebliche politökonomische Richtlinie die große Errungenschaft der Marktwirtschaft zu reproduzieren: den Gegensatz zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Auf der einen Seite liefert er den Akteuren seiner Gesundheitsfürsorge, indem er sie zu Geschäftsleuten macht, den ökonomischen Anreiz oder sogar einen regelrechten betriebswirtschaftlichen Sachzwang, ihre Dienstleistungen nicht einfach am Kriterium der medizinischen Zweckmäßigkeit, sondern an dem der damit zu erzielenden Vergütung auszurichten; das Prinzip der Therapiefreiheit ist so zwar nicht gemeint, sondern als Verpflichtung der Mediziner, „lege artis“ zu handeln, und als Selbstverpflichtung der staatlichen Instanzen, ihnen dabei nicht hineinzureden, schafft aber natürlich den Freiraum, in dem der staatlich gleichfalls erwünschte und herausgeforderte Geschäftssinn zum Zuge kommt. Umgekehrt finden sich die Kassen in ihrer gesetzlich aufgegebenen Verantwortung für die kollektivierte gesellschaftliche Zahlungsfähigkeit dazu ermächtigt und durch die Geschäftstüchtigkeit ihrer Kontrahenten auf der Leistungsanbieterseite dazu genötigt, mit allerlei Restriktionen bei der Leistungsvergütung dem Gebrauch der ärztlichen Therapiefreiheit und des medizinisch-pharmazeutischen Fortschritts für die Erzielung von größtmöglichen Gelderlösen Grenzen zu setzen, ohne das Kriterium des medizinisch Überflüssigen und den Gesichtspunkt der erwünschten Kostendämpfung sauber voneinander trennen zu können oder auch nur auseinander halten zu wollen. Der Gegensatz zwischen Geld und Nutzen, den im marktwirtschaftlichen Alltag jeder mündige Konsument ununterbrochen mit sich selbst austrägt, gestaltet sich so, abgetrennt vom Versicherten in seiner Doppelexistenz als Beitragszahler und Patient, zu einem unauflösbaren Dauerkonflikt: Die Kassen vertreten machtvoll den Standpunkt des knappen Geldes und rechtfertigen den mit einer engen Auslegung des fachlich Sinnvollen; Ärzte bzw. Kassenärztliche Vereinigungen, Krankenhausträger, Apotheker, Pharmakonzerne usw. handhaben ihre medizinischen Wohltaten, system- und auftragsgemäß und in erbitterter Konkurrenz gegeneinander, als Mittel zum Zweck des Geldverdienens und finden durch eine unverantwortliche Unterbezahlung speziell ihres Beitrags die Volksgesundheit gefährdet.
Das Volk, um dessen Gesundheit es geht, hat in diesem Streit nichts zu melden. Mit seinen beiden großen Lebenssorgen, Geldmangel und Krankheit, ist es unter den Gegensatz der Instanzen subsumiert, die sich um sein Wohlergehen kümmern: ideell als Berufungsinstanz und als Parteigänger mal der einen, mal der anderen Seite; praktisch als interessierter Zuschauer, ohnmächtiges Anhängsel und in jedem Fall zahlungspflichtiges Opfer in einem Kleinkrieg der interessierten Parteien.
3.
Dieser Kleinkrieg geht Tag für Tag seinen systemgemäßen Gang. Von Zeit zu Zeit gelangen die politisch Verantwortlichen aber zu dem Schluss, dass sie reformerisch eingreifen müssen, damit die Kosten ihres Systems nicht aus dem Ruder laufen. Denn die haben die fatale Tendenz, unaufhaltsam zu steigen; absolut wie vor allem im Verhältnis zu der Lohnsumme, aus der sie im Wesentlichen bestritten werden.
Das liegt auf der einen Seite an der Eigenart des medizinischen Fortschritts, der aus verschiedenen forschungspolitischen – darunter nicht zuletzt auch militärischen – Gründen durch den Staat sowie durch das Geschäftsinteresse großer Pharmakonzerne und Geräteproduzenten wie kleiner Forschergemeinschaften heftig vorangetrieben und in Kombination mit Ärzten und Kliniken auf der Suche nach neuen, anständig vergüteten Dienstleistungen flächendeckend verallgemeinert wird. Die Betätigungsfelder gehen diesem Innovationsdrang nicht aus. Erfolge bei der Bekämpfung und Eindämmung der einen oder anderen Krankheit machen die Menschheit keineswegs gesund. Die entwickelt vielmehr andere Gebrechen, nicht zuletzt Berufskrankheiten und krankhafte Reaktionen auf Umwelteinflüsse, von denen frühere Generationen keine Ahnung hatten. Verschleißerscheinungen lassen sich nicht heilen, aber aushaltbar machen und lassen die Betroffenen zu Dauerkunden für einschlägige Therapien werden. Glücklich herausgewirtschaftete zusätzliche Lebensjahre bescheren den Arztpraxen und Pflegeanstalten neue Dauergäste. Und überall wird offenkundig, wie viel die moderne Medizin auf ihrem Weg vom Erfahrungswissen und heilkünstlerischen Herumprobieren zur definitiven Wissenschaft und zu einwandfrei fundierten Therapien noch zu tun hat. Die Avantgarde begreift das als Herausforderung; Investoren werfen sich auf eine Anlagesphäre mit unabsehbarem Wachstumspotenzial. Dass dabei das Geschäftsinteresse die Produktentwicklung nicht bloß vorantreibt, sondern regelmäßig überholt, gehört zur marktwirtschaftlichen Natur der Sache: Auf Basis oftmals erst halbfertiger oder vorläufiger Forschungsergebnisse und allenfalls statistisch halbwegs abgesicherter Zufallsbefunde wird ein wachsendes Arsenal von Chemie-, Strahlen- und sonstigen Waffen gegen Krankheitskeime aller Art produziert, nach gewonnenem Kampf um Zulassung in Verkehr gebracht und den Kassen eine lohnende Vergütung abgerungen; schließlich muss verhindert werden, dass die Konkurrenz mit ihren genauso unausgereiften Produkten schneller auf dem Markt ist. Für die Erringung wie die Erhaltung einer nennenswerten Marktposition braucht ein medizinisches Unternehmen in nicht allzu großen Abständen immer neue „Blockbuster“ – Verkaufsschlager, die wachsenden Umsatz garantieren, speziell dann, wenn alte Patente auslaufen und mit denen die Monopolpreise wegfallen. Da muss der Nachweis eines Nutzens für die allgemeine Gesundheit schon mal zurückstehen; bei viel versprechenden Neuerungen kann nicht abgewartet werden, bis sie irgendwann mal ausgereift sind. So wächst auf alle Fälle das therapeutische Angebot, dessen Produzenten um einen entsprechend wachsenden Zugriff auf Kassenmittel kämpfen. Es kommt hinzu, auch das ein Beitrag zum notorischen „Kostendruck“ in einem modernen Gesundheitswesen, dass der technische Fortschritt im medizinischen Gerätepark, den Krankenhäuser und Großpraxen unterhalten, zum überwiegenden Teil weder darauf angelegt ist noch dazu führt, Personal wegzurationalisieren und dadurch den Produktionspreis für erbrachte Leistungen zu senken; eher wächst umgekehrt der ökonomische Sachzwang, die teuren Maschinen durch vermehrte Anwendung, also mehr und dickere Abrechnungen mit den Krankenkassen, baldmöglichst bezahlt zu machen.
Verbilligung des benötigten Personals, Einsparung von Lohnkosten durch Einsparung von Arbeitskräften und Druck auf die Restbelegschaft: Das ist auf der anderen Seite das ökonomische Sachgesetz des Fortschritts im kapitalistischen Erwerbsleben insgesamt. Und das bewirkt eine starke Tendenz zur Schmälerung der Lohnsumme, aus der die gesetzlichen Kassen zwangsweise das Geld für den staatlich gewünschten Gesundheitssektor abzweigen. Das allein bringt die zuständigen Gesundheitspolitiker zwar noch nicht in Verlegenheit; sie kompensieren das Schrumpfen der Finanzbasis bei wachsenden Ausgaben mit einer Steigerung der prozentualen Abzüge vom Lohn. Nach der überkommenen Abrechnungsart muten sie damit aber auch den Arbeitgebern höhere Zuzahlungen zum nominellen Bruttolohn zu. Und die nehmen es keineswegs stillschweigend hin, wenn die Sozialpolitik ihre Erfolge beim Wegrationalisieren von Lohnkosten mit einer, und sei es noch so geringfügigen, Steigerung ihres Kassenbeitrags quittiert. Für sie betätigt sich da, neben den Gewerkschaften, auch die Sozialpolitik als unverantwortlicher Kostentreiber. Dementsprechend wehren sie sich gegen „explodierende“ Lohnnebenkosten, wobei ihre Lobbyisten beim interessierten internationalen Vergleich der Preise für Arbeitsstunden die Abzüge vom Bruttolohn gerne zum Arbeitgeberanteil gleich hinzu addieren, so als wäre im Grunde der Nettolohn schon der gerechte Lohn und alles andere ein Schlag gegen ihren Beruf und guten Willen, den Leuten Arbeit zu geben.
Bei der Politik finden sie damit umso mehr Gehör, je besser ihnen die Beschränkung der nationalen Lohnsumme gelingt und je mehr Arbeitslose der Sozialstaat zu verwalten hat. In ihrer Verantwortung für einen weltweit konkurrenzfähigen nationalen Kapitalstandort haben die Zuständigen sich jedenfalls zu einem gewissen Paradigmenwechsel auch in ihrer Gesundheitspolitik durchgerungen. Ihren selbst gestellten sozialpolitischen Auftrag, dem lohnabhängigen Großteil der Gesellschaft Zugang zur Reproduktionsbedingung einer organisierten Gesundheitspflege und Krankenversorgung zu verschaffen, befinden sie für übererfüllt; ab sofort müsse es, gerade im Interesse einer anständigen Reproduktion der lohnabhängigen Masse, darum gehen, das Kapital von solchen Reproduktionskosten zu entlasten. Folglich gilt für alles, was die Arbeitgeber zu den Lohnnebenkosten rechnen, das Gebot äußerster Sparsamkeit. Und mit dem entsprechenden „Diktat der leeren Kassen“ wird von höchster Stelle klargestellt, dass Gesundheit auf dem bisherigen Niveau für die Schlechterverdienenden ein nicht länger vertretbarer Luxus ist.[3] Das Kapital, das im großen Stil die Lebenskraft des angewandten Menschenmaterials vernutzt, verträgt den Aufwand nicht, der für dessen medizinische Betreuung getrieben wird; was für den Standortvorteil eines gepflegten, einsetzbaren Volks aufgewendet werden muss, übersteigt das, was die Nation in ihrer Standortkonkurrenz an Kosten für zumutbar befindet.
Die praktische Durchsetzung dieser neuen sozialpolitischen Leitlinie stößt in der Gesundheitspolitik allerdings – anders als die Verarmung der Rentner und die Verelendung der Arbeitslosen – auf eine Schwierigkeit. Schlichte Einsparungen an dieser Stelle rücken nicht bloß die Reproduktionskosten der Lohnabhängigen systemgemäß zurecht. Jede Minderung der fürs Gesundheitswesen verfügbaren Finanzmasse schädigt ungleich gewichtigere, nämlich von Staats wegen gewollte und geförderte geschäftliche Interessen: Sie greift die Besitzstände einer ganzen kleinunternehmerischen „Mittelschicht“ aus Ärzten und Apothekern an – was denen allenfalls noch zuzumuten wäre; sie beeinträchtigt aber auch die Grundlagen des großen Geschäfts mit Arzneien, mit medizinischem Gerät sowie – ein neuer gewichtiger Posten auf der gesundheitspolitischen Agenda – mit dem Betrieb von Krankenhäusern, also gleich drei nationale Wachstumsbranchen, die ausländische Gesundheitsmärkte erobern sollen und dafür eine solide inländische Geschäftsgrundlage brauchen. Einfach weniger Geld im System
kann in dem Fall also nicht die Lösung sein. Mit der Suche nach besseren Lösungen geben die Verantwortlichen sich viel Mühe – und werden in ihrem Reformeifer immer radikaler.
4.
Um die Finanzbasis ihres Gesundheitswesens zu stärken, ohne die erfolgreichen Bemühungen des Kapitals um die Minderung von Lohnkosten zu konterkarieren, haben sich die Sozialpolitiker aller Parteien schon seit längerem auf die Maxime geeinigt, die Gesundheitskosten vom Preis der Arbeit „abzukoppeln“. Am Prinzip der Einsammlung von Lohnprozenten, je zur Hälfte vom und als Zuschlag zum Bruttolohn, haben sie dabei zwar erst einmal festgehalten. Dafür haben sie sich einiges einfallen lassen, um den Kassen, die diese Prozente verwalten, Kosten zu ersparen und stattdessen in umso größerem Umfang die Netto-Einkommen der Zwangsversicherten anzuzapfen. So werden für die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen in zunehmendem Maße Zuzahlungen fällig, für den Arztbesuch überhaupt alle Vierteljahre eine Praxisgebühr. Vieles wird von den Kassen gar nicht mehr bezahlt und der Kundschaft ausdrücklich zugemutet, sich ihr Konsumverhalten insgesamt neu einzuteilen, wenn sie auf Zahnersatz, Brillen, nicht verschreibungspflichtige Medikamente und vieles andere mehr noch Wert legt. Den Leistungsanbietern soll dadurch kein Nachteil entstehen; die dürfen deswegen alles, was die Kassen nicht mehr vergüten, und noch viel mehr als das ihren Kunden als privat zu honorierende Dienstleistung anbieten bzw. mit ihrer erprobten medizinischen Autorität aufdrängen.
Mittlerweile hat sich die reformerische Phantasie der zuständigen Sozialpolitiker dann doch der überkommenen Systematik der Beitragsfinanzierung angenommen und u.a. den Einfall hervorgebracht, allfällige Steigerungen des Beitragssatzes in Zukunft nicht mehr beim Arbeitgeberanteil und deswegen umso stärker nur noch beim Bruttolohnabzug stattfinden zu lassen; eine erste deutliche Verschiebung – ein knapper Prozentpunkt geht schon mal allein zu Lasten der Arbeitnehmer – ist bereits geschafft. In ihren Zukunftsentwürfen sind die beiden großen Volksparteien über derlei Stückwerk weit hinaus. Die einen haben als Finanzquelle zusätzlich zum versicherungspflichtigen Arbeitsentgelt all die Einkommensarten im Visier, die bislang noch nicht zur solidarischen Bezahlung des Geschäfts mit der Volksgesundheit herangezogen werden: Zinsen, Mieteinnahmen, die Gehälter von Beamten, denen ihr fürsorgepflichtiger Dienstherr die Hälfte des Notwendigen spendiert, und Einkommen oberhalb der Bemessungsgrenze, bei der bislang die Freiheit des privaten Versicherungsgeschäfts anfängt. Eine aus so vielen Quellen gespeiste Bürgerversicherung könnte den Preis, den die Arbeitgeber für die zur Reproduktion ihrer Kräfte fälligen Nebenkosten der Arbeit zu zahlen haben, merklich senken, also Belastungen des Kapitals schonend sozialisieren. Die andern wollen diesen ärgerlichen Nebenkosten darüber beikommen, dass sie den Beitrag nach Lohnprozenten durch einen gesetzlich festzulegenden Einheitsbeitrag für alle ersetzen; der nominelle Arbeitgeberzuschuss würde – ungefähr ... – in der zuletzt gezahlten Höhe dem Bruttoentgelt zugeschlagen und wäre damit als besonderer Posten aus der Kostenrechnung des Kapitals eliminiert. Den Schlechterverdienenden, die mit dem neuen Einheitsbeitrag überfordert wären, würde der Staat bei nachgewiesener Bedürftigkeit ein wenig unter die Arme greifen; außerdem würde er im Interesse der Reproduktion seines Volkskörpers die Kopfpauschale für bislang mitversicherte Kinder übernehmen. So wäre von der Finanzierungsmethode her die Abtrennung der Gesundheitskosten vom Standortfaktor Lohn sichergestellt.
An diesen Radikallösungen gemessen ist der jetzt beschlossene Gesundheitsfonds freilich bloß ein matter Kompromiss. Immerhin leistet auch der schon mal die formelle Umwandlung von Beiträgen nach Lohnprozenten in einen einheitlichen Pauschalbetrag pro Versicherten, mit dem die Kassen kalkulieren müssen und zu dem sie im Bedarfsfall einen Zuschlag von ihren Kunden, also jedenfalls nicht mehr zu Lasten der Lohnnebenkosten erheben dürfen; so wird der Arbeitgeber gegen steigende Kosten des Versorgungswesens abgeschirmt. Den Besserverdienenden bleibt die Degradierung zu Zwangsmitgliedern der lohnabhängigen Solidargemeinschaft erspart; dafür wird die Gesamtheit der Steuerzahler zur Mitfinanzierung der Gesundheitskosten des nationalen Nachwuchses herangezogen; nach letzten Plänen vermittels einer Verbrauchssteuer, die alle Volksgenossen gleichmäßig trifft, also niemanden wegen seines über- oder unterdurchschnittlichen Einkommens diskriminiert. Zugleich sind mit der Konstruktion dieses Fonds neue Handhaben geschaffen, um den anderen Teil der großen Reformaufgabe anzugehen: das Projekt einer geschäftsdienlichen Ökonomisierung der Verwendung der eingesammelten Gelder.
5.
Das Reformwerk der Großen Koalition firmiert nicht zufällig unter dem Titel „GKV[4]-Wettbewerbsstärkungsgesetz“. Es zielt nämlich auf die Überwindung eines Mangels, den die Reformer dem Gesundheitswesen insgesamt und in allen seinen Teilen attestieren, und den sie zuerst und gründlich an der Schaltstelle des ganzen Systems, eben bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, ausräumen wollen. Sie unterstellen dem gesamten Laden systematische Ineffizienz; und im Lichte des Heilmittels, das sie dagegen in Anschlag bringen und mit dem sie nicht bloß weiter an Symptomen herumkurieren, sondern den entscheidenden Systemfehler erwischen wollen, sind sie sich ihrer Diagnose über den Grund aller Übel ganz sicher: Das System ist unproduktiv, vergeudet Mittel und Potenzen, verhindert wünschenswerte Geschäfte, weil ihm der heilsame Zwang der Konkurrenz fehlt, dem die Marktwirtschaft nach übereinstimmender Expertenmeinung doch all ihre wunderbare Effizienz verdankt. Fürs eingesammelte Geld wären eine viel erfolgreichere medizinische Versorgung und ein viel flotteres Geschäft mit Gesundheit und Krankheit zu haben, wenn die Kassen um Marktanteile, sprich: um beitragszahlende Kundschaft konkurrieren müssten.
Tatsächlich gibt es eine solche Konkurrenz schon seit Jahren. Auf Grundlage einer einschlägigen Generallizenz sind zahllose Betriebskrankenkassen gegründet worden, die ihre Kundschaft aus den Besser- unter den Schlechterverdienenden und den Gesündesten unter den Versicherungspflichtigen rekrutieren und deswegen geringere Beitragssätze berechnen können, also in vorbildlichster Weise dem Kapital Lohnprozente ersparen. Natürlich um den Preis, dass den herkömmlichen Kassen die Masse der unterdurchschnittlich entlohnten und der überdurchschnittlich krankheitsanfälligen Klientel auf die Finanzen drückt. Dieser Effekt wurde für ungerecht befunden und durch Kunstgriffe eines Risikostrukturausgleichs beschränkt, was freilich den angestrebten praktischen Beweis, dass es mit ein bisschen Wettbewerb doch billiger ginge mit der Gesundheitsversorgung, gleich wieder abgeschwächt hat. Mit dem – absehbaren und tatsächlich auch nicht ausgebliebenen – Chaos eines zerstückelten und zunehmend unübersichtlichen Versicherungsmarktes sind dessen Urheber im Nachhinein jedenfalls gar nicht zufrieden. Mit dem Gesundheitsfonds unternehmen sie daher einen Neustart in Sachen Konkurrenz der gesetzlichen Versicherer. Mit der Regel, dass jedes Mitglied unabhängig von seinem Einkommen und gezahlten Beitrag die gleiche Kopfpauschale mitbringt, soll nun dafür gesorgt werden, dass sich die Akquisition von Mitgliedern jeder Lohnstufe und Gehaltsklasse gleichermaßen lohnt, insoweit also gleiche Bedingungen bei der Werbung um Kundschaft gelten. Die verbleibende Wettbewerbsverzerrung durch Klientel-spezifische Unterschiede in der Krankheitskostenrisikoprognose wird durch eine neue Variante von Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen ausgebügelt.[5] Auf der Grundlage eines derart umfassend elaborierten Regelwerks soll, darf und kann dann endlich eine faire freie Konkurrenz um wirkliche Effizienz beim Geldausgeben losgehen. Als erste Bewährungsprobe ist die Lösung der Aufgabe vorgesehen, bei vorgeschriebenem Mindest-Leistungskatalog mit den zugewiesenen Beträgen auszukommen. Zusatzforderungen berechtigen das Mitglied zum Kassenwechsel; mit Beitragsnachlässen und differenzierten Leistungskatalogen können die Versicherungen sich umgekehrt attraktiv machen. Am Ende – so die Idee – überleben nur die besten; die „Insolvenzfähigkeit“ der gesetzlichen Kassen wird in einem besonderen Gesetz geregelt.
Richtig zum Tragen kommt der segensreiche Sachzwang zur Effizienz freilich nur, wenn gnadenlos wirtschaftende Kassen ihn auch an ihre Kunden und Geschäftspartner weiterzugeben verstehen. So wird mit der Drohung an die gesetzlichen Kassen, im Konkurrenzkampf auch kaputtgehen zu können, nach dem Willen und Kalkül der Reformer an der entscheidenden Schlüsselstelle im System ein Programm fest verankert, an dessen Durchsetzung die Gesundheitspolitik sich schon seit Jahren mit verschiedenen Instrumenten und nach ihren Maßstäben viel zu begrenztem Erfolg abmüht: Es geht um Erfolge im Kampf gegen unverantwortlich kostentreibendes Patientenverhalten wie gegen verantwortungslose Verschwendung und Ineffizienz im Geschäftsgebaren der abrechnungsbefugten Partner der Kassen, der Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser...
- Der Patient mit seinem zugestandenen Recht, jederzeit nach eigenem Ermessen bei jedem beliebigen Arzt seiner Wahl vorzusprechen und eine Abrechnungsziffer auszulösen, steht schon längst in dem Verdacht, überflüssige Kosten zu verursachen, statt mit Selbstdisziplin und gesunder Lebensführung den Etat der Kassen zu entlasten. Zuzahlungspflichten und Praxisgebühr sind daher nicht bloß aufs Einsammeln zusätzlicher Gelder, sondern ebenso auf die Disziplinierung der Kundschaft berechnet. Denselben doppelten Zweck verfolgen Pläne, die Behandlung gewisser selbstverschuldeter Gebrechen vom Delinquenten selber zahlen zu lassen; umgekehrt winken bereits manche Kassen mit netten kleinen Geschenken als Belohnung für nachweislich erfolgreich praktiziertes Gesundheits- wie für ein empfindliches Kostenbewusstsein beim Arzneimittelkauf, mit dem der Mensch sich Zuzahlungen ersparen kann. Weitere Fortschritte, und zwar in Sachen medizinischer Zweckmäßigkeit wie zugleich in puncto Kosteneffizienz, soll die elektronische Patientenkarte mit der eingespeicherten kompletten Krankheits-Biografie des Versicherten bringen: Der Idee nach bewahrt sie ihren Inhaber vor Fehldiagnosen und falscher Behandlung – und die Kassen vor den Folgekosten ärztlicher Missgriffe sowie vor den Unkosten für Mehrfach-Untersuchungen und Vielfach-Behandlungen, die schon seit langem als gewaltige Dunkelziffer durch die Fantasie der Sparkommissare des Gesundheitswesens geistern.
- Das andere und eigentliche Problem sind die Ärzte – die frei praktizierenden, aber auch die Krankenhaus-Mediziner – mit ihrer Therapiefreiheit. Dass unter dem Deckmantel der unteilbaren medizinischen Kompetenz und Verantwortung womöglich alles andere als lege artis und nach dem neuesten Kenntnisstand ge- und behandelt, vor allem aber und auf alle Fälle viel zu viel abgerechnet wird: Dessen sind sich die verantwortlichen Politiker seit langem völlig sicher. Deswegen haben sie sich schon vor Jahren zu einem radikalen Bremsmanöver entschlossen und auf den Gesamthonorartopf für alle Kassenärzte einen „Deckel“ getan, also eine – dann doch nicht ganz unflexible – finanzielle Obergrenze diktiert. Schon damit haben sie, ohne dass das bereits ihr erklärtes Programm gewesen wäre, für den Einzug des „Wettbewerbsprinzips“ in die heile Welt des ärztlichen Abrechnungswesens gesorgt: Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben sich von einer Pfründenverwaltung, die die Vergütungsansprüche ihrer Klientel addiert und an die gesetzlichen Kassen weiterreicht, weiterentwickelt zum Management eines zähen Ringens um zusätzliche Honorargelder auf der einen Seite, eines erbitterten Verteilungskampfes zwischen den verschiedenen Ärztegruppen mit ihren fachspezifisch unterschiedlich kalkulierten Geldforderungen auf der anderen Seite. Das Abrechnungswesen ist in der Folge zunehmend komplizierter geraten; etwa in der Weise, dass der Geldwert der den einzelnen ärztlichen Verrichtungen zugeordneten Vergütungspunkte vom Verhältnis der Anzahl der insgesamt wie in gewissen wohldefinierten Unterabteilungen quartalsweise angesammelten Punkte zum Gesamtbudget bzw. zu spezifischen Teil- und Unterbudgets für das entsprechende Vierteljahr abhängt, also bei viel Fleiß schon mal deutlich sinken kann. Die Vergütung neuer, als medizinisch zweckmäßig und unverzichtbar anerkannter Leistungen ist zugestanden, manche andere Leistung aus dem Katalog der Kassen gestrichen worden; für etliche chronische Krankheiten hat man Gesamtvergütungen festgelegt, für den Klinikbetrieb überhaupt Fallpauschalen eingeführt, nicht ohne für besonders gelagerte Fälle Abweichungen nach oben zu konzedieren, deren Anzahl einen gewissen Erfahrungswert aber auch nicht überschreiten sollte. Zwecks Begrenzung des Anstiegs der Pharmakosten wurde der Ärzteschaft mit Arzneimittelbudgets und der Androhung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Regressforderungen bei Überschreitung gewisser Durchschnittswerte um bestimmte Prozentsätze ein Kostenbewusstsein beigebracht, das prompt von einem Heer von Pharmareferenten in die richtige Richtung gelenkt wird. Und so weiter.
Jede sinnreich ausgedachte Modifikation im System der Leistungsvergütung löst Anpassungs- resp. Abwehrmaßnahmen auf Seiten der Leistungserbringer aus, die den beabsichtigten Effekt konterkarieren und möglichst trickreich ansetzende neue Eingriffe ins Vergütungssystem nötig machen, die ihrerseits wieder den medizinischen Geschäftssinn herausfordern, und so fort. Im Ergebnis steigen die Kosten immer weiter; schon gleich im Verhältnis zur schwindenden Finanzmasse, die der nationale Lohn hergibt. Auf der anderen Seite lässt auch der Effekt zu wünschen übrig, den die Gesundheitsindustrie verspricht und den die Gesundheitspolitiker sich ausrechnen, wenn sie doch immer wieder Zugeständnisse an die Anwälte und Handwerker des kostentreibenden medizinischen Fortschritts machen: Eine Gegenleistung in der Form, dass eine kostenaufwendig modernisierte medizinische Versorgung teurer chronischer Krankheitsfälle in feststellbarem Umfang die bislang üblichen Folgeschäden mindert und angefallene Folgekosten erspart, bleibt die Ärzteschaft schuldig. Deswegen sind die zuständigen Verwalter der Volksgesundheit auch schon seit längerem dazu übergegangen, in ihrem Medizinbetrieb auf Weiterbildung und überhaupt auf mehr Effizienz zu drängen. Dabei haben sie die Kassenärztlichen Vereinigungen mit ihren überkommenen Selbstverwaltungsbefugnissen als strukturelles Hindernis ausgemacht: Solange diese Standesorganisationen als Manager des Honorartopfes zwischen Kassen und ärztlichen Dienstleistern stehen, schirmen sie aus Sicht der Kassenverwalter den Medizinbetrieb gegen den gerechten Anspruch des Beitragszahlers auf gute Ware fürs Geld ab. Deswegen sind auch schon neue Methoden der Vergütung ins herkömmliche Honorarwesen eingeführt worden; z.B. Vereinbarungen zwischen Kassen und Arztpraxen über eine speziell honorierte Standardbehandlung bestimmter Volkskrankheiten – für deren Einhaltung wiederum mit dem Erlass von Zuzahlungspflichten das Interesse der Patienten geweckt wird –; oder auch die Festlegung von maximalen Tagestherapiekosten sowie zu verschreibenden Medikamenten für ausgewählte Gebrechen; auf die heilige Kuh der ärztlichen Therapiefreiheit wird dabei auch keine übertriebene Rücksicht mehr genommen. In diesem Sinne gehen die Reformer nun mit ihren neuen Gesetzespaketen voran. Angestrebt werden in zunehmendem Umfang direkte „Selektivverträge“ zwischen Kassen und Arztpraxen, die eine standardisierte kostengünstige Behandlung der jeweiligen Kassenpatienten zum Inhalt haben; den Ärzten wird die Erfüllung ihres zunehmend dringlichen Wunsches nach einem Honorarsystem in Aussicht gestellt, das jeder Leistung einen fixen Geldbetrag zuordnet, so dass der Doktor jederzeit weiß und nicht erst nach einem halben Jahr erfährt, was er verdient hat; dafür darf die Kasse dann schon ein wenig auf die Kosten drücken. Vorbild für diesen marktwirtschaftlichen Fortschritt mag die Art und Weise sein, wie gesetzliche Kassen mit echten kapitalistischen Pharma-Multis bereits um Preisnachlässe für Medikamente feilschen, deren Bezahlung noch zu ihrem Leistungskatalog gehört. Auf jeden Fall sollen die Kassen einen Wettbewerb zwischen den praktizierenden Leistungsanbietern veranstalten, der für den schlauen Abrechnungskünstler ebenso wenig Raum lässt wie für den standesbewussten Einzelkämpfer, der sein Praxisleben lang wegen zu geringer Vergütungen mit seiner KV hadert; diese Standesorganisation ihrerseits arbeitet bereits an ihrer Transformation in eine Management-Gesellschaft – eine ‚GmbH & Co. KG auf Aktien‘ oder etwas Ähnliches –, die den Medizinern gegen ein gewisses Entgelt die Aushandlung von Rahmenbedingungen für Verträge direkt mit den Kassen sowie die bürokratische Last der neuen Art von Leistungsvergütung abnimmt. Auch mit anderen rechtlichen Neuerungen, insbesondere der Abschaffung berufsständischer Sonderkonditionen für Betriebsführung und Arbeitsverhältnisse, wirkt die Gesundheitsreform auf einen marktwirtschaftlichen Paradigmenwechsel für den Geschäftsbetrieb von Arztpraxen wie Krankenhäusern und auch für die Apothekerzunft hin, ohne dass so recht von einem zielstrebig umgesetzten Masterplan die Rede sein könnte: Die Zukunft soll Kliniken, medizinischen Zentren und Handelsketten gehören, die mit angestellten Ärzten und Pharmazeuten – sowie, versteht sich, einem effektiv ausgebeuteten Pflege- und Hilfspersonal – nach den Regeln kapitalistischer Unternehmenskunst Geld verdienen und dabei schon aus Eigeninteresse alles wegrationalisieren, was die modernen Kassenwarte den herkömmlichen medizinischen Kleinunternehmern an Ineffizienz und überflüssigem Aufwand unterstellen.
6.
Mit ihrer großen Gesundheitsreform revidieren die Sozialpolitiker der Großen Koalition die Geschäftsbedingungen und -beziehungen innerhalb der Branche. In manipulativer Absicht greifen sie in überkommene Methoden der Geldbeschaffung, der Geldzuteilung und des Geldverdienens ein, was die betroffenen Akteure erregt, den Leuten aber, die in dem ganzen System mit ihrem bescheidenen Einkommen als Beitragszahler, mit ihrem gesundheitlichen Elend als Bündel von Abrechnungsziffern vorgesehen und eingeordnet sind, herzlich gleichgültig sein kann. Was für die herauskommt, ist nichts weiter, allerdings auch nichts Geringeres als die konsequente Fortsetzung einer praktischen Klarstellung, die selber gar nichts Neues ist. Sie werden an noch ein paar Punkten mehr als bisher schon mit der Tatsache konfrontiert, dass Gesundheit für sie ein sehr teilbares Gut ist – von Staats wegen eingeteilt nach Gesichtspunkten, die den Widerspruch zwischen medizinischem Gebrauchswert und geschäftlichem Tauschwert ihrer Versorgung unschön widerspiegeln. Der eine Teil besteht in den staatlich definierten Elementen einer modernen medizinischen Grundversorgung: in den Posten eines Leistungskatalogs, der nach wie vor die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten sowie einiges an Vorbeugung umfasst und ansonsten durch die Finanzmasse definiert ist, die der soziale Standortverwalter aus den Gesamtkosten der nationalen Arbeit abzuzweigen für standortpolitisch opportun und sozial passend hält. Der andere Teil der Gesundheit, immerhin der entscheidenden Voraussetzung für Lebensgenuss und für die zum Gelderwerb nötige Leistungsfähigkeit, gehört in den Bereich der Konsumartikel, von denen derjenige, der sie braucht, nach den sinnreichen Regeln der Marktwirtschaft erst einmal ausgeschlossen ist, nämlich durch den Preis, zu dem sie zu haben sind, und im Maß seines privaten Geldmangels auch ausgeschlossen bleibt. Dieser Teil zeigt eindeutig wachsende Tendenz. Schon vor den nächsten Reformschritten umfasst er so ziemlich alle Mittel zur Kompensation des alltäglichen Verschleißes; vieles davon bleibt bei geschickter Einteilung des privaten Budgets in Billigausgabe noch erschwinglich, immer mehr davon wird zum unerschwinglichen Luxus für immer mehr von den Leuten, die in ihrem und durch ihren lohnabhängigen Alltag verschlissen werden und Kompensation nötig hätten.
So revidiert der moderne Sozialstaat, was ihm an sozialer Gleichmacherei unterlaufen ist. Er sorgt dafür, dass man dem Gesundheitszustand der Bürger eines fortschrittlichen Kapitalstandorts wieder leichter ihre Position in der marktwirtschaftlichen Einkommenshierarchie ansieht, und dass die spezifische durchschnittliche Lebenserwartung genauer als zwischendurch schon mal den spezifisch proletarischen Lebensstandard widerspiegelt.
[1] Wie alle sozialstaatlichen Errungenschaften musste auch dieses Eigeninteresse dem modernen Klassenstaat erst von den Opfern seiner Marktwirtschaft beigebracht werden; mit nicht ganz gewaltfreiem Widerstand. In diesem System muss die armselige Mehrheit der Gesellschaft tatsächlich darum kämpfen, dass sie ihrer Herrschaft als nützliche Manövriermasse erhalten bleibt.
[2] Den Verästelungen dieses Systems bis in die Feinheiten der Rentner-Krankenversicherung und der Künstlersozialkasse hinein braucht man nicht weiter nachzugehen: Sie ändern nichts am Prinzip.
[3] Marx hätte das als Beispiel dafür gewertet, dass der aus der Lohnsumme abgezweigte Preis für Medizinisches fürs Kapital eine unbedingt zu korrigierende Übertreibung des „moralischen Elements im Wert der Ware Arbeitskraft“ darstellt.
[4] Gesetzliche Krankenversicherung
[5] Beides zusammen haben, wie erinnerlich, die Landesväter jener deutschen Regionen, in denen eine gesundheitsmäßig gut strukturierte Bevölkerung auch einkommensmäßig gut strukturiert ist, für zutiefst ungerecht befunden. So richtig national egalitär sollen die nationalen Konkurrenzbedingungen für die Finanzierung des Geschäfts mit der Krankheit dann doch nicht sein; so viel Volkssolidarität ist kernigen Bayern und hessischen Besserverdienern nicht zuzumuten.