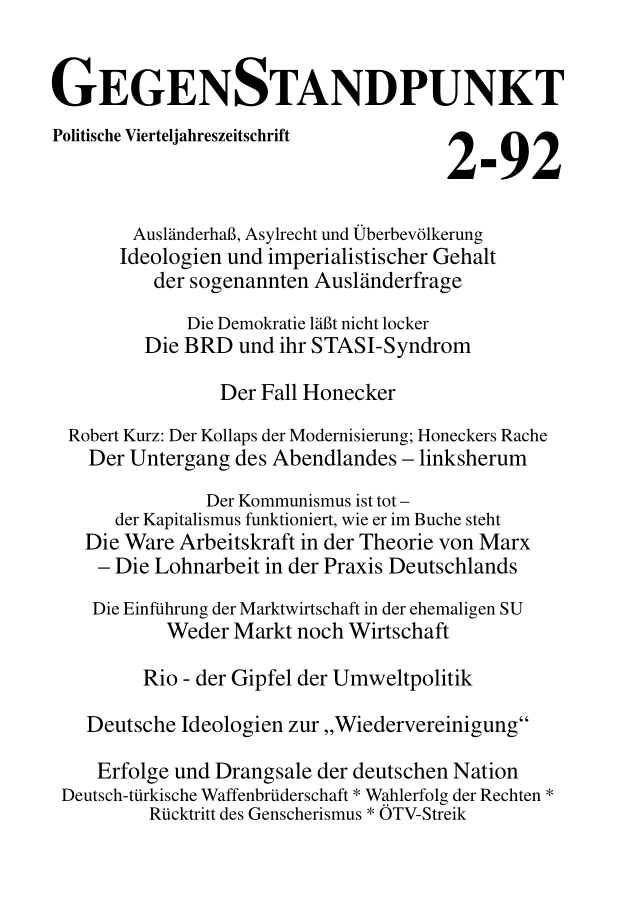Klein v in Deutschland
Lohn als Reproduktionsmittel des Arbeiters. Der Lohn als Finanzquelle des Staates. Der Lohn als Last diverser nationaler Bilanzen und als Kost fürs Kapital. Der Lohn als Kaufmittel der freien Verfügung über die Arbeitskraft zwecks Herstellung der Produktivität des Kapitals. Der Lohn als Mittel der Produktion abstrakten Reichtums (der Nation) und der Erhaltung der dafür nützlichen Armut des Proletariats.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. Der Lohn: Das endgültige Lebensmittel für Lohnarbeiter
- 2. Der Lohn als nationale Summe: Eine erfreulich belastbare Größe
- 3. Der Lohn: Eine Last für alle maßgeblichen Bilanzen
- 4. Der Lohn: Preis für einen „Produktionsfaktor“, dessen Leistung der Käufer definiert
- 5. Der Lohn: Mittel der Kapitalproduktivität
- 6. Der Lohn: Mittel für abstrakten Reichtum und nützliche Armut
Klein v in Deutschland
1. Der Lohn: Das endgültige Lebensmittel für Lohnarbeiter
a) Vom deutschen Lohn – oder auch Entgelt oder Gehalt – läßt sich leben. Und zwar in dem Sinn, daß man nicht schlecht damit fährt: Das ist, ohne daß da erst groß nachgerechnet werden müßte, demokratischer Konsens im Lande. Daran zweifelt keiner, der als sachkundige Stimme ernstgenommen werden möchte in Deutschland. Selbst die Gewerkschaften, denen die demokratische Öffentlichkeit im Rahmen der jährlichen Tarifrunden eine in Maßen abweichende Meinung in dieser Frage zugesteht – das gehört, heißt es, „zum Ritual“! –, erheben ihre Einwände weniger gegen die Güte des Lohns, der hierzulande gezahlt wird, als gegen die Gerechtigkeit seiner Bemessung im Vergleich mit anderen Einkommen, die sich in Deutschland verdienen lassen.
Zum Beispiel schon, je nach dem, im Vergleich mit den Löhnen, die in anderen Branchen als derjenigen, in der gerade um neue Tarife verhandelt wird, üblich sind. „Den“ „deutschen“ Lohn, von dem sich so gut leben läßt, gibt es nämlich allenfalls als rechnerischen Durchschnitt. Übrigens weniger zwischen verschiedenen Branchen; viel bedeutender sind die für jede Branche eigens ausgehandelten Unterschiede: Da geht es für wenige erfreulich hinauf, für ganz viele etliche Lohn- und Gehaltsstufen hinunter gegenüber dem Durchschnitt; und in der neuen deutschen Ostzone liegt sogar der Durchschnitt bloß bei zwei Dritteln des westdeutschen Durchschnitts. Da ergeben sich dann schon recht geringe Summen, von denen keiner leben möchte, der den Durchschnitt so gelungen findet. Aber daraus folgt allenfalls die Frage, ob es immer gerecht zugeht bei den Lohnunterschieden. Daß „wir“ im Prinzip im Wohlstand leben und daß, wer ordentlich einen Lohn empfängt
, auf alle Fälle dazugehört zu diesem wir
: die Grundüberzeugung wird durch die Existenz reichlich besetzter „Leichtlohngruppen“ nicht angetastet.
Gewiß – auch das ist bekannt und geläufig –, oft genug läßt sich von den wirklich ausgezahlten Löhnen vieles nicht bezahlen, was eigentlich zu den anerkannten Lebensnotwendigkeiten deutscher Arbeiter gehört; die Wohnung zum Beispiel, insbesondere wenn sie für ein bißchen Familie mit ausreichen soll; oder die Raten für die Möbel, die darinstehen, sofern die Frau nicht dazuverdient. Auch dieser Umstand wird üblicherweise aber nicht den Löhnen und ihrem tatsächlichen „Niveau“ zur Last gelegt. Schuld gibt man eher den Preisen, die aus irgendwelchen nicht ganz klaren Gründen immer wieder die Tendenz haben, für „Normalverdiener“ „unerschwinglich“ zu werden. Abhilfe ist dementsprechend auf gar keinen Fall beim Lohn zu suchen; der geht schon in Ordnung, auch wenn er für die Miete und zwei Kinder nicht reicht. Eher ist in solchen Fällen „die Sozialpolitik gefordert“, deren Macher ja auch gerne mehr Wohngeld und Familienlastenausgleich beschließen würden…
Wenn ihre Kassen nicht sowieso längst leer wären. Denn erstens sind ihre Finanzmittel aus irgendwelchen unumstößlichen Gründen grundsätzlich nie reichlich bemessen. Und damit müssen sie zweitens, mitten auf der „Wohlstandsinsel“ Deutschland, noch weit mehr Bedürftige betreuen als bloß „einkommensschwache“ Mieter, Jungfamilien usw. Massenhaft Arbeitslose zum Beispiel; und außerdem massenhaft Rentner und -innen, die bis zum bitteren Ende von den kleinsten Unregelmäßigkeiten ihrer Rentenbiographie heimgesucht werden. Fachleute für den Forschungsbereich „Armut in Deutschland“ zählen die verschiedenen Gruppen, denen man auch hierzulande das Fehlen jeglichen Wohlstands nachsagen darf, zu etwa einem Drittel der Bevölkerung zusammen. Für diesen Befund haben sie das Schlagwort „Zwei-Drittel-Gesellschaft“ erfunden, das mit seinem anklagenden Tenor alles wieder ins Lot rückt. Denn immerhin ist damit ja wieder klargestellt, daß alle diese Sorten Armut erst dort anfangen, wo der regelmäßige Lohnempfang aufhört, insoweit also nichts mit dem Lohn zu tun haben, im Gegenteil: Wer überhaupt einen Lohn bekommt, letztlich egal in welcher Höhe, ist allemal besser daran als jemand ohne – Millionen Verarmte sind der Beweis.
Sicher, einen gewissen Bezug zur Lohnfrage weisen die „Phänomene“ der Altersarmut, der Verelendung von Langzeitarbeitslosen, und was sonst noch eine „soziale Problemgruppe“ ausmacht, schon auf; das wird öffentlich gar nicht bestritten: Die freie Lohnarbeit schließt nun einmal das Risiko ein, entlassen und nicht wieder gebraucht zu werden; und nach allgemein bekannter und gebilligter Gesetzeslage sind die Überbrückungszahlungen um so geringer und um so kürzer befristet, je lückenhafter und je schlechter bezahlt die vorhergehende Beschäftigung war. Gleiches gilt für die Rente; und Rentnerinnen, die überhaupt zu wenig verdient haben, um in ihrer aktiven Zeit je in den Genuß der Sozialversicherungspflicht zu gelangen, sind eben deswegen noch schlechter dran. Wenn aber – und daran hält die gute Meinung vom deutschen Lohn sich fest – ein Arbeiterleben lang alles klappt und die Lohngruppe über dem Durchschnitt liegt und die Physis nicht vorzeitig kaputtgeht und weder Heirat noch Kind zur Unzeit eintreffen und auch sonst kein „Schicksalsschlag“ dazwischenkommt: Dann, immerhin, läßt sich vom Lohn leben. Sogar im Alter: Dank gesetzlicher Rentenversicherungspflicht langt der Lohn über den Zeitpunkt der Ausmusterung hinaus – der freilich nicht mehr unter 65 liegen darf, sonst wird es doch wieder knapp. Sogar für ein bißchen Arbeitslosigkeit würde der Lohn, dank der Arbeitslosenversicherung, mit ausreichen – freilich nur knapp; und wenn er dafür langen muß, dann wird es am anderen Ende, bei der Rente ganz gewiß wieder eng. Dank gesetzlicher Krankenkassenpflicht kann ein Lohnarbeiter sogar Krankheitszeiten durchstehen und, wenn seine Gene es hergeben, genügend Gesundheit wiederherstellen lassen, um sie in der Arbeit wieder zu lassen: Sogar dafür langt ein ordentliches Lohnarbeitsverhältnis in Deutschland, obwohl der Lohn für sich genommen das im Grunde überhaupt nicht hergibt.
Bloß zeigt sich da allmählich schon, wie es um das gute Leben vom Durchschnittslohn in der durchschnittlichen deutschen Wirklichkeit bestellt ist.
b) Vom deutschen Lohn – Gehalt, Entgelt… – läßt sich leben. Und zwar einfach deswegen, weil die, die davon leben, davon leben müssen. Es gibt nicht mehr; der Lohn muß reichen. Er muß für Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter mit ausreichen; das organisiert der Sozialstaat mit gesetzlichem Zwang und „Abzug an der Quelle“. Er muß für die Familie mit ausreichen, wenn man sich denn eine zulegen will. Er muß ausreichen fürs Wohnen, Leben und arbeitstägliche Erscheinen am Arbeitsplatz; da hat eben jeder zu schauen, wie er sich einteilt.
Und ohne Zweifel: Es geht. Millionen Lohnempfänger/innen in Deutschland führen täglich den Beweis, daß sie vom deutschen Lohn ein Leben hinkriegen – was sollen sie auch sonst machen. Der Lohn ist die gültige und endgültige Abrechnung; mehr kommt nicht nach. Er ist ihr definitives Lebensmittel; er definiert, was Lohnarbeiter sich leisten können im Leben. Also läßt sich davon leben: Ihr Leben ist soviel wert wie der Lohn, den sie kriegen.
Genau das unterscheidet die Lohn- (Gehalts-, Entgelt-) Empfänger/innen der Nation eben von anderen Teilnehmern der sozialen Marktwirtschaft. Auch die leben vom Lohn, aber ganz anders. Für sie ist er nicht das definitive Lebensmittel, mit dem sie klarkommen und sich reproduzieren müssen, sondern ein ökonomisches Mittel, mit dem sie kalkulieren und an dem sie sich bedienen. Und das eben auf eine Weise, daß für die Lohnempfänger die Kunst, vom Lohn bloß zu leben, gar nicht so einfach gerät.
2. Der Lohn als nationale Summe: Eine erfreulich belastbare Größe
Der deutsche Bundeskanzler hat für die Tarifrunde des Jahres 92 die Leitlinie ausgegeben, dies sei nicht die Zeit für Anspruchsdenken und Verteilungskämpfe. Damit hat er keineswegs angedeutet, in anderen Jahren wären seiner Meinung nach gewerkschaftliche Kämpfe für eine höheres Lohnniveau zu Lasten der Gewinne und der Staatsquote genau das Passende. Die Mahnung an die Gewerkschaften und womöglich kompromißbereite Unterhändler der Arbeitgeberseite, das „Umverteilen“ diesmal zu lassen, knüpft an gewisse längst laufende gesetzliche Umverteilungsmaßnahmen zugunsten der Staatsfinanzen sowie an die daraus erwachsenen Umverteilungseffekte zugunsten der Unternehmensgewinne an und richtet sich gegen alle Versuche, daraus ein Argument für Lohnforderungen zu machen. Der Kanzler stellt klar, daß der extrem kostspielige Neuaufbau der ehemaligen DDR zu einem vollgültigen Stück deutscher Wirtschaftskraft es verbietet, mit dem Geld der Nation weiterhin die gewohnten „Ansprüche“ von Leuten zu befriedigen, die es sich bloß als Lohn verdienen. Er plädiert für die in Gang befindliche nationale Geldumverteilung zu Lasten des Lohns, die ganz ohne „Verteilungskämpfe“ auskommt – allenfalls müssen gewerkschaftliche Abwehrversuche zurückgewiesen werden –, weil sie auf der Macht der Steuer- und Abgabengesetze und auf der gesetzlich geschützten Freiheit der marktwirtschaftlichen Preiskalkulation beruht.
a) Der deutsche Staat verlangt mehr Steuern, um seine neuen Aufgaben im Osten des Vaterlands solide finanzieren zu können. Die Wirtschaftskraft, auf der die ehemalige Staatsgewalt der DDR beruhte, ist unter den Erfolgsbedingungen des neu eingeführten Systems der Geschäftemacherei und dem Druck der überlegenen Konkurrenz westlicher Kapitalisten ersatzlos zusammengebrochen; und die neu aufgeblühte Marktwirtschaft wirft noch längst nicht entfernt das Steueraufkommen ab, aus dem sich bezahlen ließe, was für die neuen Verhältnisse nötig ist. Zumal da ganz andere staatliche Leistungen gefordert sind als diejenigen, die die untergegangene realsozialistische Staatsmacht für nötig befunden und aus ihren planwirtschaftlichen Mitteln erbracht hatte. Von der Garantie des Privateigentums bis zur Infrastruktur für einen modernen Kapitalumschlag, von der Subventionierung gewinnträchtiger Investitionen bis zur marktgerechten Altschuldenbedienung gibt es viele und kostspielige Dinge zu tun, die in der Staatsräson der untergegangenen Republik einfach nicht vorgekommen sind. Das Geld dafür nimmt sich der Staat, woher auch sonst, von seinen Bürgern.
Dabei wird nicht undifferenziert zugelangt. Auch beim Steuern-Einziehen behält der Staat seinen marktwirtschaftsgemäßen Aufgabenkatalog im Auge und unterscheidet zwischen Einkünften und Vermögen, auf deren Verwendung im Sinne des nationalen Wirtschaftswachstums er Wert legt, deren privates Wachstum er also eher entlastet, und Masseneinkommen, die ohne Schaden fürs Wirtschaftswachstum belastbar sind. Wenn er seinen Zugriff aufs Geld seiner Bürger einmal geregelt hat und alle sich daran gewöhnt haben, ist es zwar witzlos, die verschiedenen Steuerlasten den verschiedenen Sorten von Steuerzahlern als ihre spezielle Last zuzurechnen: Jeder mag sich von jeder Steuer Nachteile für sein spezielles Geschäft oder Einkommen ausrechnen; über die Lohnsteuer zum Beispiel kann sich ein Arbeitgeber, der darin eine staatliche Verteuerung seiner Arbeitskräfte sieht und „Lohnnebenkosten“ beklagt, genausogut beschweren wie ein Lohnempfänger, der sich geradezu reich vorkommt, wenn bloß sein Brutto auch sein Nettolohn wäre – der Unternehmer sogar mit weit größerem marktwirtschaftlichem Recht, weil bei ihm ja als Kosten zu Buche schlägt, was seine Beschäftigten sowieso erst gar nicht in die Finger bekommen. Um so mehr ist es aber bei Veränderungen der Steuerlasten von praktischem Belang, bei welchen Einkommen und Transaktionen der Staat zusätzlich zulangt oder sich zurückhält. Da schlägt die Lastenverteilung unmittelbar als Eingriff in die gewohnten Einkommens- und Lebensstandards zu Buche. Und hier geht die deutsche Regierung mit marktwirtschaftlicher Umsicht ans Werk – ganz nebenbei bringt sie noch ein paar andere, vorwiegend ideologische und volksmoralische Anliegen voran.
So läßt der Zuschlag zur Lohn- und Einkommenssteuer die geschäftliche Geldvermehrung unberührt, trifft ansonsten aber ganz egalitär die Löhne ebenso wie die Summen, die bei der Einkommenssteuererklärung der Reichen unterm Strich stehenbleiben. Insofern trägt er zur nationalen Solidarität bei, sollte aber auch mal wieder auslaufen, weil sonst der Leistungswille der Bessergestellten erlahmt. Die Verbrauchssteuern, insbesondere der für Anfang 93 beschlossene zusätzliche Prozentpunkt Mehrwertsteuer, treffen erst recht alle, aber in besserer Weise, nämlich soweit sie mit ihrem Geld nichts besseres anzufangen wissen, als davon zu leben; für „die Wirtschaft“ nimmt hingegen bloß ein durchlaufender Posten zu. Gleichzeitg nimmt zwar die Zahlungsfähigkeit des Massenpublikums entsprechend ab; dafür gibt es für die Geschäftswelt vom Staat finanzierte zusätzliche Verdienstmöglichkeiten an anderer Stelle; außerdem soll zum Ausgleich kapitalistisch verwendetes Vermögen von steuerlichen Lasten befreit werden. Zur Ideologie von der hemmungslosen „Konsumgesellschaft“ paßt eine höhere allgemeine Konsumsteuer auf alle Fälle; die höhere Mineralölsteuer bedient darüberhinaus das sensible Umweltgewissen der Deutschen so gut, daß sich die vergiftete Luft gleich viel leichter atmen läßt. Zumal das Tabakrauchen von Staats wegen erst recht verteuert wird. Und so weiter.
b) Per Gesetz werden die Einnahmen und Ausgaben der großen Sozialversicherungen neu geregelt. Sie haben jetzt auch für die DDR-Rentner aufzukommen; sie haben für die Betreuung der Massen im Osten zu sorgen, die entlassen worden sind und werden, weil ihre Entlohnung keinem privaten Unternehmer zuzumuten ist; sie haben das Geschäft mit der Krankheit zu finanzieren, das nun im Osten die unmenschliche Zwangsversorgung mit Polikliniken ablöst. Das kostet natürlich; mehr, als die hinzugewonnenen Beitragszahler den Sozialkassen jemals bringen. Die Aufgaben im Westen bleiben bzw. nehmen konjunkturbedingt zu. Neue Einnahmen müssen also her.
Dafür läßt der Staat nicht einfach undifferenziert den Steuerzahler geradestehen. Er besinnt sich darauf, daß er hier in seiner Eigenschaft als Sozialstaat tätig ist, und folgt den Regeln der gesetzlichen Umverteilung, die er für diesen Bereich eingeführt hat. Zuständig für Alte, Kranke und Entlassene sind die drei großen Sozialversicherungen, die bei den „Unselbständigen“ abkassieren, und zwar bis zu dem Einkommensniveau, bis zu dem der deutsche Staat diesen Leuten ganz einfach nicht zutraut, daß sie genug Geld übrig haben, um aus freien Stücken als noch rüstige Arbeitskräfte für ihr Alter, als Gesunde für ihren Krankheitsfall und als Beschäftigte für Zeiten der Arbeitslosigkeit vorsorgen zu können. Diesem Unvermögen begegnet er mit der Macht seiner Rechtsetzung und macht für seine Zwecke das Beste daraus. Er schafft für die drei Fälle der Einkommenslosigkeit große Umverteilungsanstalten mit dem Recht, sich vorab, an der Quelle, an der nationalen Gesamtlohnsumme zu bedienen, um aus dieser Summe die Kranken, Alten und Entlassenen mit durchzuziehen. So ist gewährleistet, daß die Lohnarbeitermannschaft der Nation insgesamt brauchbar bleibt, auch in ihren aktuell nicht benötigten oder unbrauchbaren Teilen, ohne daß dafür auch nur eine Mark aufgewandt werden muß, die nicht zuvor als Lohnzahlung ihren Dienst am nationalen Geschäftsleben verrichtet hat. Die Rücksichtslosigkeit, mit der die Marktwirtschaft ihre lohnabhängige Mehrheit behandelt, ist nicht abgeschafft, sondern als Prinzip anerkannt, ihre Wirkungen sind im Griff, die anfallenden Unkosten unter Schonung der Unternehmensbilanzen wie der Staatskasse auf die in Frage kommenden Opfer verteilt.
Nach diesem praktischen Grundsatz wird auch jetzt die Lohnsumme hergenommen und mit größeren Abzügen belastet, um den gewachsenen Anfall an Lohnabhängigen ohne Lohn kostenneutral zu bewältigen. Die geschröpften Beitragszahler dürfen sich damit trösten, daß ihnen die höheren Abgaben in dem Moment am meisten wehtun, wo sie neu eingeführt werden: Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, kalkuliert ohnehin kein Lohnempfänger mehr mit dem Drittel vom Lohn, das ihm der Staat abzieht. Außerdem läßt der deutsche Sozialstaat in seiner ausgleichenden Gerechtigkeit nicht nur die aktiven Beitragszahler Opfer bringen. Weil Solidarität keine Einbahnstraße ist, haben auch die Leistungsempfänger Opfer zu bringen, damit sie unter die nationale Lohnsumme drunterpassen, obwohl sie gar nichts davon verdient haben. Rentner werden Zug um Zug auf ein niedrigeres Rentenniveau heruntergesteuert: Vorgezogener Ruhestand kommt teurer als bisher; Lebensphasen ohne regulären Verdienst, auch z.B. Ausbildungszeiten, mindern die Altersrente stärker; und weil den Aktiven vom Lohn immer mehr abgezogen wird, bemißt sich der Inflationsausgleich für Rentner auch nicht mehr am Bruttolohn, sondern an der überproportional gesenkten Nettolohnsumme. Die Arbeitslosen, vor allem in Deutschlands neuem Osten, werden nicht mehr wie zuerst mit dem Idealismus traktiert, ein wenig marktwirtschaftliche Umschulung – Computer plus Renditedenken – brächte die Eingliederung in ein neu auflebendes Stück deutscher Weltwirtschaft; da lebt nichts auf, und deswegen werden die überflüssigen Werktätigen nach allen gesetzlichen Herabstufungsregeln in die vorgezeichnete Sozialhilfekarriere hinausgesteuert. Gestrichen werden auch solche eher völkisch motivierten Wohltaten wie Deutschunterricht für deutschstämmige Aussiedler, die die großdeutschen Volkstumspolitiker sich bislang von ihrer Arbeitslosenversicherung haben finanzieren lassen; wohl in der Erwägung, daß Arbeitslose ohnehin nichts zu sagen haben. Den gesetzlich Krankenversicherten wird durch immer neue Zuzahlungsregelungen beigebracht, was sie sowieso schon wissen, nämlich daß es ein teurer Spaß ist, als Lohnarbeiter fit zu bleiben oder immer wieder zu werden; außerdem werden die Mittelchen fürs ganz normale alltägliche Durchhalten, nicht ohne Logik, vollends zum Lebensmittel umdefiniert, das gefälligst jeder selbst bezahlt.
Der Sozialstaat rühmt sich, niemanden einfach einkommenslos werden zu lassen – freilich ohne daß er auch nur den Lohn sichern und zu einem garantierten Lebensmittel machen würde; das wäre ein Verstoß gegen die Freiheit der Marktwirtschaft. Seine entscheidende Leistung besteht darin, die Lohnabhängigen als Klasse zu behandeln, die insgesamt vom deutschen Lohn zu leben hat. Allen, die nach dem Kriterium der Einkommensart und -höhe zur Klasse der potentiellen Sozialfälle gehören, mindert er den Lohn; auf der anderen Seite stiftet er einen Lohnersatz für alle, die sonst vollends Sozialfälle wären. Organisiert ist das ganze als Umlage, die vom gezahlten Lohn das Nötige einsammelt; zugleich als Versicherung, die jedem einzelnen seinen gerechten Beitrag und seinen gerechten Lohnersatz vorrechnet. Daß auf diese Weise die Armutsfälle unserer „Zwei-Drittel-Gesellschaft“ geschaffen werden, und zwar ganz offiziell nach sozialstaatlichen Gesetzen, ist kein Einwand gegen den Sozialstaat, sondern bestätigt bloß, worum es diesem geht: eben nicht um die Verhinderung von individuellem Elend – die berühmten „Einzelschicksale“ entziehen sich sowieso dem sozialstaatlichen Zugriff –, sondern um die Funktionalität der Klasse.
Die Ideologie dazu besteht im Appell an die Solidarität. Freilich weniger die der Arbeiterklasse: Gerade bei den neuen Belastungen geht es mehr denn je um die schwarz-rot-goldene Volkssolidarität, vor allem mit den Brüdern und Schwestern aus der Ostzone, den Nachzüglern des sozialstaatlich verminderten und umverteilten Arbeiterwohlstands. Unter diesem Zeichen sollen alle Lasten hingenommen werden, die Deutschland sein wiedervereinigtes Arbeitsvolk tragen läßt, um mit Erfolg größer und stärker zu werden.
c) An der Netto-Lohnsumme, die bleibt, nachdem der Staat für seine Belange zugegriffen hat, bedient sich als nächstes die Geschäftswelt. Die braucht keine Tarifrunde abzuwarten und keine unerwünschten Verteilungskämpfe zu führen, um ihr Publikum mit den aktuellsten Preiskalkulationen zu konfrontieren. Auf die Zahlungsfähigkeit der Massen braucht sie dabei weiter keine Rücksicht zu nehmen: Die Konkurrenz mit anderen Unternehmern, die aus derselben Summe ihr Warenangebot bezahlt haben wollen, muß bestanden werden, und das ist etwas anderes als ein Sachzwang zur Schonung der Massenkaufkraft.
Umgekehrt hat dieselbe Geschäftswelt sofort sinnvolle Verwendung für jede zusätzliche Mark an „Volkseinkommen“, die der vergrößerte Staat mit Steuern und Schulden in seiner neuen Ostzone stiftet: Sie wird von konkurrenztüchtigen Anbietern abgeschöpft. Und wo der Markt auf so erfreuliche Weise expandiert wie im Zuge der deutschen Einigung, da wird die neue Freiheit, die sich damit einstellt, nämlich die zu Preiserhöhungen, sofort ausgeschöpft: Weil die Wirtschaft boomt, wird alles ein paar Prozent teurer. Dieses Vorgehen fällt nicht unter „Vereinigungskriminalität“, sondern ist ein legitimer Beitrag zum Wirtschaftswachstum. So wird die nationale Lohnsumme ihrer marktwirtschaftlichen Zweckbestimmung zugeführt, der Geschäftswelt ihr Warenangebot zu versilbern, ohne daß die Lohnempfänger in den Genuß einer entsprechend vergrößerten Warenmenge kommen müßten.
Das logische Ergebnis ist ein wenig mehr Bereicherung dort, wo der Reichtum ohnehin zu Hause ist, und ein wenig zusätzliche Einschränkung da, wo sowieso sparsam eingeteilt werden muß. Im offiziellen Sprachgebrauch heißt dieses Resultat freilich etwas anders, sehr viel unpersönlicher: Inflation. Damit ist ausgedrückt, daß nach herrschender Lehre die Gesamtheit aller Preissteigerungen weder einen rechten Urheber hat – außer der vermehrten Kaufkraft in der Nation – noch irgendeinen identifizierbaren Nutznießer, sondern so etwas wie ein marktwirtschaftliches Urphänomen ist, das sich derzeit mal wieder stärker bemerkbar macht. Bis auf zwei Stellen hinter dem Komma wird die Teuerung als prozentualer Geldwertschwund ausgerechnet und gilt als Übel, das auf gar keinen Fall noch dadurch vergrößert werden darf, daß die Gewerkschaften für ihre Leute einen entsprechenden Ausgleich verlangen. Geschieht dies, dann ist jedenfalls klar, daß die Lohnarbeiter sich ihre zunehmende marktwirtschaftliche Schröpfung selbst zuzuschreiben haben.
d) An eine Schranke stößt die Freiheit allerdings schon, mit der Industrie und Handel die gesamtdeutsche Lohnsumme geschäftlich ausnutzen: Es gibt noch eine andere gesellschaftliche Klasse, die sich daran bereichern darf und damit die frei verfügbaren Masseneinkommen beträchtlich schmälert. In Deutschlands marktwirtschaftlichem Westen ist es ungefähr ein Drittel der Nettolohnsumme, was aufs Konto der Haus- und Grundbesitzer überwiesen wird für den Dienst, Leute ohne Eigentum trotzdem irgendwo wohnen zu lassen. Im Osten besteht hier noch ein gewaltiger Nachholbedarf: die entsprechende Quote liegt erst bei 10 Prozent, und das bei niedrigeren Löhnen. Immerhin: Bislang gab es im Osten für Grundeigentum gar nichts; insofern keine schlechte Steigerungsrate.
Von zunehmender Bereicherung einer Eigentümerklasse auf Kosten der Lohnempfänger ist freilich auch hier nicht die Rede. Die marktwirtschaftliche Einkommensideologie mag nicht einmal bei steigenden Mieteinnahmen den Nutznießer kennen und erklärt die Sache lieber so unpersönlich, daß erstens niemand etwas dafür kann und zweitens eher noch das Grundeigentum selbst – um so mehr, je unverschämter es zulangt – als unbedingt subventionsbedürftiger Dienst an der Volkswohlfahrt dasteht: „Die Knappheit“, an Wohnungen nämlich, treibt ganz von selbst die Mieten in die Höhe und verlangt den sozial wohltätigen Verzicht des Staates auf Steuern sowie Zuschüsse an Vermieter, direkt oder auf dem Umweg über sozialstaatliche Mietbeihilfen, damit „die Wohnungsnot“ nicht immer schlimmer wird.
*
Für den Fiskus mit seinem enorm angeschwollenen Finanzbedarf, für die Sozialkassen mit ihren schlagartig gewachsenen Aufgaben der Armutsbetreuung im Osten, für das Grundeigentum mit seinem rasanten Neuerwerb im Osten und einer geldwerten Wohnungsknappheit im Westen, für die Industrie einschließlich Agrarindustrie und den Handel mit ihrem unabweisbaren Bedürfnis nach dem Geld ihrer Kundschaft: für beinahe alle maßgeblichen ökonomischen Interessen im Lande ist der Lohn – nicht der einzelne in seiner unerheblichen Höhe, sondern der nationale, die Summe der sogenannten Masseneinkommen – von allergrößtem Interesse als Geldquelle und erfreulich belastbares Mittel ihrer Kalkulationen. Sie alle haben guten Grund, den Lohn und sein nationales Niveau zu loben, weil sie sich daran, in Konkurrenz gegeneinander, freizügig bedienen.
Für die Lohnarbeiter, die davon bloß leben müssen, erweist sich ihr Lohn eben damit als höchst unzuverlässige Größe. Die Summe steht mit der Lohnabrechnung fest und damit auch, was ihr Lebensunterhalt wert ist; aber was sie damit in Händen haben, steht erst noch dahin, nämlich zur Disposition mächtigerer Instanzen und ökonomischen Interessen. Diejenigen, die vom Lohn bloß leben müssen, sind mit ihrem Lebensunterhalt die abhängige Variable der Interessen, die Staatsgewalt und Geschäftswelt daran geltend machen – soviel ergibt allein schon die nähere Besichtigung der Lohnsumme und des Gebrauchs, der davon gemacht wird.
3. Der Lohn: Eine Last für alle maßgeblichen Bilanzen
a) Neben dem öffentlichen Lob des deutschen Lohnniveaus steht die öffentliche Kritik daran; neben der Selbstverständlichkeit, daß Lohnempfänger hierzulande grundsätzlich optimal bedient sind, die genauso selbstverständliche Betrachtung des Lohns als Last, die kaum noch zu tragen ist. Es gibt auch eine klare logische Reihenfolge zwischen diesen beiden Selbstverständlichkeiten: Die Beteuerung, ein deutscher Lohn wäre allemal die Erfüllung alles dessen, wovon ein Lohnarbeiter nur träumen kann, ist der Auftakt zu einem „aber“, das auf die Untragbarkeit einer solchen Entlohnung aufmerksam machen will. Der Glückwunsch an die Lohnempfänger lebt schon von der stillschweigenden Unterstellung, daß diese Leute mit ihrem Entgelt eine Belastung für die Wirtschaft sind und es dafür enorm weit gebracht haben – genaugenommen schon längst viel zu weit.
Die eleganteste Fassung dieses Tadels ist den Fachleuten der deutschen Marktwirtschaft mit dem Argument gelungen, die Löhne selbst wären ja allenfalls noch tragbar; zusammen mit den vom Staat eingesammelten Lohn-„Nebenkosten“ jedoch, dem „zweiten Lohn“, wären sie dann doch zu hoch. Ein schöner Einfall, die Abzüge vom Lohn, die der Staat verhängt, als Zusatzlast zu verbuchen, die Beschränkungen beim Gesamtlohn erfordert: Weil der Staat sich vom Lohn soviel nimmt, muß der Lohn sinken. Die aktuelle Fortsetzung dieser attraktiven Überlegung liefert der Kanzler mit seiner Warnung vor unzeitgemäßem Anspruchsdenken: Wo der Staat erst recht zulangt, wegen Einigung und Solidarität, da darf erst recht kein nomineller Zuwachs sein, der die angesammelten Lohnverluste ausgleichen könnte.
Mit dieser Beurteilung des Lohns als Last, bei der zu fragen ist, ob „wir“ sie „uns“ noch leisten können, wird der Standpunkt des Unternehmerinteresses geltend gemacht. Stur an diesem Interesse gemessen, ist der Lohn ein Kostenfaktor und jede Mark, die die Arbeitgeber zahlen müssen, ein Abzug vom eigentlich möglichen Unternehmensertrag. Dieser Interessensstandpunkt der geschäftemachenden Klasse wird ausgemalt im Lied von den Lohnkosten, die das Betriebsergebnis auffressen, den Spaß am Unternehmen verderben, patriotische Arbeitgeber in Auslandsinvestitionen hineintreiben, der ausländischen Konkurrenz in die Hände arbeiten, Gegenwart und Zukunft „versägen“, den Unternehmensstandort Deutschland kaputtmachen, ehrliche Mittelständler in die roten Zahlen treiben usw. Verlogen und leicht absurd ist dieser Standpunkt, weil er völlig davon absieht, was die Arbeitgeber mit dem Lohn kaufen und mit den bezahlten Arbeitskräften anfangen; verbucht werden lauter Kosten ohne den Ertrag, für den Löhne bezahlt werden, bzw. als bloße Abzüge vom Ertrag, so als käme der auch ohne entlohnte Arbeit zustande. Trotzdem gilt die Dauerbeschwerde über die Lohnkosten nicht als Borniertheit von Geschäftemachern, die den Hals nie vollkriegen, sondern als Inbegriff ökonomischer Vernunft. Alle wichtigen Instanzen im demokratischen Gemeinwesen teilen ihn, machen dementsprechend ihre gewichtigen Bilanzen auf – und stellen damit sicher und zugleich öffentlich klar, daß beim Lohn der Klassenstandpunkt der Unternehmer der gültige ist, der maßgebliche Standpunkt der ganzen Nation:
- Alle Wirtschaftspolitiker verbuchen die in der Nation gezahlten Löhne als nationales Problem. Den Konkurrenzbedürfnissen ihrer Unternehmer entnehmen sie nämlich die geltenden Anforderungen an Deutschland als brauchbaren Standort für geschäftliche Aktivitäten; und weil solche Aktivitäten die Existenzgrundlage ihrer nationalen Macht sind, ergreifen sie für deren Erfolg Partei. Aus Gründen ihrer Staatsräson teilen sie die Definition der Löhne als Kostenfaktor und erheben, praktisch wie auch ideologisch, das bornierte Unternehmerinteresse an niedrigen Löhnen aus dem Status einer Privatsache in den Rang einer wichtigen, wenn nicht der nationalökonomischen Erfolgsbedingung. So stehen sie für die konsequente Durchsetzung der Systementscheidung ein, die sie gar nicht mehr zu treffen brauchen, sondern wie eine sachliche Selbstverständlichkeit behandeln: dafür, daß der Reichtum ihrer Nation seine Zweckbestimmung nicht in der Befriedigung der Lohnarbeiter hat, sondern in seiner systematischen Abtrennung von deren Bedürfnissen, in der Herabsetzung dieser Bedürfnisse zur abhängigen Variablen der Geschäftsinteressen, auf die es ankommt und die den Lohn ein für allemal als notwendiges Übel und Last verbuchen.
- In ihrer Eigenschaft als öffentliche Arbeitgeber für ein großes Heer kleiner Beamter und Angestellter sind Staatsmänner von vornherein dem Standpunkt verpflichtet, daß der öffentliche Dienst zuviel Lohn verschlingt. Geldzahlungen an Verwaltungsamtmänner, Krankenschwestern, Lehrer usw. zählen eben nicht zu den politischen Zwecken, an denen ihnen liegt und für die die nötigen Schulden allemal gemacht werden; das unterscheidet die Gehaltszahlungen zum Beispiel von der deutschen Einheit, dem deutschen Einfluß in der Welt oder auch dem staatlichen Schuldendienst, dieser öffentlichen Zinszahlung in private Taschen, die überhaupt nie Gegenstand von „Tarifrunden“ mit den Geschäftsbanken ist. Gewiß ist das meiste, was ein erfolgreicher Staat will und braucht, ohne Lohnempfänger nicht zu haben; deren Entlohnung ist deswegen aber noch lange nichts Gutes, sondern ein Schaden für den Staatshaushalt, eine Beschränkung für die Gestaltungsfreiheit unserer gewählten Parlamente, insofern geradezu undemokratisch, und so weiter. So folgen die Politiker mit ihrem Arbeitgeberstandpunkt der Logik des Lohnsystems, das den Lebensunterhalt von Arbeitnehmern nur als Mittel zum Zweck kennt – für einen so hohen Zweck, daß im Grunde schon jede Mark in Arbeitnehmerhand irgendwie zweckentfremdet wirkt. Sie sorgen dafür, daß alle Sphären der nationalen Gesellschaft, bis tief in den höheren Beamtendienst hinein, dieser Logik unterworfen werden.
- Die deutsche Bundesbank, bewegt von der Sorge um ihr ureigenstes Produkt, die Deutsche Mark, sieht in der nationalen Lohnsumme nicht nur überhaupt eine Last. Vor lauter Verständnis dafür, daß die Unternehmer jede Gelegenheit zu Preiserhöhungen nutzen und sich dafür auf die Lohnkosten berufen, hat sie den Lohn als denjenigen volkswirtschaftlichen Kostenfaktor ausgemacht, der überhaupt alle Preise in die Höhe treibt und damit den Wert ihrer Geldscheine aushöhlt. Darauf kann sie als verantwortlicher Geldhüter – sagen ihre Sprecher – nur so reagieren, daß sie ihr Geld teurer macht, also mit höheren Zinsen die Anforderungen an gelungene Geschäfte höherschraubt: Wenn dann Lohnempfänger auf der Strecke bleiben, weil ihre Beschäftigung sich nicht mehr lohnt, dann haben sie die gerechte Quittung für ihren unverantwortlich hohen Lohnempfang. Eine etwas seltsame Bilanz, die aber eins ganz klarstellt: Damit die D-Mark sich als das bewährt, als was sie sich bewähren soll, nämlich als erstklassiges, international geschätztes Geschäftsmittel, gehört sie nicht – eigentlich überhaupt nicht und auf alle Fälle nicht zu reichlich – in Arbeitnehmerhand.
- In diesem Jahr haben sich sogar, auf Einladung des deutschen Finanzministers, die Lenker der gesamten Weltwirtschaft, die G7, um den deutschen Lohn gekümmert. Nach ihrer Meinung hängt zur Zeit die Entscheidung zwischen Wachstum und Krise der Weltwirtschaft an der deutschen Konjunktur; und die hängt von den Lohnprozenten ab, die in er diesjährigen Tarifrunde ausgehandelt werden: Je mehr Prozente, desto mehr Krise. In diesem Sinn wurden die deutschen Lohnempfänger ersucht, nicht für ein paar Mark auf dem Gehaltskonto die Weltwirtschaft zu verschaukeln. Eine reichlich lächerliche Grußadresse der Mächtigen ans deutsche Fußvolk, die aber auch immerhin eines klarstellt: Daß der Lohn als Last gilt, ist eine Systemfrage von weltweitem Belang – die ganze Weltwirtschaft funktioniert nach dieser Logik.
- Die Wirtschafts-Sachverständigen tun, was sie immer tun: Sie fassen die interessierten Bilanzen von Unternehmern, Wirtschaftspolitikern, Banken, Nationalbanken, supranationalen Banken usw. in Gutachtenform, indem sie den maßgeblichen ökonomischen Interessen mit wissenschaftlicher Autorität den Rang von Sachverhalten verleihen, denen sich ohnehin kein Mensch mit Verstand entziehen kann, und speziell allen lohnfeindlichen Interessen den Charakter von Sachzwängen zusprechen, die unbedingt zu respektieren sind. So drückt die volkswirtschaftliche Ideologie aus, daß die Trennung und Entgegensetzung von Lohn und nationalem Reichtum eine Frage des Systems ist, zu dem diese Wissenschaft keine Alternative kennt und auch gar nicht für überhaupt denkbar halten will.
Und alle, die da gegen den Lohn ihre maßgeblichen Bilanzen eröffnen, verstehen sich auf den dialektischen Schluß, daß den Lohnempfängern selbst mit höheren Löhnen am allerwenigsten gedient wäre: Wo einerseits schlichtweg alles von bescheidenen Löhnen in Deutschland abhängt, da hängt andererseits der deutsche Lohn selbst von so ziemlich allen Rechnungen ab, die er beeinflußt; seine Höhe, von der man so gut leben kann, hängt von seiner Niedrigkeit ab. Eine verrückte Rechnung, der ihr Realismus jedoch nicht zu bestreiten ist: Sie bestätigt, daß der Lebensunterhalt von Lohnarbeitern von einem Wirtschaftssystem abhängt, das dafür eigentlich nichts übrig hat, nur bedingt möglichst wenig.
b) Das Gejammer der Unternehmer über die erdrückenden Lohnkosten ließe sich vielleicht abbuchen unter die Beschwerden, die allemal erhoben werden, wenn irgendwem irgendein Preis mal wieder zu hoch vorkommt. Alle anderen Preise aber, über die im Namen der Nation öffentlich geklagt wird, werden gezahlt – oder eben nicht, wenn jemand nicht zahlen mag oder kann –; denn sie werden von Geschäftsleuten gemacht und verlangt, die ihre Kalkulation angestellt und ihre Konkurrenz im Visier haben. Da begleitet das Gejammer die Sachzwänge des Marktes. Das ist beim Lohn ganz anders.
Über diesen „Preis“ wird Jahr für Jahr unter großer öffentlicher Anteilnahme diskutiert, gerechtet und entschieden; und dabei werden alle Gesichtspunkte, unter denen der Lohn als Last kritisiert wird, zu Bestimmungsfaktoren für die Festsetzung der Tarife, oder sie werden als bestimmende Faktoren für die festgesetzten Löhne in Erinnerung gerufen und bekräftigt. Denn diese Gesichtspunkte treffen nicht auf Geschäftsleute, die aus Produktionskosten und Gewinninteressen ihre Preisforderung herausrechnen und alles tun, um sie gegen die Konkurrenz durchzusetzen, sondern auf eine Gewerkschaft, die einen Streit um Rücksichtnahme auf die Lohnarbeiter führt und dabei selbst auf alle Interessen und Argumente Rücksicht nimmt, die gegen den Lohn sprechen. Die Tarifunterhändler der deutschen Gewerkschaften jedenfalls brauchen nicht erst von ihren Verhandlungspartnern an die prinzipielle Abhängigkeit der Arbeitnehmer von den Arbeitgebern erinnert, also mit den tatsächlich herrschenden ökonomischen Machtverhältnissen konfrontiert zu werden, die in der allgemeingültigen Einschätzung des Lohns als Last unterstellt und gebilligt sind. Die gewerkschaftlichen Tarifpolitiker bemessen von vornherein ihre Forderung nach Lohn-„Angleichungen“ an dem Spielraum, den sie dafür aus dem Wachstum des nationalen Geschäftsgangs und seiner Überschüsse herausrechnen; sie fordern bewußt vom Standpunkt der abhängigen Variablen, der Abhängigkeit des Lohns vom Erfolg der Geschäftswelt aus. Sogar eine Diskontsatzerhöhung der Bundesbank, veranstaltet im Namen der Ideologie, so wäre „der Preisauftrieb zu dämpfen“, macht ihnen jenseits aller sachlichen Zusammenhänge, aber ganz im Sinne der offiziellen Währungshüter-Ideologie soviel Eindruck, daß sie darin einen Eingriff in ihre Tarifautonomie sehen, also politischen Druck verspüren und sich den zu Herzen nehmen. Daß bei der Neueinstellung von Arbeitslosen die gültigen Tarife offiziell unterboten werden, also die Notlage von Entlassenen zur Lohnsenkung ausgenutzt wird, dulden die Gewerkschaften nicht; dem erpresserischen Argument von Arbeitgebern aber, die Einstellung von Arbeitskräften wäre ihnen allenfalls bei niedrigeren Löhnen möglich und käme bei gegebenem Lohnniveau jedenfalls überhaupt nicht in Frage, mögen sie sich nicht entziehen und bieten schon einmal von sich aus Lohnopfer an, wenn dafür die „vorhandene Arbeit“ auf mehr Beschäftigte „umverteilt“ würde – ersteres ist in vergangenen Tarifrunden gern akzeptiert worden, letzteres ein frommer Wunsch geblieben, dessen Erfüllung sich die Gewerkschaftsexperten auf eigene Faust aus den Entlassungszahlen der jeweils folgenden Jahre herausrechnen.
So gehen die Bilanzen, also Interessen derer, die Lohnzahlungen als Belastung rechnen, in die Bestimmung der Lohnhöhe ein – und das ganz ohne Macht- und „Verteilungskämpfe“. Kommt es doch zum Streit, weil die entgegengesetzten Rechnungen nicht ganz auf einen Nenner kommen, und zum Streik, weil die Gewerkschaftsseite sich die Selbstherrlichkeit der Unternehmerseite nicht bieten lassen kann, dann bieten deutsche Gewerkschaften meist das lächerliche Schauspiel einer Arbeitermacht, die für halbe oder Zehntel Anpassungsprozente mobil macht. Am Ende bleibt allemal der Lohn der einzige „Preis“ in der Marktwirtschaft, der maßgeblich nach den Interessen derer kalkuliert und immer neu durchkalkuliert wird, die ihn zahlen müssen.
„Finden“ – wie sich die deutschen Gewerkschaften in ihrer Redeweise von der „Lohnfindung“ ausdrücken – lassen sich die Lohnbeträge auf diese Weise allerdings auch nicht; bzw. nur auf der Grundlage, daß sich längst der Tarif herausgebildet hat, mit dem einerseits das nationale Geschäft über die Jahrzehnte zuerst wunderbar und dann weltrekordmäßig gewachsen ist und den sich auf der anderen Seite die Lohnempfänger als ihren „Lebensstandard“ haben gefallen lassen. Ohne Machtkämpfe zwischen den ungleichen Parteien der Marktwirtschaft ist da nichts zustandegekommen; aber deren Ergebnis ist längst zur Gewohnheit geworden; und was sich ein lohnarbeitender Zeitgenosse ortsüblicherweise in seinem Leben leisten kann, das gilt seither als guter Grund für die Fortschreibung der Lohntarife. Die Auseinandersetzungen, die die deutschen Gewerkschaften Jahr für Jahr führen, funktionieren nur deswegen in ihrer Art, weil im Prinzip sowieso festliegt, wieviel Geld ein Lohnarbeiter bekommt, und normalerweise nur die kleine Zusatzfrage zur Entscheidung ansteht, inwieweit Preissteigerungen sowie Änderungen in der nationalen Wachstumsbilanz zu einer Lohnanpassung führen sollen.
c) Diese Zusatzfrage kann freilich bei Gelegenheit durchaus gewichtig werden; das ist gerade jetzt, in den ersten Tarifrunden im wiedervereinigten Deutschland, der Fall. Dies allerdings nicht deswegen, weil die Gewerkschaften ganz außerordentlich zulangen und allen Ernstes Umverteilungskämpfe zugunsten der Lohnempfänger führen wollten, sondern aus dem entgegengesetzten Grund. Ganz ohne „Tarifpoker“, „Schlichtung“ und „Kompromiß“ verstaatlicht die Regierung zusätzlich merkliche Lohnteile und dezimiert „die Inflation“ den verbleibenden Rest. Vom Lebensstandard, den Lohnarbeiter sich leisten können, nehmen diese Staatsinitiativen und Geschäftsstrategien einiges weg, woran man in der Bundesrepublik gewöhnt war und worauf die Gewerkschaft so etwas wie ein moralisches Gewohnheitsrecht reklamiert. Nun sollen die Gewerkschaften, nach dem Willen der Regierung und dem Interesse der Unternehmer, in der laufenden Tarifrunde offiziell im Namen der Betroffenen auf den Teil des historisch zustandegekommenen und zu einer Art moralischem Anrecht gediehenen Lohns verzichten, den die Nation angesichts ihrer neuen historischen Lage und mit ihren neuen moralischen Ansprüchen für entbehrlich erklärt und praktisch ohnehin beseitigt.
Die Art, in der die deutschen Gewerkschaften fast schon seit Menschengedenken die Lohnfrage rituell aufwerfen, soll sich in dieser Lage neu bewähren. Sie soll den guten Grund, der diesmal hinter der offiziellen Zumutung einer ausdrücklichen Lohnsenkunsvereinbarung steht, anerkennen und im Streit um gerechte Abmilderung ihre Klientel daran gewöhnen, daß es ohne den verlangten Verzicht nicht geht. Das Exempel wird am öffentlichen Dienst durchgezogen, weil hier der gute Zweck, die Bewältigung des staatlichen Finanzbedarfs, und das Arbeitgeberargument für Lohnverzicht unmittelbar zusammenfallen. Die Gegenwehr der Gewerkschaft wird öffentlich mit dem Vorwurf bedacht, sie hielte sich in neuer Lage an ihr altes Droh- und Streikritual – dabei baut in Wahrheit die Arbeitgeberseite darauf, daß der Gewerkschaft zur eingeleiteten „Wende“ in der nationalen Tarifpolitik, nämlich in Richtung auf die Unterschrift der Gewerkschaft unter die politisch verlangten Verzichtsleistungen, nichts anderes als ihr altes „Ritual“ einfällt: ein Streik, der den Mitgliedern zum Minus-Ergebnis die Genugtuung verschafft, daß es erkämpft wurde und ein noch schlechterer Abschluß abgewendet.
Und es kommt wie bestellt. Der Abschluß erreicht kaum die offizielle Teuerungsrate, und die Basis wird mit dem Hinweis getröstet, es sei ohnehin nicht um die Durchsetzung von „Maximalforderungen“ gegangen, sondern um die Brechung eines Arbeitgeberdiktats. Dafür kommt es auf einen Hunderter mehr oder weniger tatsächlich nicht an.
4. Der Lohn: Preis für einen „Produktionsfaktor“, dessen Leistung der Käufer definiert
Der Standpunkt, wonach die Löhne im Wesentlichen eine Last für die Wirtschaft darstellen, ist allgemeingültig, theoretisch wie praktisch; er ist auch in durchschlagender Weise lohnwirksam; nichtsdestotrotz ist er verlogen. Denn er ignoriert die Dienste, die sich die Arbeitgeber durch Lohnzahlungen verfügbar machen.
In gewisser Weise ist das zwar eine sehr passende Sicht der Dinge. Sie spiegelt in aller Borniertheit die Selbstverständlichkeit wider, mit der die Arbeitgeber die Lohnarbeit als ihr Mittel und sonst nichts behandeln, so daß es am Ende tatsächlich als Ärgernis erscheint, daß sie sie noch bezahlen müssen. Ansonsten ist es ja wirklich ihre Sache, die Lohnarbeit einzusetzen, wie es ihnen paßt – auch das eine Umkehrung aller Marktverhältnisse: Normale Waren haben ihren Gebrauchswert und sind nur gemäß ihren nützlichen Eigenschaften fürs Geschäftsinteresse des Käufers einsetzbar. So festgelegt ist die gekaufte Arbeit nicht. Eben deswegen ist es allerdings auch so absurd, ausgerechnet in der Lohnsumme diejenige Größe auszumachen, mit der alles über das geschäftliche Schicksal der Arbeitgeber entschieden wäre. Das Entscheidende kommt erst noch, wenn der Lohnempfänger mit seiner Arbeitszeit seinem Arbeitgeber gehört: die Lohnarbeit.
a) Mit dem Lohn kaufen sich die Unternehmer einen Produktionsfaktor eigentümlicher Art. Die eingestellten und bezahlten Kräfte bringen zwar einiges mit in die Firma und vor allem zum Einstellungsgespräch: Prüfungs- und andere Zeugnisse, Erfahrungen und Ausbildung, Geschick und guten Willen, einen Beruf und womöglich sogar einen Stolz darauf. Ob und wie das Unternehmen aber von den mitgebrachten Fähigkeiten Gebrauch macht, das liegt gar nicht an dem, was diese lebenden Produktionsfaktoren in eigener Person mitbringen. Sie werden – das ist in einer modernen Marktwirtschaft wie der deutschen längst die Regel – auf einem Arbeitsplatz eingewiesen, angelernt und dann „beschäftigt“, an dem ganz unabhängig von ihnen und getrennt von allen beruflichen Qualifikationen sachlich festgelegt und vorgegeben ist, worin die Arbeit besteht, wie und in welchem Durchschnittstempo sie zu erledigen ist und was dabei herauskommt. Schon längst ist es nicht mehr so, daß das Unternehmen seinen Werktätigen gute Arbeitsmittel bereitstellt und anschließend darauf aufpaßt, daß sie sich in der richtigen Weise reinhängen in ihre Arbeit: Ihre Arbeit in dem Sinn ist es gar nicht, was moderne Arbeitskräfte an ihrem Arbeitsplatz verrichten; daß sie einen Arbeitsplatz bedienen, dessen Ausstattung, organisatorische Einordnung, Ertrag und daraus abgeleiteter Bedienungsbedarf ganz Sache der Firma sind, trifft es viel besser. Von beruflichen Fähigkeiten und moralischen Qualitäten ihrer „Mitarbeiter“ haben fortschrittliche Unternehmen sich unabhängig gemacht; Inhalt und Produktivkraft der Arbeit sind ihre Vorgaben an die eingestellten Kräfte: Potenzen derer, die die Arbeit „geben“. Daraus folgt dann, was an den eingestellten Lohnarbeitern und von ihren mitgebrachten Qualitäten benutzt wird; daraus wiederum ergibt sich, auf welche Fähigkeiten, womöglich sogar intellektueller oder handwerklicher Natur, es bei welcher Gelegenheit doch ankommt. Das grundsätzliche Verhältnis wird dadurch aber nicht revidiert, daß der Beschäftigte an einem modernen Arbeitsplatz dessen Anforderungen zu entsprechen, sich denen gemäß zu machen, nicht sich der bereitgestellten Arbeitsmittel, sondern mit der eigenen Person den vorgegebenen Ablauf zu bedienen, seinen Arbeitsplatz also im Wesentlichen auszuhalten hat. Dieses Verhältnis erlaubt es dem Betrieb außerdem, sich auch über manche physischen und physiologischen Schranken hinwegzusetzen und die verlangte Arbeit in einer Weise zu intensivieren, die mit besonderer individueller Tüchtigkeit gar nichts zu tun hat: die sinnreiche Zerlegung von Arbeitsschritten und „ergonomische“ Zusammensetzung von Handgriffen zu ganzen Berufstätigkeiten verfolgt und erreicht – in Deutschland schon längst – das Ziel, keine Sekunde der im Betrieb verbrachten Arbeitszeit ungenutzt verstreichen zu lassen.
In der guten Meinung der Öffentlichkeit über die Arbeitswelt wird diese Sachlage gerne in Form einer menschenfreundlichen Rechnung vorstellig gemacht. Danach wenden die Arbeitgeber enorme Investitionskosten für die Bereitstellung von Arbeitsplätzen auf, um so dem hohen Ziel der Beschäftigung zu dienen. Als müßte, wenn es um dieses Ziel ginge, soviel Aufwand getrieben werden; als ließe sich ein Unternehmen jeden seiner Arbeitsplätze eine halbe oder ganze Million, oder was für Zahlen da immer in Umlauf gebracht werden, kosten, um anschließend einem „Mitarbeiter“, der einen solchen Platz ausfüllt, 30 oder 40 Tausender im Jahr zuwenden zu können – bis nach zwei oder vier Jahren von neuem alles umgestellt und neu eingerichtet und dabei übrigens ganz nebenher mancher Arbeitsplatz weg„rationalisiert“ wird. Tatsächlich beweisen die großartigen Beträge, die deutsche Unternehmen für ihre spitzenmäßigen Betriebseinrichtungen aufwenden, den umgekehrten Zusammenhang: Soviel lassen sie es sich kosten, die Produktivität der Arbeit, die sie anwenden, von den Potenzen und Qualifikationen, die die Arbeitskräfte mitbringen, zu lösen, sie über jedes dem Individuum verfügbare oder von ihm noch abhängige Maß hinauszutreiben, damit der Ertrag der Arbeit ihren Möglichkeiten und Ansprüchen entspricht und nicht mehr den Fähigkeiten ihrer Dienstkräfte. Wenn man so will, dann stimmt an der Beschäftigungsideologie genau soviel: Moderne Arbeitgeber wenden enorme Summen auf, damit an ihren Arbeitsplätzen wirklich nichts anderes geleistet wird als pure „Beschäftigung“ nach Art und Bedürfnis des Hauses.
Mit dem Lohn kauft sich das Unternehmen also genaugenommen bloße Arbeitskräfte, die beliebig einsetzbar sind für das, was die Arbeitsplätze noch an menschlicher Bedienung brauchen. Als „Produktionsfaktor“ haben Lohnarbeiter allen anderen Produktionsfaktoren nämlich genau diese entscheidende Eigenschaft voraus, in ihrem Gebrauchswert und ihrer Leistungskraft nicht festgelegt zu sein, nicht bedient werden zu müssen, sondern für jede Sorte Gerätebedienung hergenommen werden zu können. Sie sind der unerläßliche „subjektive Faktor“ im Produktionsprozeß, der diesen in Gang setzt und hält, und als solcher zugleich zu dessen Anhängsel herabgesetzt. Was sie liefern, ist Arbeit schlechthin: abstrakte Arbeit, für deren konkreten Inhalt das Unternehmen selber sorgt.
b) Die Bemühungen der Arbeitgeber, ihren Arbeitskräften Arbeitsplätze vorzugeben, die nicht nach deren Vermögen, sondern nach den produktiven Potenzen des großen geldmächtigen Eigentums gestaltet und durchorganisiert sind, folgen einer kalkulatorischen Richtlinie, die jedem Betriebswirt selbstverständlich ist: Bei dem gesamten kostspieligen Aufwand geht es um Kostensenkung. Der Vorschuß steigt, damit der Ausstoß verkäuflicher Produkte noch stärker steigt, so daß jedes einzelne den Unternehmer billiger kommt, als wenn seine Arbeiter mit Handwerkerfleiß, Werkzeug und Geschick ans Fabrizieren gingen; und das allein ist entscheidend.
Mit dieser Stückkostenrechnung setzen sich die Unternehmer auch zu der Arbeit, die in ihrem Betrieb geleistet wird, in ein kalkulierendes Verhältnis: Sie kalkulieren mit den Lohnstückkosten, die dem deutschen Unternehmungsgeist bekanntlich so zu schaffen machen. Lohn ist für die Unternehmer eben auch ein Kostenfaktor, den sie anteilig in jedes Produkt hineinrechnen und der, weil Kost, zu senken ist. Die negative Stellung gegen den Lohn ist damit klar genug, der bloße Kosten(senkungs)standpunkt allerdings hier gar nicht der Witz – sonst wäre noch allemal die Einstellung der Produktion die kostengünstigste Lösung. Entscheidend ist, wieviel Stück die „Kost“, nämlich die bezahlte Arbeit hergibt; darum kümmert sich das Unternehmen in der Gestaltung seiner Betriebsabläufe. Die Lohnstückkostenrechnung ist die Rechnungsweise zu einer Unternehmensstrategie, die darauf zielt, pro Einheit bezahlter Arbeit immer mehr Ertrag herzukriegen. Und das ist eingeordnet in die Gesamtstückkostenkalkulation des Unternehmens und seine entsprechenden Bemühungen, mit größerem Aufwand dafür zu sorgen, daß der Aufwand, aufs einzelne Produkt gerechnet, sinkt. Denn das eröffnet die Konkurrenzchancen, auf die es Betriebswirten ankommt: Zum alten Preis verkauft, wächst ganz direkt der Überschuß, den jede Ware einspielt; mit dem gewohnten Profit verkauft, lassen sich Konkurrenten unterbieten und aus dem Feld schlagen – in Europa, Japan und anderswo; zu Hause wird derweil über „sinkende Erlöse“ gejammert.
Wie gesagt, die Lohnarbeiter sind als Faktor unter diese Rechenart subsumiert. Kein Unternehmer nimmt sie mit seinen Aufwands- und Ertragsrechnungen absichtsvoll anders ins Visier als seine weniger lebendigen Produktionsmittel; es gibt kein Interesse, sie zu drangsalieren oder „auszubeuten“; in Deutschlands Unternehmen jedenfalls werden, wie alle Produktionsanlagen, auch Arbeitsmoral und Betriebsklima gepflegt und so weiter. Nicht moralisch, wohl aber ökonomisch gibt es jedoch immerhin einen wesentlichen Unterschied in der Behandlung der beiden verschiedenen Faktoren der Stückkostenrechnung: Der Aufwand für den einen, der sich in Arbeitsplätzen darstellt, wird gesteigert, um auf der anderen Seite die Zahl der Arbeitskräfte, die bezahlt werden müssen, im Verhältnis zum Gesamtprodukt zu senken. Sicher, es gibt sogar im neuen Deutschland Betriebe, die ihr Spezialgeschäft mit alter, billiger oder längst abgeschriebener Maschinerie betreiben; aber das ist überhaupt nicht die Regel – das ist sogar gelehrten Menschen aufgefallen, die nach längerem heftigem Forschen eine allgemeine „Tendenz“ zu „arbeitssparendem“ statt „kapitalsparendem technischem Fortschritt“ ermittelt haben. Darin liegt ein Hinweis auf die wirkliche ökonomische Zweckmäßigkeit, die von den Unternehmern mit ihren Stückkostenrechnungen ganz systemgemäß befolgt und exekutiert wird:
Wenn nach deren Rechnung Stückkostensenkung ansteht, geht es in Wahrheit um Ertragssteigerung; und das entscheidende Mittel dafür ist nicht dieser oder jener Kostenfaktor, sondern die Produktivität der angewandten Arbeit. Die Methode, um das Ideal der Kostensenkung wahrzumachen und aus dem Vorschuß immer mehr und billigere Produkte herauszuholen, besteht darin, die Arbeitskräfte mit solchen Arbeitsplätzen auszustatten, daß aus jeder Stunde, die der Laden läuft, also aus jeder ihrer Arbeitsstunden ein Ausstoß herauskommt, der mit seinem Verkaufswert pro Stück den gesamten Aufwand pro Stück in immer schönerer Größenordnung in den Schatten stellt. Insofern geht es darum, die Arbeit, die das Unternehmen braucht und kauft, ertragreicher zu machen, und zwar nach einem ganz abstrakten, nämlich rein quantitativen Maß: Weniger Arbeitszeit steckt im einzelnen Produkt; mehr geldwertes Produkt fällt an pro bezahlte Arbeitszeit. Was sich auch so ausdrücken läßt: Mehr Reichtum entsteht, der von Rechts wegen nicht dem Arbeiter gehört, der mit dem Lohn das Seine schon hat, sondern dem Unternehmen – das ja auch das Verkaufsrisiko ganz allein trägt, jedenfalls bis der Risikofall eintritt, denn dann wird die Belegschaft per Entlassung in die Erwerbslosigkeit am Konkurs beteiligt…
Dieses Ergebnis, daß die Steigerung der Produktivität der Arbeit nicht die Arbeiter, sondern die Unternehmer reicher macht, ist wieder so geläufig, daß es dazu längst eine Rechtfertigungsideologie gibt: Wachsende Arbeitserträge ständen – „nicht zuletzt auch“ – dem Unternehmen zu, weil sie eben weniger oder gar nicht dem „Faktor Arbeit“, stattdessen mehr dem „Faktor Kapital“ zugutezuhalten, also auch als ihr jeweiliger Beitrag zum Gesamtergebnis zu vergüten wären. Das ist sehr edel gedacht, die Arbeiter mit ihren Lebensbedürfnissen moralisch immerhin auf eine Stufe mit ihren Arbeitsmitteln und -plätzen zu stellen, als deren Gewerkschaft man sich die Arbeitgeber offenbar vorstellen soll; aber gerecht ist es dennoch nicht. Denn wenn schon die Produktivität der Arbeit getrennt von der Arbeit gewürdigt werden soll, dann muß man schon zugeben, daß sie heutzutage voll und ganz Betriebseigentum ist und nichts weiter übrigbleibt, was der nackten Arbeit als ihr Anteil zuzurechnen wäre – zumal die ja auch, sobald sie stattfindet, gekauft, also Eigentum des Unternehmens ist. Man darf diese großzügige Zurechnungsidee, die eigentlich bloß die reichlich unterschiedlichen Ergebnisse der Lohnarbeit für die Unternehmer und die Arbeiter als gerechte Aufteilung erläutern will, gar nicht beim Wort nehmen, sonst käme auf einmal ein Hinweis auf die Wahrheit heraus: Dem Unternehmen gehört sein gesamter Ertrag, weil es ja mit seinem Eigentum dafür sorgt, daß aus der Arbeit, die ihm außerdem auch gehört, überhaupt etwas Gescheites herauskommt.
Dem steigenden Reichtum des Unternehmens entspricht auf der anderen Seite eine relative Lohn-„Ersparnis“: Als Kost gerechnet und aufs Produkt bezogen, also als Lohnstückkost, sinkt der Preis der Arbeit in dem Maß, in dem ihre Produktivität steigt. Immer weniger Lohnkost ist im Wertprodukt des Unternehmens enthalten; die „Schere“ zwischen geschaffenem Reichtum und Entgelt geht, wie von selbst und ohne daß jemand das geplant und per Stasi hätte durchsetzen müssen, immer weiter auf.
Ein Nebeneffekt ergibt sich auch, der das Prinzip der ganzen Sache noch einmal schön beleuchtet; nämlich dann, wenn der wachsende Output, den jede sachgerecht an einem fortschrittlichen Arbeitsplatz verbrachte Arbeitsstunde bewerkstelligt, an Marktschranken stößt, also die Konkurrenz dem Unternehmenserfolg Grenzen setzt. In so einem Fall antwortet kein Unternehmen mit einer Minderung der Arbeitsproduktivität, was im Sinne des berüchtigten „Gesetzes“ Angebot und Nachfrage durchaus wieder zur Deckung brächte. Im Gegenteil: An der Effektivierung jeder bezahlten Arbeitsminute wird erst recht weiterentwickelt, was der technische Fortschritt hergibt. Die „Marktanpassung“ erfolgt ausschließlich über den anderen „Produktionsfaktor“; an dem wird da einmal wirklich und in größerem Stil gespart. Entlassungen sind – in solchen Fällen, aber auch umgekehrt dann, wenn es darum geht, die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens durchgreifend zu stärken, so daß es andere zur „Marktanpassung“ zwingen kann – ein so selbstverständliches Muß der kalkulatorischen Vernunft, daß sie „Rationalisierungen“ heißen; deswegen ist ihnen auch nicht mit so etwas schon im Namen Widersprüchlichem wie „Rationalisierungsschutzabkommen“ beizukommen, durch die in Deutschland tatsächlich auch nichts anderes geschützt wird als das Mitspracherecht der Gewerkschaft beim Entlassen. Lohneinsparungen im ganz banalen Sinn – der Mensch bekommt weniger – ergeben sich im Zuge „rationeller“ Produktionsumstellungen im Übrigen auch noch in anderer Weise: durch Neueinstufung alter sowie die entsprechende Ersteinstufung neuer Arbeitsplätze in der Hierarchie der Lohngruppen, von der noch die Rede sein wird.
Für die menschenfreundliche Deutung dieses Zusammenhangs zwischen Fortschritt und Lohnsenkung ist in der Bundesrepublik seit langem eine der unverschämteren betriebswirtschaftlichen Ideologien über die Lohnkosten zuständig. Sie stellt die Freiheit des kapitalkräftigen Unternehmertums, seine Lohnaufwendungen erstens ertragreicher zu machen und zweitens zu senken, als Zwang dar, den die hohen Löhne den um Beschäftigung bemühten Arbeitgebern auferlegen würden: Ihre unverantwortbare Höhe brächte die Geschäftswelt unter den Sachzwang, mit Rationalisierungen und Entlassungen gegenzusteuern, um überhaupt noch irgendwelche konkurrenzfähigen Arbeitsplätze zu retten. Diese Verdrehung von Freiheit und Notwendigkeit leuchtet in der Marktwirtschaft allgemein ein; allerdings nicht, weil die Not der Unternehmer mit überhöhten Löhnen jemals ermittelt worden wäre, sondern weil fürs bornierte und als nationalökonomische Sachlage anerkannte Unternehmerinteresse überhaupt jede Lohnzahlung, egal in welcher Höhe, zu hoch ist und keine bezahlte Arbeitsstunde jemals ertragreich genug. Deswegen ist den Fortschrittsstrategien der Unternehmer aber auch so unverkennbar anzusehen, daß sie nie und nimmer die Reaktion auf irgendwelche Rechnungen sind, die der Faktor Lohn ihnen aufmachen würde. Ganz von sich aus betreibt die Geschäftswelt ihren gigantischen Aufwand – und wenn ein Sachzwang herrscht, dann der, daß die geschäftstüchtigen Konkurrenten sich wechselseitig in diesen Aufwand hineintreiben –, um die entlohnte Arbeitszeit ihres Personals nach ihrem Bedürfnis immer effektiver zu gestalten. Deswegen kommt ja auch bei allem technischen Fortschritt nie heraus, daß den Lohnarbeitern im Verhältnis zum gesteigerten Ertrag gerechterweise mehr Lohn gezahlt würde.
c) Und erst recht nicht, daß das Unternehmen im Verhältnis zum verminderten Zeitaufwand die Arbeitszeit seiner Mitarbeiter verkürzt. Ganz im Gegenteil: Je mehr die Unternehmen aus der Arbeitszeit ihrer Beschäftigten herausholen, um so mehr Arbeitszeit suchen sie aus ihren Beschäftigten herauszuholen.
Aus Sicht der Unternehmer ist das schon wieder ein Sachzwang. Der Aufwand für Maschinerie und Anlagen, mit dem sie die menschliche Arbeit auf die abstrakte subjektive Zutat des Bedienens reduzieren, ist für sie nämlich mehr als bloß ein Mittel, das sie in ihrem Interesse wirken lassen. Daß der Einsatz ihres Eigentums Erträge erbringt, betrachten sie keineswegs als ihr persönliches Spekulationsrisiko, sondern als ihr gutes Recht, das sie sich mit der Festlegung von Kapital erwerben – tatsächlich gibt es ja auch eine ganze Abteilung marktwirtschaftlicher Geschäftsverhältnisse, in denen die Vermehrung angelegter Gelder den Charakter eines gesetzlich geschützten Anrechts hat, nämlich als Rechtsanspruch auf Zinsen eingerichtet ist. Im gängigen Zinssatz haben hart kalkulierende Unternehmer daher gleich auch den Maßstab vor Augen, an dem sie ihr vorgestelltes Recht auf Gewinn quantitativ bemessen: Soviel muß allermindestens herauskommen. Es muß wirklich, soweit sie ihre Investitionen auf Pump finanziert haben; und wenn nicht, dann können sie sich ganz leicht sich selbst als ihre eigenen Geldgeber vorstellen, die an sich selber Zinsansprüche haben. Wie auch immer: Festgelegtes Kapital, das brachliegt, statt produktiv genutzt und verschlissen zu werden, ist für die betriebswirtschaftliche Kalkulation schon so gut wie ein Minusgeschäft, weil umgekehrt jedes Stück Zeit, in dem gearbeitet wird, so gut wie bares Geld.
Und das ist auf alle Fälle Grund genug für den Großangriff auf alle traditionellen Arbeitszeitgebräuche, den Deutschlands Unternehmer seit längerem führen und den die deutschen Gewerkschaften über einige Tarifrunden hinweg mit einem sehr entgegenkommenden Tauschangebot „gekontert“ haben: rechnerische Verkürzung der individuellen Arbeitszeit gegen Flexibilisierung der individuellen und Ausdehnung der Gesamt-Arbeitszeit nach Bedarf der Firma, nötigenfalls rund um die Uhr und über alle Wochenenden hinweg. Seit dem epochalen Durchbruch bei der Wochenarbeitszeit, auf den vor allem die IG Metall sehr stolz ist, wird in Deutschlands Betrieben nicht bloß ein wenig schneller und ohne gewohnte Unterbrechungen durch Päuschen und freie Minuten, sondern außerdem nach Schichtplänen gearbeitet, mit denen sich die Unternehmer von allen Einschränkungen der täglichen und wöchentlichen Produktionszeit freimachen.
Dieser Fanatismus des Dauerbetriebs hat etwas von einer Klarstellung an sich. Er stellt jedenfalls ganz praktisch die erwähnte Theorie richtig, wonach der hierzulande übliche „technische Fortschritt“ ein „arbeitssparender“ sein soll: Bei jedem gegebenen „Stand der Technik“, auf Grundlage jedes Fortschritts in dem immerwährenden Bemühen, die pro Stück Betriebsergebnis nötige Arbeitszeit zu reduzieren, wollen Unternehmer von der Arbeit soviel wie möglich. Nach 40 Jahren bundesdeutschem Fortschritt zeugen lauter Kunstgriffe in Sachen Arbeitszeit und Betriebslaufzeiten davon, daß der Nutzen der abstrakten Arbeit, die da auf immer höherem Produktivitätsniveau eingesetzt wird, wie eh und je in ihrer puren Dauer liegt. Arbeitszeit wird in der Produktion gespart, um davon dann erst recht nie genug kriegen zu können; das ist die eigentümliche Dialektik des „arbeitssparenden Fortschritts“. Denn mit ihrer Dauer schafft die Arbeit den ökonomischen Stoff – das Geld –, der als das ureigene Produkt dieser Wirtschaftsweise zu bezeichnen ist.
Nebenbei gibt das heftige Begehren nach allzeitiger Verfügung über Arbeitskraft eine kleine Richtigstellung her zum Lob der „kapitalintensiven Arbeitsplätze“, die gleichsam von sich aus Technik und Wissenschaft in Ware verwandeln würden, und zu dem marktwirtschaftlichen Wahn, es wäre gewissermaßen eine Eigenschaft des investierten Kapitals selber, „sich“ zu verwerten. All die wunderbaren „kapitalintensiven Arbeitsplätze“, die ein modernes Unternehmen hinstellt, sind für sich genommen ein reichlich unflexibler, ja nichtsnutziger „Produktionsfaktor“: Sie bewirken überhaupt nichts, wenn sie nicht „ausgefüllt“ und bedient werden; insoweit sind und bleiben sie doch bloße tote Instrumente, mit denen das Unternehmen seine Arbeitskräfte ausstattet und arbeiten läßt. Nicht nur ihr Gebrauchswert bleibt ungenutzt; auch ihr ganzer Wert, das für sie ausgegebene Geld, bleibt liegen und verkommt, wenn keine menschliche Arbeit sie in Gang setzt und hält. Das Umgekehrte wird allgemein für gültig erachtet: daß Lohnarbeiter aufgeschmissen sind ohne Arbeitsplatz; das ist ja auch das gesellschaftlich gültige, rechtmäßige Erpressungsverhältnis zwischen Eigentum und bloßer Arbeitskraft. Weniger anerkannt, schon gar nicht als gültiger Standpunkt, ist die ökonomische Tatsache, daß alles Kapital nichts taugt ohne Arbeit; daß der ganze Aufbau an modernen Produktionsanlagen sich erst lohnt, wenn Lohnarbeiter damit das Betriebsergebnis hinstellen: ein geldwertes Produkt. Erst darin verfügt das Unternehmen wieder über den Wert, den es in seine Produktionsanlagen und -mittel hineingesteckt hat und gemäß deren veranschlagter Benutzungszeit „abschreibt“, d.h. als Kostenbestandteil im produzierten Warenwert verrechnet; und eben nicht nur über den: Jede Arbeitsstunde verschafft dem Unternehmen ein Betriebsergebnis, dessen Geldwert den pro Stunde gerechneten Gesamtaufwand übersteigt. Die Arbeitskräfte kosten die Firma nichts, wenn sie nicht arbeiten, noch nicht einmal einen rechnerischen Zins wie die brachliegenden Produktionsmittel; nur lohnt sich dann eben auch nichts, am allerwenigsten das in die Betriebsanlagen investierte Kapital, das sich von allein noch nicht einmal zu amortisieren vermag. Umgekehrt läßt der Einsatz des „subjektiven Faktors“ den Investitionsaufwand im Produktwert wiederkehren und, was schließlich Zweck der ganzen Veranstaltung ist, neuen Warenwert entstehen. Deswegen kann die Unternehmenswelt davon nie genug bekommen.
Das ist die ökonomische Wahrheit in jener Rechnung mit negativer Verzinsung bzw. den Vorteilen einer beschleunigten Abschreibung, die dazu geführt hat, daß das freie deutsche Unternehmertum ab Mitte der 80er Jahre die vielen Unterbrechungen der Lohnarbeit – am Tag, in der Woche, im Jahr – einfach nicht mehr ausgehalten hat. Der Verzicht auf eine einzige Arbeitsstunde am Tag und womöglich einen ganzen Tag pro Woche wurde den Arbeitgebern zunehmend unerträglich – eben aufgrund des unglaublich günstigen Verhältnisses zwischen dem bißchen Lohnaufwand für eine Arbeitsstunde und deren Ertrag, das sie mit ihrem Kapitalaufwand und technischen Fortschritt hergestellt haben. Da verzichten sie lieber beim einzelnen Lohnempfänger auf anderthalb bis vier Stunden pro Woche – und halten sich dafür mit der Beschleunigung des Arbeitstempos schadlos … –, wenn bloß im Gegenzug nicht mehr so viel Lohnarbeitsruhe eintritt wie bisher und der Firma kostbare Arbeitsstunden verlorengehen.
Insofern stimmt am Ende übrigens doch die ideologische Rechnung, wonach der gesamte unternehmerische Investitionsaufwand der Schaffung von Arbeitsplätzen – rentablen, versteht sich – gilt. Es geht den Unternehmern tatsächlich darum, Arbeit verrichten zu lassen. Denn das unterscheidet eben den Arbeitslohn von den Kosten der auszufüllenden Arbeitsplätze und den „Produktionsfaktor Arbeit“ vom „Produktionsfaktor Kapital“: Die installierten Anlagen haben ihren Preis; das dafür ausgegebene Geld wird dem Unternehmen, wenn und solange gearbeitet wird, durch die Arbeit im Produkt wieder verfügbar gemacht, als verkäuflicher Warenwert. Der Aufwand für Lohnarbeiter hingegen setzt einen Produktionsprozeß in Gang, dessen geldwertes Ergebnis durch den Lohnaufwand in gar keiner Weise bestimmt ist, ihn vielmehr – dank der unternehmerischen Anstrengungen, die Leute an optimal ausgestatteten Arbeitsplätzen (oder überhaupt nicht) zu beschäftigen – außerhalb jeder festen Proportion überschreitet und gewissermaßen ganz nebenher mit abwirft, was ein Lohnarbeiter so kostet in Deutschland.
5. Der Lohn: Mittel der Kapitalproduktivität
a) Was die Unternehmer da praktizieren, das dementiert in aller Freiheit die marktwirtschaftliche Entlohnungsideologie vom unauflöslichen funktionellen Zusammenhang zwischen Lohn und Betriebsergebnis. Danach wird Lohn grundsätzlich in Entsprechung zur Produktivität der geleisteten Arbeit gezahlt; er vergütet, gerecht und genau, den Beitrag, den der Lohnarbeiter an seinem Arbeitsplatz zum Betriebsergebnis beisteuert.
Dieser Sachzusammenhang soll erstens grundsätzlich und im allgemeinen gelten; zum Beispiel also so, daß die Unternehmer sich eine höhere Lohnsumme dann leisten könnten, wenn, und eine um soviel höhere Lohnsumme, wie die Arbeit ertragreicher geworden ist. Eine Rechnung nicht ohne Komik: In dem Maße, wie es den Unternehmern gelingt, aus den bezahlten Arbeitsstunden mehr herauszuholen, also ihren Lohnaufwand zu senken, sollen die Löhne steigen können – aber auf diese paradoxe Art begründen die deutschen Gewerkschaften traditionell einen Teil derjenigen Tarifanpassungsforderungen, die sie sich im Laufe ihrer Tarifrunden abhandeln lassen; und auch außerhalb der gewerkschaftseigenen Lohntheorie ist diese Rechnungsweise beliebt, weil sie mit der Autorität eines unauflöslichen funktionellen Sachzwangs jeder Veränderung des einmal eingebürgerten Lohnniveaus eine Absage erteilt.
Darüberhinaus sollen aber auch die vielfältigen Lohnunterschiede, die das gute deutsche Lohnniveau kennt, von dem Tausender für die Putzfrau bis zu den vier Tausendern für den Industriemeister – und irgendwie sogar die hundert Tausender für den Banker –, bis zur letzten Mark durch die jeweiligen, nicht bloß sachlich unterschiedlichen, sondern angeblich eben auch unterschiedlich ertragreichen Arbeitsleistungen der Beschäftigten in den verschiedenen Lohn- und Gehaltsgruppen begründet sein. Und im Namen desselben Grundsatzes müssen sich bis auf weiteres die ehemaligen Werktätigen der ehemaligen DDR insgesamt vorrechnen lassen, daß ihre zurückgebliebene Produktivität keine andere Entlohnung zuläßt als in Höhe von 50 Prozent oder zwei Dritteln der Westlöhne.
Das alles ist reichlich absurd angesichts der unternehmerischen Anstrengungen – gerade in Deutschland –, die Arbeitsplätze so auszugestalten, daß ihre Produktivität sich vom Arbeitsvermögen und der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten gründlich emanzipiert. Tatsächlich denkt sowieso niemand daran, das Potential, das moderne Firmen mit ihren modernen Betriebsanlagen vorgeben, doch wieder der dort verrichteten Arbeit als deren Potenz zuzurechnen, geschweige denn den Lohnarbeitern den Ertrag zu überlassen, den sie schaffen; da gilt dann wieder, daß der „Produktionsfaktor Kapital“ schließlich auch gerecht „entlohnt“ werden muß. Wenn der behauptete Zusammenhang zwischen Lohn und Arbeitsproduktivität angeführt wird, dann allemal nur, um Forderungen zurückzuweisen oder, wie im Fall der Ostzone, eine pauschale Lohnminderung zu rechtfertigen. Für dieses Beweisziel darf auf die altertümliche Maschinerie der Unternehmen gedeutet werden, für die geringere Löhne das einzig Tragbare sein sollen; und niemand kommt auf die Idee, die Firmen für ihre zurückgebliebene technische Ausstattung haftbar zu machen und darauf zu bestehen, daß der „Produktionsfaktor Arbeit“ das Seine leistet. Wenn umgekehrt westdeutsche Investoren im Osten dieselben Anlagen hinstellen, die sie im Westen betreiben, dann zieht das noch lange keine Angleichung an die Westlöhne nach sich; dasselbe gilt seit jeher bei Investitionen in die weltweit beliebten „Billiglohnländer“. Erst recht rechnet niemand nach, wieviel vom Unternehmensertrag den verschiedenen Arbeitsplätzen des Unternehmens und somit den dort Beschäftigten als ihr individueller Beitrag zuzuschreiben wäre, um danach die jeweils zu zahlenden Löhne zu bemessen. Abgesehen davon, daß in einer modernen Fabrik – zumindest unterhalb eines gewissen Gehaltsniveaus – sowieso nur Arbeitskräfte beschäftigt sind, die die letzte Rationalisierungswelle übriggelassen hat, also niemand, dessen Arbeitsplatz für das Betriebsresultat entbehrlich wäre, gibt es für eine solche Zurechnung in einem arbeitsteiligen Unternehmen weder eine theoretische Handhabe noch einen praktischen Auftrag. Um so mehr wird allerdings so getan als ob – und immer mit demselben eindeutigen Ergebnis: Je mehr es an einem Arbeitsplatz bloß noch aufs Aushalten der verlangten „Beschäftigung“ ankommt, je eindeutiger also die Arbeit den Charakter des bloßen Hilfsdienstes annimmt, auf den der kapitalistische Fortschritt die Lohnarbeit ohnehin zu reduzieren sucht, desto mehr Gesichtspunkte lassen sich finden, unter denen irgendwelche mitgebrachten Fähigkeiten gar nicht benötigt, physische und andere Kräfte gar nicht beansprucht werden; und darüber soll dem gesunden Menschenverstand und seinem Gerechtigkeitswahn einleuchten, daß da nicht weiter viel verlangt, also wohl auch nicht viel beigetragen wird, folglich ein geringer Lohn gerade richtig ist. Auch da darf man gar nicht überprüfen wollen, ob nicht – wenn es schon darum gehen soll – eine einseitige Arbeit viel härter ist als manche andere, für die es hierzulande mehr Geld gibt. Tatsache ist, daß unter maßgeblicher Beteiligung der deutschen Gewerkschaften und ihres feinfühligen Gerechtigkeitsempfindens für jeden nationalen Geschäftszweig eine genaue Lohnhierarchie ausgearbeitet worden ist, die mit Kilopond pro Meter, Verrenkung pro Stunde, Nervenverschleiß pro Schicht usw. operiert und das eine entscheidende Ergebnis hat, daß auch noch ganz unten in der Welt der Berufe die schlechtere Arbeit nicht etwa durch einen besseren Lohn entschädigt, sondern außerdem noch schlechter entgolten wird – wo bliebe sonst die Hierarchie. So sind in Deutschland Lohnarbeiter ganz regulär auch weit unterhalb des offiziellen Durchschnittslohns zu haben; ihr Arbeitsplatz muß nur entsprechend definiert sein – was sich im Zuge von Rationalisierungen allemal machen läßt. Auf diese Weise steuert das Ideal der leistungsgerechten Entlohnung lauter moralisch hochwertige Gesichtspunkte zur Festlegung, nämlich Absenkung der Summe bei, mit der Lohnarbeiter im „Hochlohnland“ Deutschland zu entgelten sind, also zum Wert einer ordentlichen Arbeitskraft.
b) Wenn dann, auch unter Zuhilfenahme der Ideologie der Arbeitsproduktivität, die Löhne und Lohnstufen festgelegt sind, dann wird mit denen betriebswirtschaftlich kalkuliert. Es wird auf der ganzen marktwirtschaftlichen Welt nie eine Rechnung angestellt, die zu den Löhnen in ihrer angeblich sachlich bedingten Höhe hinführt; alle Rechnungen gehen von den festgelegten Löhnen aus. Denn ein Unternehmen interessiert sich nie einfach dafür, was an einem Arbeitsplatz gefertigt wird und wieviel die darauf gesetzte Arbeitskraft zu leisten hat. Wenn es den „subjektiven Faktor“ durchkalkuliert, dann verbucht es diesen mit der – jeweils besonderen – Geldsumme, die für die Besetzung eines Arbeitsplatzes zu zahlen ist. Die „Arbeitsproduktivität“ interessiert als der betriebliche Nutzen eben dieser Geldsumme. Sie wird in allen tatsächlich angestellten Produktivitätsberechnungen dem Betriebsergebnis, dem gleichfalls in Geld gemessenen Erlös, gegenübergestellt – mit dem sehr logischen Ergebnis, welches freilich der Lohnideologie exakt widerspricht, daß nicht die produktivsten Arbeitsplätze die bestdotierten, sondern die billigsten Arbeitskräfte die produktivsten sind: Bei ihnen stellt sich das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag, eben dank ihrer Billigkeit, am günstigsten dar.
Aus dieser Rechnungsart geht hervor, wie selbstverständlich das Unternehmen die Lohnarbeit als sein Mittel nimmt: Es setzt die gekaufte Arbeit ganz umstandslos gleich mit den Kaufpreis, den es dafür aufwendet, also mit seinem Geld, das es als Lohn wegzahlt. Die andere Partei, die Arbeitskraft, die mit ihrer Arbeit zu allem, was die Firma bereitstellt, hinzukommen muß, um etwas daraus zu machen, taucht in den maßgeblichen Kalkulationen bloß als Teil des Firmenvermögens auf: als das Geld, mit dem die Firma Arbeitskräfte zu kaufen und zu kommandieren vermag. Die Produktivität, hinter der jedes konkurrenztüchtige Unternehmen so erbittert her ist, rechnet es konsequent als seine, als Effektivität der ihm zu Gebote stehenden „Produktionsfaktoren“, nämlich als Verhältnis zwischen deren Preis und dem durch sie geschaffenen Wert. In seinen praktischen Bemühungen, den Nutzeffekt der gekauften Arbeit zu steigern, weiß das Unternehmen zwar wohl zu unterscheiden zwischen seinen verschiedenen, sachlich inkommensurablen „Produktionsfaktoren“. In seiner Kalkulation hat es sie aber längst kommensurabel gemacht, nämlich als „Faktoren“, die ihren Preis haben, und mißt im Verhältnis zwischen Auslagen und Erlös die Produktivität seines Geldes.
In diese Rechnung passen dann übrigens durchaus auch schon mal Betriebe hinein, in denen nach vergleichsweise ineffektiven Methoden gearbeitet wird, also gemessen an der Zahl der nötigen Arbeitskräfte deren Produktivität zu wünschen übrig läßt: Wenn die Maschinen, weil abgeschrieben, nicht mehr zu Buche schlagen oder wenn die nötigen Arbeitskräfte entsprechend billiger sind, dann stimmt die Produktivität, auf die es ankommt, in solchen Anlagen eben doch – die Sache lohnt sich. Ausgerechnet solchen Effekten entnimmt der marktwirtschaftliche Sachverstand die schönste Bestätigung seiner Lohn-„Ableitung“ aus der Arbeitsproduktivität: Man sähe doch an den niedrigen Löhnen, daß in rückständigen Anlagen mehr nicht gezahlt werden könne. Im Endergebnis wird das schon auch so sein – aber eben nicht deswegen, weil die Arbeit mehr nicht geschaffen hätte als den Gegenwert ihres geringen Entgelts, sondern weil das Diktat der produktiven Geldvermehrung gilt und folglich ein weniger rasant zustandegebrachtes Betriebsergebnis rentabilitätsmäßig in Ordnung geht, wenn die Auslagen und darunter möglichst natürlich auch die Löhne hinreichend niedrig liegen.
6. Der Lohn: Mittel für abstrakten Reichtum und nützliche Armut
Kein Zweifel, die Lohnarbeit ist das Lebensmittel für Lohnarbeiter; das einzige, das sie haben. Der Gebrauch dieses Mittels hat für sie allerdings einen Haken. Wirkliches Mittel zum Zweck ist die Lohnarbeit vor allem andern für den, der sie zahlt und damit zu seinem Eigentum macht, mitsamt ihren Erträgen. Aus den Zwecken der Lohnarbeiter wird dann nicht mehr viel.
Die gegensätzlichen Folgen dieses Verhältnisses sind in Deutschland ausgiebig zu besichtigen.
a) Ein ganzer Menschenschlag ist in Deutschlands Marktwirtschaft von den Unternehmern für die Mehrung ihres Eigentums mit Beschlag belegt. Sie sind Mittel für einen Reichtum, auf dessen Gebrauchswert es genausowenig ankommt wie auf die – als „Neben-“ definierten – schädlichen Effekte seiner Produktion: Wert unter Abstraktion von jedem Gebrauchswert zu sein, abstrakter Reichtum, der im Geld seine adäquate Daseinsform besitzt, ist das Wesentliche daran. Deswegen hat die Mehrung dieses Reichtums auch kein irgendwie bestimmtes Ziel – außer dem, im Ergebnis die vergrößerte Basis für seine erweiterte Vermehrung zu schaffen. So mehrt die Lohnarbeit die in privaten Händen liegende Macht des Geldes, Arbeit zu kaufen, zu kommandieren und erneut mehr ökonomische Macht aus ihr herauszuholen.
In Deutschland stellt sich dieser Ertrag der Lohnarbeit unter anderem als gnadenlos modernisierte Industrielandschaft dar; mit Industriebrachen und -ruinen daneben, nicht nur im Osten. Denn mit dem Reichtum, den deutsche Arbeitgeber aus ihren Lohnarbeitern herauswirtschaften, bestimmen sie weitgehend das Weltniveau in der industriellen Konkurrenz und lassen den erreichten Stand regelmäßig innerhalb weniger Jahre wieder veralten. So weltrekordverdächtig produziert wird neben vielem anderen ein Warenangebot für jedermann, das in Deutschlands berühmten vollen Schaufenstern ausgestellt wird. Es handelt sich um Gebrauchsgüter, die sich zugunsten ihrer maßgeblichen Zweckbestimmung, Geld einzubringen, vom naiven Zweck der Bedürfnisbefriedigung bemerkenswert radikal emanzipiert haben. Das Geschäft mit den Produkten der Lohnarbeit kann seinen Erfolg nämlich nicht von irgendwelchen Launen seiner Kundschaft abhängig machen – es definiert die Bedürfnisse, gerade die massenhaften privaten, nach Inhalt und Qualität durch ein Angebot, das darauf berechnet ist, die Konkurrenz um die gegebene Zahlungsfähigkeit des Publikums zu gewinnen. Zu diesem Zweck werden alle elementaren Bedürfnisse gewissermaßen neu erfunden; in Formen, die es vorher nie gab, zum Beispiel als Bedürfnis nach Billigfraß oder Kleinwohnungen; derselbe Geschäftssinn läßt auf der anderen Seite Artikel für den gesellschaftlichen Bedarf an Privatflugzeugen oder High-tech-Küchen erfinden, den es dann auch prompt gibt. In ihren besseren wie schlechteren Abteilungen ist diese Warenwelt eine zweite anschauliche Daseinsform des Reichtums, den die Lohnarbeit in Deutschland hergibt. Eine dritte ist weniger anschaulicher Natur, weil da der abstrakte Reichtum gewissermaßen ganz er selbst ist: Es sind die Vermögenstitel, Schuldscheine, Aktien, allenfalls auch mal Geldkoffer, die das Eigentum völlig getrennt von jedem materiellen Inhalt, pur als Eigentum, zirkulieren lassen und ihm dadurch nach ganz eigenen Gesetzen wachsenden Zugriff auf die immer neu geschaffenen Erträge der Lohnarbeit verschaffen. Zu bewundern ist dieser Reichtum in dem Luxus, in dem er sich andeutungsweise zur Schau stellt; etwa wenn die Bild-Zeitung stellvertretend für ihr Publikum einen echten Milliardär besucht; oder im Design von Bankpalästen; oder auch in der bekanntlich völlig zweckfreien Sphäre der Kunst, die sich immer mehr dem Zweck verschrieben hat, teuer zu sein und diese Eigenschaft zu repräsentieren und so den abstrakten Reichtum der Gesellschaft widerzuspiegeln, egal ob sie sonst noch etwas widerspiegelt.
Für den Reichtum, den die deutsche Lohnarbeit getrennt von sich als das wachsende Eigentum anderer zustandebringt, ist im Übrigen Deutschland längst viel zu klein geworden, schon bevor es um die neue Ostzone gewachsen ist. Er hat sich deswegen über die Grenzen bemüht und existiert nun zum Beispiel auch in Form von Milliardenschulden auswärtiger Nationalbanken; oder in Form von Fabriken, die die Geschäftswelt aus Deutschland zur Bedienung durch fremdländische Lohnarbeiter in alle Welt plaziert hat; oder auch in Form ausgedehnter Handelsbeziehungen, die ganz nebenbei noch die letzte tropische Frucht auf ihren Marktwert in Deutschland hin testen. Zu den Nebenwirkungen dieses Reichtums zählt die bekannte Scheidung zwischen „armen“ und „reichen Ländern“ auf der Welt, wobei meistens an den Grad der offensichtlichen Unterversorgung der Bevölkerungsmassen in bestimmten Weltgegenden gedacht ist. Moralische Betrachtungen zur angerichteten Lage deuten dieses Ergebnis gerne so, „die Deutschen“, „wir alle“, profitierten auf „unserer“ „Wohlstandsinsel“ vom Reichtum, den die sogenannte 3. Welt abliefern muß. Die wirklichen Subjekte des Reichtums geraten dabei ein wenig aus dem Blick und damit auch das wirkliche Verhältnis, in dem die in Deutschland verrichtete Lohnarbeit zum Elend anderswo steht. An den geschäftlichen Großtaten ihrer Arbeitgeber sind die Lohnarbeiter nämlich schon ursächlich beteiligt – in der Weise, daß sie mit ihrer Arbeit deren Geldquelle sind und mit ihrem Lohn auch noch manche von deren Geschäftsartikeln versilbern, also in doppelter Weise als Objekte. Nur weil der Reichtum, den sie zustandebringen, getrennt von ihnen in Unternehmerhand existiert, kommt es zu dem ausgiebigen Geschäftsverkehr mit fernen Ländern, der dort alles ruiniert, was sich nicht zum lohnenden Geschäftsartikel machen läßt – und sei es als Billigangebot für deutsche Endverbraucher. Daß sie dem Eigentum anderer dienen müssen, ist schon die ganze „Verantwortung“, die die Arbeitsplatzbesitzer und Lohnempfänger deutscher Nation für alles tragen, was die deutsche Geschäftswelt mit dem Rest des Globus so anstellt.
b) Der Reichtum, den Deutschlands tüchtige Unternehmer aus der wertschaffenden Lohnarbeit herausholen, sammelt sich – außer bei ihnen – in der Hand des Staates, der dem produktiven Eigentum seine Rechtsgrundlage verschafft und alle politischen und sachlichen Erfolgsbedingungen bereitstellt und sich dafür am abstrakten Reichtum bedient, der insgesamt in der Nation zustandekommt.
Daß die Staatsgewalt mit ihren umfangreichen „öffentlichen Diensten“ keine Erträge schafft, sondern vom geschaffenen Überschuß und an ihm zehrt, ist allgemein bekannt und Gegenstand dauernder Klagen ausgerechnet der Leute, die „die Wirtschaft“ heißen und das nur deswegen zu Recht, weil die Staatsgewalt ihrem Eigentum das Kommando über die Arbeit der Gesellschaft sichert – die können sich gut vorstellen, wieviel Geld sie mit dem Geld verdienen könnten, das ihr Staat braucht, um das ganze System des Geldes und des freien Unternehmertums in Kraft zu setzen und in Gang zu halten. Eben deswegen gehört es andererseits gar nicht zum anerkannten öffentlichen Kenntnisstand, daß die Staatsgewalt in all ihrer Pracht von der produktiven Lohnarbeit lebt. Es ist im Gegenteil sogar so, daß nicht zuletzt die Menge des vom Staat beschäftigten Personals die Interpreten der Marktwirtschaft zu einem interessanten Dementi angestachelt hat: Das grundlegende ökonomische Verhältnis in der Marktwirtschaft könnte die Lohnarbeit schon allein deswegen nicht sein, weil die industriellen Lohnarbeiter schon längst nicht mehr die Mehrheit der abhängig Beschäftigten stellten; der größere Teil des Volkseinkommens werde für Dienstleistungen aller Art gezahlt, durch sie also auch nach allen Regeln der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der größte Anteil des Bruttosozialprodukts geschaffen; damit sei der Übergang von der Klassen- zur „Dienstleistungsgesellschaft“ vollbracht. Zugunsten dieser Botschaft zählt die Überlegung gar nichts mehr, aus welchem Reichtum denn die dienstleistenden Beamten- und Angestelltenheere ihre Gehälter ausgezahlt bekommen, die dann als ihr Beitrag zum Bruttosozialprodukt verbucht werden, und wer denn „letztlich“ für die enorme „Staatsquote am Volkseinkommen“ aufkommen muß – da verwirrt sich die öffentliche Meinung zielstrebig in dem lustigen Befund, daß die Staatsdiener per Steuern eigentlich zum großen Teil selbst ihre Einkommen bezahlen… Es ist, als wäre es den Freunden und Förderern der Marktwirtschaft am Ende doch peinlich, wenn sie einräumen müßten, daß die geschäftlich genutzte Lohnarbeit – neben dem, daß sie das freie Unternehmertum bedient – auch die Quelle des gesamten Geldreichtums ist, aus dem vermittels gesetzlicher Regelungen Unmengen von Politikern und Beamten, Ärzten und Lehrern, Soldaten und Forschern erhalten werden, eine ganze Hierarchie besserer und vor allem besser bezahlter Berufe; und außerdem der sachliche Staatsreichtum in Gestalt von Straßen und Ministerien, Universitäten und Kampfflugzeugen, Atommüll-Lagern und Museen; so daß am Ende vielleicht zehn bis zwanzig hauptberufliche Kostgänger des nationalen Mehrwerts und ein Staatspalast pro Jahr auf das Konto jedes mehrwertproduzierenden Lohnarbeiters gingen, wenn ein solches Konto je geführt würde. Was aber nicht der Fall ist; denn auch für den verstaatlichten Teil des abstrakten Reichtums gilt, daß er die Lohnarbeiter nichts angeht, außer daß sie für seine Herstellung das unselbständige Mittel waren. Nur: Was da in Deutschland regiert und die bessere Gesellschaft bildet und womit die öffentliche Ordnung in Schwung gehalten wird, das wird in der Marktwirtschaft nun einmal aus dem Mehrwert bezahlt, von welcher Stelle auch immer der Staat sich den holt, ist also eine Errungenschaft der Lohnarbeit – oder genauer: auf ihre Kosten.
Das gilt auch, um daran noch zu erinnern, für den gesamten Nachdruck, mit dem der deutsche Staat nach außen auftritt. Es ist wirklich nicht Genschers exzellentes Verhandlungsgeschick oder weltweite Beliebtheit, womit diese Nation dem Rest der Welt seit Jahren soviel Eindruck macht, daß ihr sogar die Eingliederung der DDR problemlos zugestanden wurde. Grundlage eines so erfolgreichen Verhandlungsgeschicks sind Mittel, mit denen Staaten sich überzeugen lassen, so daß gar nicht viel schiefgehen kann. Mittel ganz unterschiedlicher Art und Wirkungsweise – von einer gewichtigen Nato-Mitgliedschaft bis zu weltmeisterlichen Exportgeschäften,von einer weltweiten Gläubigerposition bis zu Waffengeschäften –, die allesamt auf dem Reichtum beruhen, über den die Regierung gebieten kann. Vor der Schlagkraft dieser Mittel ist ein ganzes Weltsystem in die Knie gegangen und hat einen Offenbarungseid geleistet, der durchaus geeignet ist, auch das System der Lohnarbeit ins rechte Licht zu rücken: Mit ihren Versuchen, von Staats wegen, „planmäßig“, aus ihrem geschätzten Proletariat einen massenfreundlichen Staatsreichtum herauszuregieren und herauszuwirtschaften, haben die realsozialistischen Parteien im Osten nicht entfernt die produktive Trennung zwischen Mehrwertproduzenten und abstraktem Reichtum hingekriegt, deren Erträge in der Staatenkonkurrenz von heute das entscheidende Erfolgskriterium sind. Wären sie nicht bloß Mittel zum Zweck, dann müßten Deutschlands Lohnarbeiter also sogar noch fürs deutsche Herumfuhrwerken in der Weltgeschichte die Verantwortung übernehmen. Allerdings: Wären sie wirklich etwas anderes als das Eigentum ihrer Arbeitgeber, dann wäre es schlecht bestellt um die Freiheit eines Kanzlers, die ganze Nation auf den Weg zur neuen Weltmacht zu kommandieren.
c) Die Erfolgsstory von Geschäft und Gewalt in Deutschland hat ein paar Nebenwirkungen. Von einer Gattung von Nebeneffekten ist viel die Rede, und in der Regel sehr verkehrt: „Umweltzerstörung“ ist das Stichwort. In der Sache geht es um einen Teilaspekt der Rücksichtslosigkeit, die zur Produktion des abstrakten Reichtums gehört: Natürliche Gegebenheiten werden marktwirtschaftlich verbraucht – aufgebraucht, vergiftet, ruiniert oder was auch immer –, ohne in Rechnung zu stellen, daß sie nebenher als Lebensbedingung der Spezies Mensch und vielleicht sogar als Genußmittel für manche Gemüter vonnöten sind, weil das die maßgebliche, nämlich die Überschuß-Rechnung beeinträchtigen würde. Auch die Natur ist eben prinzipiell als Mittel des produktiven Eigentums definiert; ihr entsprechend zweckmäßiger Gebrauch stiftet einen gar nicht naturwüchsigen Mangel auf Seiten derer, die kein Eigentum haben, also auch nicht durch Naturverbrauch reicher werden. Es handelt sich also um einen Beitrag zum Thema: produktives Eigentum und funktionelle Armut. Daß das „Problem“ so gestellt ist – unabhängig davon, wie die Öffentlichkeit es sich stellt –, zeigt sich daran, wie der Staat hier interveniert: Er registriert nach seinen Gesetzen schädliche Auswirkungen des Naturverbrauchs der einen auf das Eigentum anderer, auch auf Kosten, die bei ihm anfallen, und zieht daher Grenzen, die die Produktivität des Eigentums auf keinen Fall „über Gebühr“ belasten dürfen.
Der demokratische Umweltgedanke hat von diesem schlichten Sachverhalt nicht mehr viel übriggelassen. Er geht nämlich – darin ist er eben ein demokratischer Irrtum – von der Vorstellung aus, der abstrakte Reichtum und seine Mehrung wäre so etwas wie ein Gemeinschaftswerk der Gesellschaft, diente – zumindest letztlich – allen ihren Mitgliedern gleichermaßen; folglich wären auch alle gleichermaßen für die schädlichen Effekte der Marktwirtschaft verantwortlich und haftbar zu machen. Der Umweltgedanke ist so zum Umweltgewissen geworden, das in Gestalt einer penetranten Massenmoral unterschiedslos den Raucher wie den Chemiekonzern belästigt – mit dem Unterschied, daß es sich in dem einen Fall mit ein paar Filtern abspeisen läßt und in dem andern nicht. Mittlerweile verarbeitet eine ganze Umweltphilosophie die Entdeckung, daß die Produktion von Mehrwert längst den ganzen Globus in Mitleidenschaft gezogen hat, zu einer reaktionären Metaphysik des Gegensatzes zwischen menschlicher Rationalität – ausgerechnet! – und Zwecksetzung überhaupt auf der einen, natürlichen Kreisläufen auf der anderen Seite; mit eindeutiger Bevorzugung der Kreisläufe, als deren unselbständiger Teil „der Mensch“ sich gefälligst begreifen und aufführen sollte. Das banale Rezept dafür heißt Bescheidenheit und deckt sich in auffälliger Weise mit den Maßnahmen der staatlichen Umweltpolitik, die das Leben der Massen verteuert, um das Wachstum des Eigentums von schädlichen Nebeneffekten, nämlich Rückwirkungen auf dessen Bilanzen, zu entlasten. Der Umweltgedanke bewährt sich so als affirmative Ideologie der Armut, und zwar genau der Armut, zu der die Umweltvergiftung praktisch das Ihre beiträgt und der Staat mit seiner Umweltpolitik noch einmal das Seine: der Armut, die zur Lohnarbeit systemnotwendig hinzugehört.
d) Natürlich arbeiten Lohnarbeiter nicht, um hinterher genauso schlecht dazustehen wie vorher. Sie wären schon dafür zu haben, Nutznießer des von ihnen produzierten Reichtums zu sein, so wie die Umweltideologie ihnen das unterstellt. Die Lohnarbeit läßt von solchen Wünschen bloß nicht viel übrig – was schon damit anfängt, daß sie regelmäßig die ersten Opfer der Rücksichtslosigkeit sind, mit der ihre Arbeitgeber alle natürlichen Lebensbedingungen, außerhalb wie vor allem innerhalb ihres Betriebs, als Mittel zur Vermehrung ihres Eigentums behandeln. Sie selber sind nämlich für die Dauer ihrer Arbeit Mittel zur Vermehrung des Unternehmereigentums und als solches Mittel deren Eigentum: Teil des Vermögens, das „sich“ verwerten muß, „Produktionsfaktor“ eben.
Entsprechend sehen sie aus, wenn sie – nach der Schicht, am flexiblen Wochenende, zum Jahresurlaub, ganz zum Schluß bei der Ausmusterung in den Ruhestand – von der Arbeit kommen und wieder ihr eigener Herr sind: erholungsbedürftig. Nicht nur den besseren Teil ihrer Lebenszeit überhaupt lassen sie im Betrieb; von ihrer Physis selbst bleibt einiges auf der Strecke, was gar nicht so recht wiederherzustellen ist. Soweit die deutsche Öffentlichkeit sich überhaupt um die Arbeitswelt kümmert – im Großen und Ganzen ist das kein Thema –, wird im Wesentlichen herausgestellt, wie relativ wenig Stunden im Jahr deutsche Arbeiter im Betrieb verbringen: unter 2000 (ohne Überstunden…)! Daneben wird der weltrekordmäßige Leistungsstand deutscher Betriebe vermeldet und gelegentlich der durchschnittliche Krankenstand – aber niemand mag daraus den Schluß ziehen, daß die hierzulande geleistete Lohnarbeit mit ihrer Leistungsdichte sogar längere Arbeitszeiten anderswo in den Schatten stellt und sich offenbar gar nicht länger aushalten läßt als die errechnete Durchschnitts-Stundenzahl, jedenfalls von einem halbwegs durchschnittlichen Arbeiter. Stattdessen wird öffentlich herumgefragt, vom deutschen Kanzler zum Beispiel, ob „wir“ es „uns“ nicht zu bequem machen – ihm und seinen Gesinnungsgenossen in Politik und Öffentlichkeit sind die Arbeitszeiten der deutschen Tariflöhner schon längst viel zu kurz. Aber daß es eine Pflegeversicherung braucht, weil die meisten ausgearbeiteten Lohnempfänger, sofern sie ihr Rentenalter überhaupt erreichen, und ganz viele schon vorher kaum noch für sich selber und ihre kaputte Leiblichkeit sorgen können, leuchtet dann wieder jedem ein; da geht es ja auch um die Einsparung von Sozialhilfe. Als wäre nicht auch da der ursächliche Zusammenhang offenkundig: Auch mit 35-Stunden-Woche und fünf bis sechs Urlaubswochen im Jahr ist der Verschleiß, den die intensive Bedienung höchstproduktiver Arbeitsplätze dem Bedienungspersonal antut, nicht zu kompensieren. Es hilft ja nichts, daß der moderne, medizinisch betreute Mensch insgesamt länger hält als früher, wie es die Erfolgszahlen über eine steigende Lebenserwartung signalisieren: Vor allem kann er sich länger über seinen Verschleiß hinwegschwindeln und ist anschließend länger kaputt. Aber darüber beschweren sich wieder bloß, in höflicher Form, die gesetzlichen Rentenversicherer, wenn sie in ihren Schaubildern einem aktiven Lohnarbeiter einen und ein Achtel Rentner auf den Buckel packen.
So kommt es, logischerweise, wenn Menschen mit ihrer Arbeitskraft Unternehmern gehören, die daraus das Beste machen; wenn der Produktionsfaktor Arbeitsplatz dem Produktionsfaktor Arbeitskraft die Tätigkeiten vorgibt, auf die der letztere sich einerseits reduzieren, andererseits konzentrieren muß – und das immer wieder neu, wenn der Arbeitsplatz verändert wird und damit der Leistungsanspruch an das Gewohnheitstier, das ihn bedient. Deutsche Unternehmen melden gelegentlich voll Stolz, wie „ergonomisch“, human und leistungsgerecht sie ihre Arbeitsplätze hinkonstruiert haben: Sie tun einfach alles, lassen forschen und geben sogar Geld dafür aus, damit unnötige Belastungen am Arbeitsplatz vermieden werden – so sehr kommt es ihnen auf die nötigen, nämlich produktiven Belastungen an. Der Arbeitsplatz wird so an den Menschen angepaßt, daß der Mensch sich reibungslos in seinen Arbeitsplatz einpassen und zweckmäßig darauf vereinseitigen läßt; was außer dieser Einseitigkeit von ihm übrigbleibt, geht die Firma nichts an. Zumal sich ja glücklicherweise kaum quantifizieren läßt, was von den Nerven und dem Verstand eines modernen Hochleistungsarbeiters mit auf der Strecke bleibt: verkümmert, weil systematisch vereinseitigt oder ausgeschaltet. Für die Psyche gibt es – auch das ist erforscht! – leistungsfreundliche Farben in der Werkstatt, und auch da zieht niemand gehässige Schlüsse auf den Zweck von soviel Menschenfreundlichkeit.
Dafür gibt es den Lohn. Mit dem fängt die Freiheit an: Gelegenheit für den Lohnarbeiter, „zur Sache“ zu kommen, für die er sich abarbeitet, sich um sich selbst zu kümmern und – wie versprochen – vom Lohn zu leben. Da wird ihm auch kaum reingeredet; die freie Marktwirtschaft kennt keine außerbetriebliche Vormundschaft über die befristet Leibeigenen der Unternehmenswelt oder nur ganz wenig. Es ist bloß vorab schon viel entschieden – nämlich genaugenommen alles.
e) Im Reich der Freiheit, das für den Lohnarbeiter mit dem gezahlten Lohn beginnt, herrscht vor allem andern die Notwendigkeit, sich einzuteilen, damit das Geld bis zur nächsten Lohnzahlung langt. Armut heißt dieser Sachzwang deswegen nicht, weil in allen zivilisierten Staaten Armut eine Definitionsfrage ist; und beim Definieren gilt der Durchschnitt als der ortsübliche Wohlstand. Unter dem liegen in Deutschland die produktiven Lohnarbeiter nicht viel darunter; schließlich hat der Staat die Vergütung der meisten seiner Dienstkräfte in enger Anlehnung an entsprechende Löhne in der „freien Wirtschaft“ festgelegt, so daß sich die Massen in der modernen „Dienstleistungsgesellschaft“ überhaupt nicht besser stehen als in der „Klassengesellschaft“, die es nach offizieller Meinung vielleicht irgendwann mal im 19. Jahrhundert gegeben haben mag. Somit spricht allein die massenhafte Verbreitung des eher niedrigen Einkommensniveaus dagegen, den damit erzwungenen Lebensstandard ärmlich nennen zu dürfen.
Im System der Lohnarbeit existiert allerdings ein zwar nirgends anerkannter, dafür ökonomisch objektiver Maßstab für Armut. Das ist der zustandegebrachte, fortwährend reproduzierte und vergrößerte Reichtum, von dem die Lohnarbeiter, die ihn schaffen, ausgeschlossen sind, dessen Ansprüchen sie sich aber nirgends entziehen können, und zwar aufgrund der marktwirtschaftlichen Logik ihres Berufs. Daß die Lohnarbeit dem Gesetz der Mehrwertproduktion unterliegt, macht sich für die Leute, die sie verrichten, in der Weise geltend, daß sie in der Arbeit und außerhalb der Arbeit schon wieder den Kalkulationen der Unternehmer unterliegen: Im Unternehmen wird alles getan, um die Lohnsumme zum verschwindenden Restposten im Verhältnis zum geschaffenen Warenwert herabzudrücken; als Verbraucher werden die Lohnempfänger mit der Größe des Warenwerts konfrontiert, den sie geschaffen haben, nämlich in Form von Preisen, denen sie mit ihrer Lohnsumme machtlos gegenüberstehen. Der produzierte Reichtum, der sich in verkäuflichen Waren darstellt und im Geld sein Maß hat, wächst; und zwar – darauf kommt es nämlich an, und sonst wäre alles Produzieren umsonst gewesen – im Verhältnis zu den Lohnkosten, die dafür aufgewandt werden müssen; mit dem Reichtum nimmt also das Ausmaß zu, in dem die Lohnarbeiter davon ausgeschlossen sind; und die Wertgröße, die ihre Arbeit in die Welt setzt, ist selber das Mittel für diesen Ausschluß: die können sie mit ihrem Lohn gar nicht bezahlen.
Das ist der ökonomische Sachzwang, der zum dauernden kritischen Vergleich zwischen verfügbarer Geldsumme und verlangten Warenpreisen zwingt und zu wohlkalkulierten Verzichtsleistungen nötigt – und den man nicht Armut nennen darf, weil er eine allgemeine zivilisatorische Errungenschaft darstellt. Denn tatsächlich ist damit Armut im Sinne des schieren Mangels, des Nicht-Vorhanden-Seins nötiger und nützlicher Güter, prinzipiell überwunden. An seine Stelle ist Mangel im Sinne des gesellschaftlich herbeiorganisierten, systemnotwendigen Ausschlusses von durchaus reichlich vorhandenem Gebrauchswert getreten. Die Armut moderner Lohnarbeiter ist Geldmangel angesichts gegebener Preise – oder auch Preishöhe angesichts gegebener Einkommen –; und offiziell ist sie eben keine, solange das Maß des individuellen Ausschlusses vom Vorhandenen den ortsüblichen Durchschnitt nicht allzu krass überschreitet.
Diese durchschnittliche Armut wird – weil sie in einem so gut funktionierenden marktwirtschaftlichen Paradies wie Deutschland immer auch eine gewisse Zahlungsfähigkeit darstellt – geschäftlich ausgenutzt; nämlich mit Waren bedient, deren eigentümlicher Gebrauchswert sich aus der Kalkulation der Geschäftswelt mit dem „kleinen Geldbeutel“ erklärt. Auf ihre Art wird die Versorgung der Massen in der deutschen Marktwirtschaft auf diese Weise durchaus vielfältig; von der Ferienreise bis zum Wohnungsmobiliar steht dem Luxus der reicheren Schichten dessen Karikatur zu Händen der minder Bemittelten zur Seite. Am Ende vermag sich der vom Durchschnittslohn vorgezeichnete Lebensstandard sogar mit einem billigen, deswegen keineswegs preiswerten Auto auszustaffieren: eine Errungenschaft, an der viele Werktätige im Osten ihre realsozialistische Armut gemessen und für unerträglich befunden haben. Allerdings macht sich bereits bei solchen großartigen Erfolgen marktwirtschaftlicher Verkaufsstrategen eine gewisse Peinlichkeit am Wohlstand der armen Leute geltend. Sie liegt nicht nur in der unübersehbaren Ärmlichkeit der Produkte, mit der sie sich den einen oder anderen „Lebenstraum“, vom Auto zum Beispiel oder gar, alles andere dann freilich ausschließend, von den „eigenen vier Wänden“ – mehr sind es dann auch meistens nicht –, erfüllen. Wenn Lohnarbeiter nach Gebrauchswerten der gehobenen Güteklasse streben, und Freiheit wie Gelegenheit dazu bietet ihnen die Marktwirtschaft, dann stellt sich ganz von selbst manches auf den Kopf: Bevor der erstrebte Gebrauchswert zum Mittel eines schöneren Lebens werden kann, muß das Leben sich erst einmal streng nach dem Zweck ausrichten, den geforderten Preis zusammenzustottern. Die zeitliche Reihenfolge kann durchaus auch umgekehrt sein: Dann wird nicht im Voraus vom Lohn gespart, so daß außer dem nur noch wenig läuft im Leben, sondern im Nachhinein ein aufgenommener Kredit oder eine Ratenzahlungspflicht bedient, so daß man sich endgültig nichts weiter leisten kann. Die Regel ist sowieso, daß beides zusammenkommt, Sparen und Schulden-Bedienen – zwei Sachzwänge des „guten Lebens“, mit denen schon wieder eine ganz andere Partei, nämlich die Verwalter des Geldes der Nation, Banken und Sparkassen, ihr kleines Massengeschäft machen: Auch mit seiner Freiheit, sich ein bißchen in die große Warenwelt einzuklinken, ist der Lohnempfänger nichts als Objekt, in dem Fall eines Geschäftszweiges, dem nicht selten am Ende der ganze je zu verdienende Lohn verpfändet ist. Was eigentlich nicht mehr als Mittel des besseren Lebens sein sollte, macht sich so über seinen Preis zum bestimmenden Lebenszweck. Und wenn der Mensch sich dem unterwirft, muß er sich anschließend von Kulturkritikern sagen lassen, er wäre, ausgerechnet, dem „Konsumismus“ verfallen, statt seine Freiheit gleich vorab zum Verzicht auf jeden Teilhabe an der gehobenen Warenwelt zu benutzen, und hätte, weil nicht freiwillig arm geblieben, seine unfreiwillige Armut selbst verschuldet.
f) Dabei ist an der proletarischen Konsumwut noch eine weitere Peinlichkeit eigentlich kaum zu übersehen: Sie tobt sich gar nicht im Bereich des Lebensgenusses aus, sondern an lauter Notwendigkeiten. Und zwar solchen, die überhaupt nicht von einer ewig-menschlichen „Bedürfnisstruktur“ diktiert werden – der Bedarf wird nebenher mit abgefertigt –, sondern durch das Lebensmittel der Lohnarbeiter, ihre Arbeit, erst in die Welt kommen.
Vor allem ist es ja so, daß die Wirkungen der Arbeit in fremden Diensten von den Leuten, die sie machen, keineswegs abfallen, wenn die Arbeitszeit vorbei ist; und bis sie wieder anfängt, müssen die wichtigsten Voraussetzungen der verlangten Leistungsfähigkeit wiederhergestellt sein. Erholung muß sein, verbraucht einen guten Teil der freien Zeit und hat ihren Preis. Die Gesundheit, mit der ausgestattet der Mensch doch eigentlich Dingen nachgehen will, die das Leben lohnend machen, wird zum Gut, um das man sich verantwortungsbewußt kümmern muß, weil sie durch die im Betrieb verlangten Leistungen strapaziert wird, also da sein muß, um verbraucht zu werden; was keineswegs bedeutet, daß im Krankheitsfall der Gang zur Arbeit einfach unterbleibt: Krankheitstage unterliegen dem betrieblichen Verdacht, da würde „gefeiert“, und wollen dementsprechend kalkuliert sein. Bekömmlich ist das nicht; um so mehr kostet das Fit-Halten Zeit und Geld – die Gesundheitsapostel der Nation steuern zur Ermunterung den zynischen Hinweis bei, die Gesundheit läge doch wohl in jedermanns ureigenstem Interesse. Alle Angebote, den Aufwand für kompensatorische Aktivitäten in eine nette Freizeitgestaltung umzudefinieren, täuschen kaum darüber hinweg, daß sie das Leben genausowenig schön machen wie die offiziell geächtete Alternative, die Arbeit und ihre Nachwirkungen mit Alkohol oder ähnlichem auszuhalten. Es bleiben Notwendigkeiten zu bedienen, die vom Lohnarbeiter, egal ob er sich über sie hinwegsetzt oder ihnen zu genügen sucht, einiges an Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst abverlangen – wie schon die Arbeit selbst.
Zum Bereich der notwendigen Bedürfnisse, die nicht die Menschennatur, sondern die Lohnarbeit mit sich bringt, gehören weiterhin die meisten der „langlebigen Gebrauchsgüter“, an deren Vorhandensein so gern der Wohlstand deutscher Arbeiter demonstriert wird: vom Kühlschrank bis zum Auto lauter Hilfsmittel, um pünktlich und mit der nötigen Leistungskraft und Einstellung ausgestattet immer von neuem den Weg aus der Schlafstadt zur Werkstatt zu schaffen. Ausgerechnet bei dem Versuch, der Notwendigkeit dann wenigstens auch ein paar vergnügliche Seiten abzugewinnen, dem Auto zum Beispiel die große Wochenend-Freiheit, setzt dann wieder die offizielle Kulturkritik am hemmungslosen Verbraucher ein – und dahinter steht schon der Fiskus bereit, um dem „Konsumterror“ durch satte Extra-Steuern Grenzen zu ziehen: Schon wieder bedient der Lohnarbeiter mit seinen paar Lebensregungen lauter fremde Geldinteressen und kommt darüber erst gar nicht „zur Sache“, für die er doch gearbeitet haben will.
Nicht einmal dann lassen die Notwendigkeiten der Lohnarbeiter die Mitglieder dieser großen Berufsgruppe so richtig los, wenn sie infolge Entlassung Pause haben. Sich bereithalten ist auch dann verlangt, wenn gar nicht absehbar ist wofür; und ein Drittel billiger hat es zu sein als der Aufwand, mit dem eine aktive Arbeitskraft sich immer wieder herzustellen hat.
Vom Vorsatz, für den Lohn zu arbeiten, um zu leben, geht auf diese Weise genau soviel in Erfüllung, daß man lebt. Physisch präsent und leistungsfähig: Wenn mehr nicht gemeint ist mit Leben, dann läßt sich allenfalls leben vom deutschen Lohn. Er versagt, wo er Mittel für mehr sein soll; und schon damit er das Notwendige hergibt, muß der Lohnempfänger sich so in den Dienst der verlangten Preise stellen, daß es zum unbefangenen Gebrauch der nötigen Güter gar nicht erst kommt. An allen Ecken und Ende verkehrt das Verhältnis zwischen Verdienst und Preisen den guten Vorsatz in sein Gegenteil: wird gelebt unter dem Diktat und für den Zweck der betrieblichen Benutzung als Arbeitskraft. Das folgerichtige Ergebnis ist eine gewisse Verwahrlosung, die keineswegs bloß in Deutschlands Ostzone an den Häuserfassaden zu besichtigen ist, sondern in gleichem Ausmaß hinter den hübsch verputzten Fassaden Westdeutschlands, wo die Häuser ja schon länger der gutgestellten Klasse der Haus- und Grundbesitzer gehören. Eingeschlossen ist darin eine Sorte Lebenskampf, den nicht die Natur ihren vernunftbegabten Kindern auferlegt hat, sondern das gesellschaftliche Produktionswesen, in dem es ums Geld geht. Zu dem gehören Verlierer – in Deutschland das berühmte „untere“ oder „vergessene Drittel“, in anderen nationalen Niederlassungen der modernen Marktwirtschaft sind es bis nahe an 100 Prozent –, für die, mit einer schlecht entgoltenen Lohnarbeit oder ganz ohne, noch nicht einmal das Leben zustandekommt, das ordentlich geführt sein will, damit der Mensch für seinen Gebrauch als Arbeitskraft taugt. Vom Lohn leben zu müssen, bedeutet eben alles andere als eine Garantie, mit dieser Voraussetzung auch leben zu können.
Daß Lohnarbeiter in der Marktwirtschaft keine andere Chance haben – außer der Erbschaft oder dem Lottogewinn, der sie davon befreit, auf Lohnarbeit als ihr Mittel angewiesen zu sein –; daß sie von einem Leben, das sich lohnt, durch ihr eigentümliches Lebensmittel selbst ausgeschlossen sind: das stellen im übrigen die sachverständigen Freunde dieser Wirtschaftsweise auf ihre Art selber immer wieder klar. Am deutlichsten, wenn sie vor der Einbildung warnen, es ginge eventuell auch anders: der geschaffene Reichtum ließe sich bei gutem Willen doch so umverteilen, daß jeder was vom Leben hat. Dagegen warten sie mit Berechnungen auf, die glasklar zeigen, daß mit der Verteilung der Profite ans Volk auch keiner wohlhabend würde – wie auch: Wenn sonst alles so bleibt, wie es ist, alle Notwendigkeiten des Geschäfts bedient werden müssen, die Zweckbestimmung des Reichtums und der dafür geleisteten Arbeit die Vermehrung des Eigentums ins Geldform bleibt und ein ganzer Staat dafür einsteht und sich entsprechend ausstattet, dann mag noch was zum Umverteilen übrigbleiben! Da haben die Experten schon recht, die das marktwirtschaftliche System gegen wohlmeinende Umverteilungswünsche – „von oben nach unten“ – in Schutz nehmen: Mit der Einrichtung der Lohnarbeit ist über die Verteilung von Reichtum und Armut definitiv entschieden; Korrekturen sind systemfremd, einschneidende Korrekturen systemwidrig und -zerstörend. Die Marktwirtschaftler sagen es selbst: Ihr System ist letztlich unverbesserlich. Man sollte sich das merken.
g) Freiheit und Freizeit der Lohnarbeiter haben also ihren Inhalt, bevor sie losgehen; der besteht aus lauter Zwängen. Dennoch, es bleibt jedem einzelnen unbenommen, mit diesen Notwendigkeiten klarzukommen, sich einzuteilen und seine Freizeit zu gestalten, wie er/sie es will. Diese Freiheit gönnen die Spitzen der Gesellschaft ihrem Fußvolk, machen sich gegen jegliche Bevormundung stark, wie sie im Wohlfahrtswesen der alten DDR zum Beispiel geherrscht haben soll, wollen erst recht niemanden „gängeln“ – jedenfalls nicht mehr als unbedingt nötig. Warum auch! Sie verlassen sich in ihrer Liberalität darauf, daß den fest etablierten Sachzwängen der Marktwirtschaft sowieso ent- und nicht widersprochen wird, gerade von deren Opfern. Und sie werden nicht enttäuscht. Die Leistung der Anpassung – an die betrieblichen Leistungsvorgaben und Arbeitszeitordnungen, an die Alternativen des Sparens und Schuldenmachens, an die Erfordernisse einer geordneten Verwahrlosung, an die gebotenen Chancen und unausbleiblichen Enttäuschungen – wird in aller Freiheit erbracht. Die Freiheit läßt sich leicht loben, von oben herab.
In ihren praktischen Anpassungsleistungen folgen Deutschlands Lohnarbeiter einer gewohnheitsmäßigen Sicht ihrer Lage, die umgekehrt jeden praktischen Sachzwang. dem sie genügen müssen, als – „nun einmal“ gegebenen – Lebensumstand versteht, mit dem man sich sowieso einrichten muß, also so geschickt wie möglich einrichten sollte. Alle Interessen, deren Objekt und Manövriermasse sie sind, werden damit als fraglos gültige Existenzbedingungen anerkannt. Nicht bloß unter Wirtschaftsforschern, auch unter Lohnempfängern geht es als der pure Realismus durch, sich selbst und sogar die eigenen Lebensschwierigkeiten von oben herab zu betrachten, vom Standpunkt der Benutzer und Nutznießer der eigenen Arbeitskraft aus. Die reine Welterfahrenheit gebietet es, die eigenen Interessen ebenso wie die der Gegenseite zu problematisieren und für überparteilichen Ausgleich zu sein. Auch mit der Staatsgewalt rechten deutsche Lohnarbeiter gerne um Gebrauch und Verbleib des verstaatlichten Mehrwerts, den sie doch bloß geschaffen, nie für sich verlangt haben, so als müßten sie ihre Obrigkeit bei der produktiven Trennung des Reichtums von ihnen beraten; zerbrechen sich unter vielstimmiger Anleitung sämtlicher Medien den Kopf der politischen Großverbraucher des nationalen Wertprodukts; halten sich am Ende die nationale Macht zugute, die aus ihnen doch bloß herausgewirtschaftet wird und einer Staatsräson folgt, für die sie wieder bloß als Manövriermasse verplant sind. Ausländer, gleichgestellte vor allem, halten sie für das größere Problem als die Herrschaft, die Inländer über sie ausüben. Der weltpolitische Erfolg der deutschen Nation leuchtet ihnen als höchste und verbindlichste Notwendigkeit ein, als wäre etwas daran an der „Bestechungstheorie“ aus früheren Tagen der Arbeiterbewegung, als deren radikale Fraktion an der patriotischen Unterwerfungsbereitschaft der Mehrheit herumrätselte und meinte, das eigentlich von Natur aus zur Revolution geneigte Proletariat würde durch Beteiligung an dem Reichtum bei der Stange gehalten, den die Imperialisten fremden Völkern abpressen – so als stünden die billigen Kolonialwaren in irgendeinem bemerkenswerten Verhältnis zu dem Reichtum, über den Imperialisten erst einmal verfügen müssen, bevor sie alles ihrem Weltmarkt unterwerfen… Dabei ist die Teilhabe der Lohnarbeiter am Benutzen und, wenn es denn schon um dieses primitive Verhältnis gehen soll, Ausplündern fremder Länder bestenfalls ideeller Natur; und wenn sie ideell darauf bestehen, daß Bananenrepubliken dies gefälligst zu bleiben und den Deutschen ihre Lieblingsfrucht billig abzuliefern haben, dann haben sie nie ihren weltpolitischen Zusammenhang mit tropischen Plantagen und den dazugehörigen Machtgebilden ernstlich durchkalkuliert – sie wären auch bloß darauf gestoßen, daß sie nicht bestochen, sondern billiger werden, wenn ihr Nachwuchs von billigen Bananen satt wird. Sie haben bloß mitgekriegt und ganz selbstlos, rein patriotisch, für gut befunden, daß ihre Nation sich von solchen Ländchen minderen Ranges nichts gefallen lassen darf. Und kämen deswegen auch nie auf die Idee, ihrer nationalen Geschäftswelt wirklich und mit vergleichbarem Selbstbewußtsein ein Stück des Reichtums abzufordern, den die aus den Schuldnerstaaten der Weltwirtschaft eintreibt. Die Einbildung, man wäre als Lohnarbeiter bei den weltpolitischen Manövern der eigenen Nation gefragt und mit von der Partie, ist nichts als eine Art, sich ein Einverständnis mit den nationalen Instanzen herbeizuwirtschaften, die die wirklichen Nutznießer dessen sind, was sie auswärts anrichten.
Mit dem Gebrauch ihrer Freiheit geben Deutschlands Lohnarbeiter in Theorie und Praxis zu erkennen, daß sie nicht bloß auf Zeit mit ihrer Arbeitskraft, auch nicht nur mit ihrer kleinen Geldwirtschaft und Freizeitgestaltung, sondern auch noch mit ihrem Verstand und dem Vers, den sie sich auf ihre Lebenslage machen und zu ihrer Lebensmaxime erheben, Eigentum der anderen Seite sind – auch mit Gemüt und Weltbild „klein v“. Genau das macht sie so berechenbar in ihrer Freiheit; fürs Geschäft wie für die Politik. Im Geschäftsleben ist darauf Verlaß, daß Lohnarbeiter sich bis zu ihrer Entlassung – und in tragischen Fällen noch darüber hinaus – ihre höchstpersönliche Unentbehrlichkeit für „ihre“ Firma einbilden. Und in Deutschlands Demokratie schaffen es drei bis fünf politische Parteien, mit extrem wenig Pluralismus die Meinungsvielfalt von Millionen freien Bürgern mit unverwechselbarer eigener Meinung zu bedienen und wahlarithmetisch zu bewirtschaften. Das ist nämlich die Ironie der Geschichte, die ironischerweise genau solange in Kraft ist, wie die lohnarbeitende Menschheit ihre Klassenlage nicht begreift – was übrigens auch für Lohnarbeiter nicht schwieriger ist als ein dauerndes Einverständnis mit Kohl und der Bild-Zeitung –: Wo Lohnarbeiter ganz individuell werden, werden sie endgültig gnadenlos einförmig und offenbaren bloß, wie total sie – nach ökonomischer Funktion, Lebenslage, Lebensführung und Lebensphilosophie – eine gesellschaftliche Klasse und sonst nichts sind: eine Klasse, die insgesamt nicht sich, sondern sehr funktionell ihren Arbeitgebern gehört.
Solange sie dieser ihrer Klasseneigenschaft treu bleiben, bekommen die Lohnarbeiter der Nation von allen, die etwas zu sagen haben im deutschen Klassenstaat, beste Noten. Die bestimmende Elite gefällt sich in einem bürgerlichen Proletkult, der die verkehrte Gewißheit der ehemaligen Linken, Vorhut einer ohnehin massenhaft aufbrechenden Begeisterung für den Sozialismus zu sein, mit umgekehrten Vorzeichen auf die Spitze treibt, nämlich bis zu dem Zynismus, die Massen dafür zu loben, daß sie im Dienst am Kapital und der demokratischen Staatsmacht ihre Berufung und wahre Freiheit entdeckt und anerkannt hätten. Die Regierenden wissen eben, was sie an ihren Massen haben – jedenfalls sehr viel besser als umgekehrt.