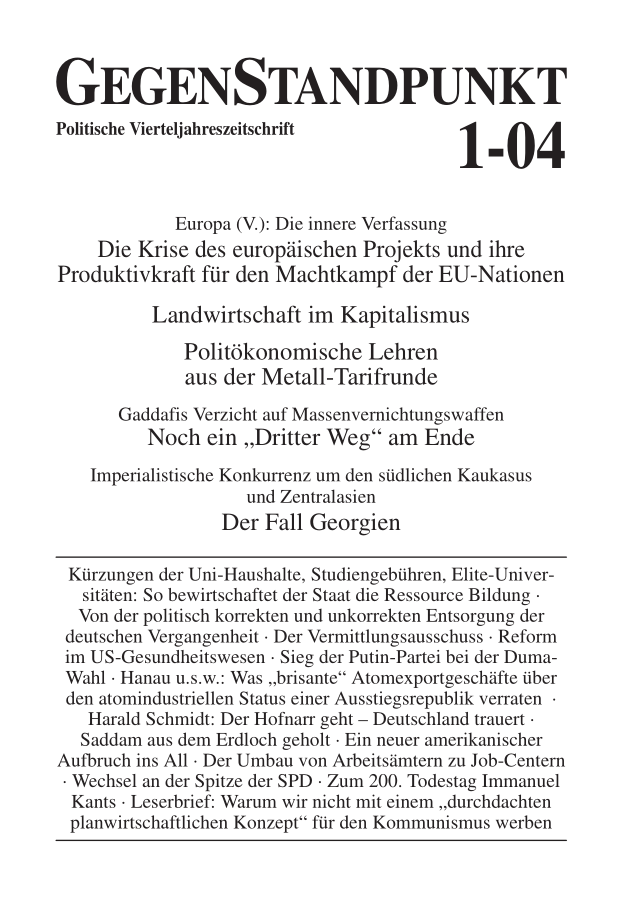Landwirtschaft im Kapitalismus
Das Geschäft des Bauern, das kapitalistische Geschäft mit dem Bauern und das politische Geschäft mit den Bauern.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Das Geschäft des Bauern
- II. Das kapitalistische Geschäft mit dem Bauern
- III. Das politische Geschäft mit den Bauern
- 1. Der europaweite Agrarmarkt zwingt eine rückständige Branche zur „Modernisierung“.
- 2. Der Erfolg des Agrarmarkts und der Kampf gegen Überschüsse
- 3. „Agenda 2000“ – die sogenannte „Wende in der Agrarpolitik“
- Die Scheidung in wachstumsfähige Agrarfabriken und ruinierte Kleinbauern ist fertig – Marktordnung und ländliche Sozialhilfe werden getrennt
- Verbote und neue Anreize: Marktwirtschaftliche Instrumente gewährleisten Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und Verbraucherschutz
- Unterordnung I: Landwirtschaftspolitik in Abhängigkeit vom europäischen Haushaltsstreit und der Ost-Erweiterung
- Unterordnung II: Agrarpolitik nach Maßgabe des handelsdiplomatischen Kräftemessens in der WTO
Landwirtschaft im Kapitalismus
BSE, Maul-und-Klauen-Seuche, Schweinedoping, Hühnerpest – die Bevölkerung ist aufgebracht, die Öffentlichkeit besorgt. Verbraucher, Tierschützer, nationalökonomische Auskenner – alle erregen sich über den ‚Wahnsinn‘, der – so hört man allenthalben – in der Landwirtschaft gang und gäbe ist. Rinder erst mit Subventionen widernatürlich mästen, obwohl es doch ohnehin viel zu viele gibt, und dann schon wieder mit Steuergeldern vom Markt nehmen und vernichten, um den Marktpreis zu retten. Vieh zusammenpferchen und quer durch Europa transportieren, obwohl Rinder, Schafe, Schweine überall gezüchtet werden können. Ungesunde Tiere hochzüchten, unbekömmliche und gesundheitsschädliche Lebensmittel produzieren, die dann keiner mehr kaufen mag. Und das alles auf Staatskosten. Milliarden dafür verschleudern, dass Bauern massenhaft produzieren, was nicht gebraucht wird, und das, obwohl die meisten Bauernhöfe ohnehin nicht ordentlich überleben können. Eine Landwirtschaft fördern, die immer rücksichtsloser und naturwidriger zu Werke geht, nur um sich dann mit den verheerenden Folgen für Gesellschaft und Bauern herumschlagen zu müssen. So und ähnlich die Beschwerden.
Kein Wunder: Die Landwirtschaft und ihre regelmäßigen Skandale sprechen in besonders eklatanter Weise allen gängigen Vorstellungen Hohn, Versorgung und Geschäft, Gebrauchswert und Profit, rationelles Wirtschaften und Konkurrenz würden sich miteinander vertragen und nützlich zusammengehen. Das können die eingefleischtesten Anhänger der Marktwirtschaft in der Landwirtschaft einfach nicht entdecken und verstehen prompt die Welt nicht mehr – statt an den vertrauten Ideologien über die beste aller möglichen Wirtschaftsweisen zu zweifeln. Die Prinzipien einer politischen Ökonomie, denen auch die Agrarwirtschaft mit ihren wenig rücksichtsvollen Produktionsmethoden und die Lebensmittelindustrie mit ihren oft wenig bekömmlichen Produkten gehorchen, sind dem Verbraucher und seinen öffentlichen Anwälten herzlich gleichgültig. Sie klagen lieber unverantwortliche Bauern, profitgierige Futtermittelproduzenten, Brüsseler Bürokraten und säumige nationale Kontrollbehörden an, wenn wieder einmal etwas von den Mensch und Natur schädigenden Usancen dieses Gewerbes öffentlich aufgedeckt wird. Sie beruhigen sich aber auch regelmäßig wieder, wenn der Staat sich der Sache annimmt: Eine neue Ministerin, die Kontrolle und Durchgreifen verspricht, und einige Zeit genügen selbst in den härtesten Fällen, damit sich das Konsumverhalten wieder normalisiert und der Verbraucher froh ist, sich nicht laufend fragen zu müssen, was er isst – bis der nächste ‚Skandal‘ die Gemüter aufs Neue erregt. Vom System, das all das hervorbringt, wollen alle, die über die Gepflogenheiten in der staatlich betreuten Agrarwirtschaft den Kopf schütteln, einfach nichts wissen; nicht, wenn sie sich aufregen, und schon gleich nicht, wenn sie sich wieder abregen.
I. Das Geschäft des Bauern
Der heutige Bauer heißt Landwirt. Der Name hebt seinen Status als selbständiger Unternehmer hervor und rechnet den Landmann damit zum wichtigsten Stand der Marktwirtschaft. Tatsächlich unterscheidet er sich grundlegend vom „abhängig Beschäftigten“, denn er besitzt Eigentum an Produktionsmitteln. Er braucht sich nicht gegen Lohn für fremde Gewinnmaximierung zur Verfügung zu stellen, sondern kann auf eigene Rechnung und zum eigenen Vorteil wirtschaften. Dass er dafür sein Eigentum, Boden und Gerätschaften, die zum meist ererbten Hof gehören, nicht mit bezahlter fremder Arbeit, sondern mit der eigenen kombiniert, das unterscheidet ihn wieder von den sonstigen Vertretern des Unternehmerstandes. Ein Eigentümer, der andere an seinen Produktionsmitteln arbeiten lässt und sich die Erträge daraus aneignet, also allein aus dem Besitz dieser sachlichen Mittel Einkommen beziehen kann, ist der Bauer dann doch nicht. Er arbeitet selbst und erzielt Einkommen aus dem Verkauf seiner Arbeitsprodukte. Wie andere Gewerbe bekommt er den Maßstab der Rentabilität, den er zu erfüllen hat, vom Markt mitgeteilt, d.h. einerseits von den Verkaufspreisen des Handelskapitals, das in landwirtschaftlichen Ausrüstungen und Vorprodukten macht, andererseits von den Preisen, die die Lebensmittelindustrie mit ihrer Rentabilitätsrechnung für seine Produkte zu zahlen bereit ist. Mit dieser Rentabilität scheinen die Bauern ein generelles Problem zu haben. Es gelingt ihnen offenbar nicht, mit den erzielbaren Verkaufspreisen ihrer Produkte genug Gewinn zu erwirtschaften, um ein Einkommen zu erzielen, das für den Lebensunterhalt ihrer Familien und die Reproduktion ihrer Höfe reicht.
Der „landwirtschaftliche Unternehmer“ ist nämlich in allen kapitalistischen Ländern zugleich ein dauerhafter Kostgänger der Staatskasse, der einen erheblichen Teil seines Einkommens nicht am Markt verdient, sondern in Form verschiedener Subventionen von der öffentlichen Hand gewährt bekommt. Die lässt es nicht darauf ankommen, ob, wie und wie viele Bauern die Bewährungsprobe des Marktes bestehen und sich behaupten, sondern widmet der problematischen Branche ein eigenes Ministerium und anerkennt mit dessen – von der allgemeinen Wirtschaftspolitik abweichenden – politischen Regelungen und Unterstützungsmaßnahmen ein spezielles Handikap der Bauern bei ihrem Bemühen, aus ihrem Eigentum und ihrer Arbeit eine brauchbare kapitalistische Revenuequelle zu machen.
Das chronische Defizit im Haushalt von Bauern, deren Produktion selbst Gesellschaften, die ihre Zukunft mit Autos, HiTech und Stammzellen sichern, die unverzichtbaren Lebensmittel liefert, verdankt sich offenbar keiner Rechenschwäche. Landwirte unternehmen alles, was in ihrer ökonomischen Macht steht, um rentabel zu wirtschaften. Aus eigenem Interesse kalkulieren sie mit dem zahlungsfähigen Bedürfnis, das der Markt für ihre Produkte bereithält. Sie bemühen sich um das Wachstum ihrer Betriebe, damit sie dem Markt mehr Verdienst abtrotzen. Und sie steigern unablässig ihre Produktivität, damit ihre Ware „konkurrenzfähig“ bleibt bzw. wird. Wenn dennoch regelmäßig die Zahl bäuerlicher Betriebe zurückgeht und das Überleben der „erfolgreichen“ Bauern das Werk staatlicher Subventionen ist, dann verweist die Ertragslage der Landwirtschaft auf eine mangelhafte Ausstattung dieses Gewerbes. Das Zusammenspiel seiner „Produktionsfaktoren“, die Kombination von Eigentum und Arbeit, die in der Landwirtschaft zum Einsatz gelangt, versagt den Dienst für eine unternehmerische Karriere im Zirkus der Marktwirtschaft.
1. Von der Behinderung des Geschäfts durch das natürliche Wachstum
Es ist eine Sache, dass das Produzieren in der Landwirtschaft von natürlichen Wachstumsprozessen bei Tieren und Pflanzen abhängt, Prozessen, die der Bauer in Gang bringt und steuert – so dass der Wetterbericht eine entscheidende Rolle spielt für den Ertrag der Arbeit in dieser Sphäre.
Eine andere Sache ist es, dass der Bauer – einmal in die Marktwirtschaft versetzt – Einkommen für seinen Lebensunterhalt und für die Ausstattung des Betriebs erwirtschaften muss. Darauf angewiesen, dass seine Produkte möglichst viel Geld abwerfen, konkurriert er mit anderen Produzenten um das zahlungsfähige Bedürfnis, das der Markt hergibt. Und stellt fest, dass er mit seiner Weise des Produzierens denkbar schlecht gerüstet ist für die Ausnützung des Marktes. Als „Selbständiger“ wendet er die Kosten für seinen Betrieb – zu diesen Kosten zählt er mit seiner Familie selbst – in dem Maße auf, wie sie anfallen, also ständig. Die Rückflüsse, von denen er sich als Inhaber des Betriebs auch einen Überschuss erwartet, stellen sich jedoch nur periodisch, in größeren Abständen ein, eben nach Maßgabe des Wachstums, wie es auf dem Feld und im Stall stattfindet. Insofern als und solange wie der Verkauf seiner Produkte an die Zeit gebunden ist, die ihm die Natur diktiert, leidet der Bauer an Geldmangel. In seiner Eigenschaft als Geschäftsmann, der mit eigenem Vermögen wirtschaftet und betriebswirtschaftlich kalkuliert, ist der Bauer Opfer einer schlechten Eigenschaft seiner Produktionsmittel: Sein Betriebskapital schlägt einfach zu langsam um. Und auch mit schnellerem oder mehr Arbeiten steht ihm erst einmal kein Mittel zu Gebote, mit dem er den Markt kontinuierlich versorgen kann, so dass regelmäßige und schnellere Rückflüsse zur Rentabilität seines Eigentums beitragen.
Dabei ist der Umschlag seines Vermögens, auf den sein Geldvorschuss und seine Arbeit berechnet sind, noch nicht einmal eine verlässliche Sache. Sein Produktionsprozess ist bekanntlich den Launen der Natur ausgeliefert. Wenn das Wetter oder Schädlingsbefall seine Ernte beeinträchtigen, gar vernichten, hat der Bauer Geld verausgabt und Arbeit aufgewendet, doch die fälligen Erlöse bleiben aus. Diesem Risiko ist der Landwirt bis auf den heutigen Tag ausgesetzt, was seinen Haushalt erheblich von dem anderer Warenproduzenten unterscheidet. Deren marktübliches Risiko – die Geschichte vom Angebot, das keine Nachfrage findet – teilt er ohnehin. Und zwar ausgerechnet dann, wenn die Natur es mit ihm und seinesgleichen gut meint. Dann wird er von Handel und Industrie im Namen der Verbraucher darauf hingewiesen, dass mit so viel Ware kein Geschäft zu machen ist. Oder nur zu niedrigeren Preisen, was die Rentabilität des „guten Jahres“ schwinden lässt. So wenig die Bauern in der Lage sind, ihren Produktionsprozess so zu steuern, dass er zur Beschleunigung von Rückflüssen taugt, so wenig taugt ihre „Marktmacht“, wenn sie im Besitz einer guten Ernte sind. Die verderbliche Natur ihrer Ware, die – soweit technisch beherrschbar – in Konservierungs- bzw. Lagerkosten umgerechnet wird, fällt ihnen als Anbietern zur Last. Der übliche Ausweg, die Erzeugung umzustellen, schafft da keine Abhilfe. Der Umstieg von Futtergetreide auf Braugerste, von Rinder- auf Schweinezucht usw. macht schließlich die Festlegung auf lange Produktionsperioden, die dem raschen Umschlag entgegenstehen, nicht ungeschehen. In der Ausrufung von „Schweinezyklen“ etc. erfahren Bauern die geringe Tauglichkeit solcher „Flexibilität“ für den Markt.
Als Warenproduzenten, die mit ihren agrarischen Geschäftsartikeln auf lohnende Verkaufserlöse aus sind, befleißigen sich Landwirte derselben Kosten-Nutzen-Rechnung wie Unternehmer in anderen Branchen auch. Dass sie dadurch noch lange keine Kapitalisten sind, wissen sie selbst am besten. Schließlich bearbeiten sie ihr Eigentum selbst. Und kommen davon auch nicht los. Denn der Produktionsprozess, dessen Herr sie sind, versagt ihnen einen entscheidenden Dienst: Er lässt keinen kontinuierlichen Umsatz zu, durch den der Bauer befähigt würde, zumindest über Teile seiner Rückflüsse zu verfügen. Ohne diese aber fehlen ihm flüssige Mittel für die laufenden Kosten und schon gleich Geld für die Finanzierung zusätzlicher Produktion. So verzögert die Dauer des Umschlags in der Landwirtschaft die Wiederverwendung seiner Einkünfte als Geschäftsmittel. Damit sind – umgekehrt ausgedrückt – seiner Bereicherung Grenzen gesetzt, weil es ihm nicht gelingt, nach guter kapitalistischer Manier sein Geld innerhalb derselben Zeit mehrfach gewinnbringend einzusetzen.
Dass sich zögerliche wie verhagelte Einkünfte im bäuerlichen Haushalt als Geldmangel bemerkbar machen, der sich in der mehr oder minder existenzgefährdenden Verschuldung von Höfen niederschlägt, ist bekannt. Offenbar gilt der Landwirt zumindest so weit als Geschäftsmann, dass ihm Kredite gewährt werden. Allerdings verraten die Einrichtung und das Engagement spezieller Institute, die sich über Jahrzehnte der Zahlungsunfähigkeit von Bauern anzunehmen pflegten, dass die Welt des Geldkapitals nicht so ohne weiteres überzeugt ist von den Sicherheiten, die das Eigentum von Bauern darstellt. Und das ist auch gar nicht verwunderlich. Die Notlage eines Borgers, der aus seinem Grund und Boden gerade kein „Kapital schlagen“ kann, unterscheidet eben den Bauern schon wieder von einem Kapitalisten, der geschäftlich erfolgreich war und sich des Kredits zur Beschleunigung seines Umschlags bedient hat – und zum Aufstocken seines Kapitals, um mehr Marktanteile zu erobern, zusätzliche Geldmittel braucht. Ein verschuldeter Hof wirft eben die Frage nach seinem Haltbarkeitsdatum auf.
Dem Staat mögen die ökonomischen Besonderheiten des agrikolen Gewerbes egal sein – die Schwierigkeiten dieses Standes aber hat er von jeher wahrgenommen. Dass die Bewirtschaftung von Grund und Boden durch ihren Besitzer nach den marktwirtschaftlichen Grundrechnungsarten den Landwirt eher schlecht als recht ernährt, dass da massenhaft Ruin statt Bereicherung durch den Markt fällig ist, konnte die Politik nicht übersehen. Und im Interesse an der Funktion des Nährstandes, seiner Leistungen für die Nation, ist die politische Gewalt bis zum heutigen Tage bereit, das „Überleben“ der Agrikultur durch allerlei „Eingriffe in den Markt“ zu regeln. Von den einschlägigen Hilfen können Bauern die Konkurrenz überleben – oder auch nicht.
2. Von der Erweiterung der landwirtschaftlichen Produktion: die Crux mit dem Eigentum
Dass vom Markt mehr zu erlösen ist, wenn man ihm mehr Waren zuführt, ist keine Einsicht, die Kapitalisten für sich gepachtet haben. Jeder Bauer, der sich zusätzliche Flächen kauft oder pachtet, beherzigt dasselbe Rezept. Er ist auch in der Lage, die respektable Größe seines Betriebes, das Ausmaß, in dem er der Nachfrage seine Aufwartung macht, in der Bezifferung seines Umsatzes oder in der gewogenen Menge seiner Produkte anzugeben. Genauso wie Industrielle ihren Umsatz und die Anzahl hergestellter und verkaufter Autos zu Protokoll geben. Wird die Frage nach der Größe jedoch nicht als die nach Geschäftsergebnissen, nach vollzogenen Verkäufen, verstanden, sondern Auskunft darüber verlangt, mit welchen geschäftlichen Potenzen ein Betrieb antritt, ergeben sich garantiert Unterschiede.
Ein Kapitalist wird die Höhe seiner Investitionen benennen, die Standorte aufzählen, an denen diese Gelder – in Produktionsmittel verwandelt – herumstehen; und er wird die Belegschaft, die er sein eigen nennt, also soundso viel Beschäftigte anführen. Mit Letzterem kann der Bauer schon gar nicht aufwarten: Die Auskunft, wie viel Geld er „hineingesteckt“ hat, mag insbesondere bei der Behausung von Viehzeug und den Landmaschinen, die er sich leistet, zur Sprache kommen. Schließlich aber wird er die Produktivkraft, die er kommandiert, in Hektar ausdrücken. (Vom modernen Wahnwitz namens Tierzucht ist hier noch nicht die Rede.) Dass er von der Belegschaft nicht redet, kommt daher, dass er die – samt seiner Familie – selber ist; die bebaute Fläche zeigt an, dass sein Geschäftserfolg einfach damit steht und fällt, wie viel er als Ackerbauer zum Wachsen bringt.
Die Entscheidung zur Bebauung von mehr Land beruht auf einem schlichten Befund: Dem Bauern reicht es nicht, was er mit der Bearbeitung seines eigenen Grundeigentums verdient. Dabei ist es gar nicht von Belang, ob sich die Unzufriedenheit mit der Ertragslage aus privaten Bedürfnissen, z.B. familiären Projekten wie Verbesserung der Wohnverhältnisse, Förderung von Kindern etc., ergibt oder sich der angeschlagenen Bilanz des laufenden Betriebs verdankt, der durch mehr Umsatz wieder rentabel werden soll, weil sonst die Erhaltung des Betriebs als Einkommensquelle in Frage gestellt ist. In jedem Fall muss der expandierende Landwirt seinen Entschluss teuer bezahlen. Denn die Vergrößerung der Anbaufläche kostet Geld, bei geliehenem eben noch Zinsen dazu.
Der zusätzliche Boden, den er nutzen will, befindet sich im Besitz anderer, ist Grundeigentum. Diese ausschließliche Verfügungsmacht ist Geld wert, sie berechtigt den Inhaber des Stücks Erde zur Veräußerung gegen Bezahlung ebenso wie zur zeitweiligen Überlassung gegen Zinsen – das Grundeigentum ist ebenso Wert wie Einkommensquelle, und auf diese schöne kapitalistische Einrichtung trifft der Bauer mit seinem Vorhaben, mehr zu produzieren. Das verändert seine Kalkulation zu seinen Lasten. Der Ankauf von Boden zum handelsüblichen Preis vergrößert den Vorschuss des agrarischen Geschäftsmannes erheblich und konfrontiert ihn mit dem spannenden Problem, ob die gesteigerte Produktion, an die er sich macht, die Kosten lohnend macht. Dieses Kunststück hinzukriegen, ist angesichts der Tatsache, dass der Umschlag seines Vermögens auf dem zusätzlichen Acker auch nicht anders funktioniert als auf seinem bisherigen, gar nicht so einfach. Ein relativer Vorteil mag daraus zu ziehen sein, dass der Bauer den neuen Boden anders nutzt, Früchte anbaut, die zu anderen Zeiten marktfähig sind, so dass der Rückfluss an verfügbarem Geld insgesamt geschäftsdienlicher verläuft. Den Vorteil des Grundeigentums, quasi von selbst als Einkommensquelle zu dienen, hat er allerdings nicht eingekauft.
Denn er nützt den neuen Boden wie sein ursprüngliches Grundeigentum als Produktionsbedingung. Er erhält ihn sich als solche nicht, indem er ihn verarbeitet und nach Maßgabe seines Gebrauchs veräußert, sondern indem er ihn bearbeitet. Mit dem Kaufpreis wie mit dem Pachtzins für Bodenflächen erwirbt er kein fungierendes Produktionsmittel, sondern bloß das Recht, diese unverzichtbaren Bedingungen mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu bewirtschaften. Dass diese Kost für seine Betriebserweiterung ein Tribut an das Grundeigentum ist und bleibt, ist marktwirtschaftliche Regel.[1] Und es ist gar kein Trost für den Bauern, dass selbst Kapitalisten aus Handel und Industrie dieser Tribut nicht erspart bleibt. Denn die haben andere Mittel, diesen Abzug von ihren Erträgen zu verkraften.
Der Bauer jedenfalls hat alle Hände voll zu tun, durch seine Arbeit, von der mit dem Wachstum seines Betriebs mehr anfällt, für mehr Ertrag zu sorgen, damit er sich den Abzug leisten kann.
3. Von der Produktivität und Rentabilität auf dem Lande
Dass sich die Produktion für den Markt nicht nur durch Ausdehnung, sondern auch durch Intensivierung steigern lässt, auch das macht der „Druck des Marktes“ nicht nur industriellen Kapitalisten klar. Die Senkung der Stückkosten, herbeigeführt durch die Anwendung technischer Hilfsmittel, die mehr verkäufliche Produkte in derselben Zeit herzustellen gestatten, ist in der Landwirtschaft ebenso geläufig. Dort ist diese Waffe im Konkurrenzkampf – es geht um mehr Erlös, schnelleren Absatz, billigeren Verkauf in jeder beliebigen Reihenfolge – freilich zugleich die Auseinandersetzung mit den ökonomischen Widrigkeiten von Natur und Grundeigentum.
Die Anwendung der kapitalistischen Rechnung mit den Stückkosten auf die Landwirtschaft ist auch dort nicht ohne Veränderung der Arbeitsmittel zu haben. Wer der Losung „mehr Stück pro Zeit“ bzw. „mehr Ertrag pro Fläche“ folgt, ist damit befasst, den Wirkungsgrad der Arbeit dadurch zu steigern, dass er ihr neue Instrumente an die Hand gibt. Diese Manipulationen am Arbeitsprozess, seinen sachlichen Bedingungen erfordern Investitionen, sind also schon wieder eine Herausforderung an den Haushalt des bäuerlichen Betriebs. Erworben werden chemische Produkte wie Desinfektions- & Wachstumsmittel jeder Art und Maschinen zum Mähen und Melken, auch neuartige Aufbauten für die Viehzucht sowie das passende Futter. Die dazugehörige Arbeit wird erledigt. Mit der Anwendung des Krams lässt die Produktivität nicht lange auf sich warten.
Damit ist freilich eine Rechnung noch offen. Die Abnehmer entscheiden angesichts eines enorm vergrößerten Angebots, welche Waren, Mengen und zu welchen Preisen sie für ihr Geschäft gebrauchen können. Und sie fällen damit das Urteil darüber, ob und für wen sich die Rationalisierung gelohnt hat. Dabei entschärfen staatliche Subventionen, Aufkäufe etc. die Härte des Befundes, den sie in ökonomischer Hinsicht offenbaren und bestätigen: Dieser Aufschwung der Produktivität auf dem Lande ist mit Rentabilität nicht zu verwechseln. Den zirkulierenden Agrarprodukten fehlt eine sehr bedeutsame Ingredienz: Der Preis, den sie auf dem Markt erzielen, bezahlt keinen Überschuss für die Landwirte, die so beflissen ihre Betriebe auf- und umgerüstet haben. Obwohl sie den Ertrag pro Hektar und Stall gründlich gesteigert haben, ist der Gewinn – das Ziel ihrer Investitionen – nicht eingetroffen.
In dem Bemühen, das Mittel der Produktivitätssteigerung, das in der großen Industrie so hervorragende Dienste tut, auf die Landwirtschaft zu übertragen, decken Bauern die letzte ökonomische Unzulänglichkeit ihres Gewerbes auf; einen Mangel, der sie daran hindert, das „Vorbild“ wirklich zu kopieren: In der Kalkulation, die sie praktizieren, fehlt ihnen ein wesentlicher Posten. Dass sie sich, aus Not- wie aus Wendigkeit, dem Markt unterwerfen, um sich der Konkurrenz um Geldeinkommen zu befleißigen, lässt sich nicht abstreiten. Ebenso wenig ist ihnen vorzuwerfen, dass sie in ihrer Beteiligung am Kampf um Mengen und Preise eine Anstrengung unterlassen. Deswegen sind sie auch nicht resignativ, bloß weil ihnen das Institut des Grundeigentums zur Last fällt. Und schon gar nicht konservativ, wenn es im Interesse des Markterfolgs geboten ist, dem natürlichen Wachstum auf die Sprünge zu helfen: Ihrem Drang nach Produktivität verdanken die Ökologen jede Menge Skandale. Im Interesse daran, dass ihre Kosten-Nutzen-Rechnung endlich, weiterhin oder wieder einmal, aufgeht, haben sie den Studenten sogar den Rang im Fach Demonstrieren abgelaufen. Scheitern tut diese ihre Rechnung aber an dem generellen Handikap, dass sie nicht mit Arbeit umgehen können. Erstens in dem Sinn, dass sie das Meiste selber machen, zweitens, dass ihnen beim Stückkosten-Senken deshalb der Kostenfaktor Arbeit einfach fehlt.
Die echte kapitalistische Stückkosten-Gestaltung ergänzt die – ziemlich gigantischen – Investitionen in die hilfreichen Maschinen um die Einsparung an Kosten für Arbeit, was der Produktivitätssteigerung erst den Effekt verleiht, auf den es ankommt. Diese „Kompensation“ für seine Kapitalvorschüsse kennt der Bauer nicht, dieser Posten fehlt ihm für den Erfolg seiner Anstrengungen in Sachen Produktivität. Über diesen Posten verfügt nur der, der mit fremder Arbeit wirtschaftet; der an ihrer Bezahlung spart und ihre Leistung großzügig in Anspruch nimmt – der also über die Quelle von Reichtum verfügt, die wirklich für die Bereicherung anderer taugt.
Weil dem Bauern diese Quelle abgeht, steht es um seine Bereicherung nicht so gut. Vergeblich ist die Produktivität seines Handwerks dennoch nicht – immerhin versorgen immer weniger Leute seines Schlages ganze kapitalistische Nationen, inzwischen grenzüberschreitend, mit preiswerten Lebensmitteln. Und zwar mit so vielen, dass an die Landwirtschaft regelmäßig der Bescheid ergeht, es finde schon wieder zuviel von ihr statt. Was das zahlungsfähige Bedürfnis in unseren kapitalistischen Breiten angeht, stimmt das absolut. Und die armen Leute in aller Welt, die sich nicht einmal die billigsten Delikatessen leisten können, gehen die Bauern – die ja selber ihr Päckchen zu tragen haben – nichts an. Sie produzieren schließlich für den Markt.
4. Vom Fortschritt der Branche
Aus der Geschichte der kapitalistischen Landwirtschaft lassen sich zweifelsohne erhebliche Veränderungen berichten. Die Anstrengungen der Bauern, mit den Schranken fertig zu werden, die ihr Gewerbe einer rentablen Bewirtschaftung von Grund und Boden entgegensetzt, waren nicht vergeblich. Zumal sie in ihrem Überlebenskampf auf Geschäftspartner getroffen sind, die das Interesse an Produktivität und kontinuierlicher Beschickung der Märkte nicht nur angestachelt, sondern auch bedient haben.
Allerdings hat sich in einer – marktwirtschaftlich entscheidenden – Hinsicht doch nicht so viel geändert. Dem Wachstum der Produktion, das auf dem Lande unentwegt veranstaltet wird, entspricht nach wie vor kein Zuwachs der Geldmacht auf Seiten der bäuerlichen Betriebe. Kapital in dem Sinne sammelt sich in der Landwirtschaft nicht an, so dass die volkswirtschaftlichen Statistiken einen rückläufigen Anteil der Landwirtschaft an den Reichtümern der Industrienationen registrieren. Und was die Betriebe angeht, die sich in der Konkurrenz behauptet haben und dem „Höfe-Sterben“ entgangen sind, verzeichnen dieselben Zahlenwerte zwar ein deutliches Wachstum des Betriebsvermögens, aber auch eine miserable Einkommenslage der Betreiber. Die Verdienste der Bauern müssen sich stets einen Vergleich mit denen der Industriearbeiter gefallen lassen – und schneiden noch nicht einmal gegenüber der Einkommensquelle Arbeitskraft gut ab.
Geblieben ist auch die spezielle Betreuung der Bauern durch die öffentliche Hand. In der staatlichen Fürsorge vermischen sich dabei sehr unterschiedliche Gesichtspunkte. Die ständige Einflussnahme auf die Einkommenslagen der agrarischen Produzenten, die diesbezüglichen Korrekturen an den Verdiensten, die der Markt hergibt, gemahnen an soziale Rücksichtnahmen seitens der Hüter des Allgemeinwohls. Andererseits verfolgen die Staatseingriffe unverhohlen das Ziel der Steuerung – Umfang und Art der „Modernisierung“ werden gelenkt, und zwar in Bahnen, die unter denen, die von Landwirtschaft leben, dauernd Opfer hervorrufen. An ihren Leistungen besteht offenbar ein Interesse, das nie so recht mit ihrem marktwirtschaftlichen Bedürfnis nach gesichertem Ein- und Auskommen zusammengeht, so dass die Bauern bei allem Einsatz von Wissenschaft und Technik ihre ökonomischen Probleme einfach nicht loswerden.
Dabei lassen sich die ökonomischen Nöte dieses Standes gar nicht mehr den widrigen Bedingungen zuschreiben, welche die Natur bereithält, wenn ihr Wachstum geschäftsförderlich ausgenützt wird. Durch die Aufbietung aller käuflichen Produktivkräfte hat sich die Landwirtschaft von den diesbezüglichen Schranken fast vollständig emanzipiert, und die staatlichen Bemühungen um die Erhaltung des „Nährstandes“ führen diesen als Posten in der volkswirtschaftlichen Bilanz, der verlässlich in die Rechnungen des Sozialprodukts wie des Staatshaushalts eingeht. Die Leistungen der Bauern sind ein kalkulierter Teil des Marktes; und dass sie mit ihren Kalkulationen nicht zurechtkommen, ist das Resultat von Drangsalen, die ihnen der Markt, d.h. die kapitalistischen Kalkulationen der Abnehmer ihrer Güter und Lieferanten ihrer Hilfsmittel und Maschinen, sowie die politischen Entscheidungen der zuständigen Ministerien bescheren. Die ihnen zugänglich gemachten bzw. verordneten Instrumente, die sie für ihren betriebswirtschaftlichen Erfolg nützen, schlagen in auffälliger Regelmäßigkeit um in Zwänge, die ihre geschäftlichen Partner und politischen Vertreter ausüben. Je mehr sie sich der Produktivkräfte des Kapitals bedienen, desto gründlicher wird ihre Arbeit selbst als eine solche Produktivkraft, die das Kapital mobilisiert, behandelt. Ihr Lebensunterhalt erfreut sich der Berücksichtigung als Kosten, an denen die „Industrienationen“ sparen, so lange sie sie „aufbringen“.
II. Das kapitalistische Geschäft mit dem Bauern
Die Industrien, die die Produkte der Bauern verarbeiten und vermarkten, können sich in Bilanzgröße und Wachstumsziffern mit Multis anderer Sphären durchaus messen; dasselbe gilt für die Produzenten landwirtschaftlicher Technologie sowie für die Chemie- und Pharmakonzerne, die den Bauern das vielfältige Instrumentarium für die Steigerung landwirtschaftlicher Produktivität liefern. Aus der Ernährung der Völker samt allem, was dazu an Vor- und Nachbereitung nötig ist, verfertigen solche Firmen weltmarkttaugliche kapitalistische Gewerbe – allerdings ohne dass der bäuerliche ‚Nährstand‘ daraus einen entsprechenden geschäftlichen Nutzen zieht. Lebensmittelindustrie und Handel machen das Naturprodukt des Bauern erst zur zirkulierenden Ware, zum konsumierbaren Lebensmittel, mit dessen Herstellung und Verkauf auf dem Markt Gewinne erzielt werden. Zwar ist das Produkt der Landwirte für das Geschäft von Handel und Lebensmittelindustrie unverzichtbar; immerhin liefern sie den Rohstoff für all die schönen Sachen, welche die Regale und Kühltruhen der Supermärkte füllen und für die der ‚Verbraucher‘ Geld zahlt. Allerdings eben bloß den Rohstoff für die Konsumgüter, mit denen Nahrungskonzerne und Handelsunternehmen ihr Geschäft machen. Deren Rentabilitätsrechnungen mit diesen Geschäftsartikeln setzen die Bedingungen dafür, was die Resultate der bäuerlichen Produktionsbemühungen taugen. Molkereien und andere Großabnehmer, Futtermittellieferanten und Banken diktieren dem Bauern die Maßnahmen, mit denen er seine Produkte marktgerecht zuzurichten hat, damit sich ihr Kapitaleinsatz in dieser Geschäftssphäre lohnt. So treten ihm heutzutage die elementaren Probleme seiner politischen Ökonomie in Gestalt der Anforderungen entgegen, die seine kapitalkräftigen Geschäftspartner an Preis, Menge, Qualität und kontinuierliche Anlieferung seiner Agrarprodukte stellen.
1. Die Vermarktung
Zwischen Bauernhof und Konsument liegt ein weites Feld. Bis Kälber und Kartoffeln dort hin gelangt und in den Zustand gebracht sind, dass sie an den Endverbraucher verscherbelt werden können, ist Einiges an Aufwand fällig; ein Aufwand, der die Mittel und Möglichkeiten des Bauern bei weitem übersteigt. Das macht aber insofern nichts, als ihm dieser Aufwand von den dafür zuständigen Branchen gerne abgenommen wird. Die Verfahren und Techniken, die Handelskapital und Lebensmittelindustrie zwecks Vermarktung des bäuerlichen Produkts zur Anwendung bringen, ergeben sich keineswegs einfach aus der stofflichen Natur landwirtschaftlicher Produkte. Was auch immer so banale Tätigkeiten wie Transport, Lagerung und Verarbeitung verderblicher Gebrauchswerte technisch erfordern mögen – unter eine kapitalistische Geschäftsrechnung subsumiert gewinnen sie ihre ganz eigene Qualität.
Der Weg zum Kunden ist zunächst einmal eine Sache des zu überbrückenden Raumes. Die Zeiten, wo die Bauersfrau höchstselbst an Markttagen die diversen Produkte des Hofs den Hausfrauen der nächsten Kleinstadt feilbot, sind lange vorbei; heutzutage wird das Produkt der Bauern von Transportunternehmen abgeholt, zwischengelagert und weiter verkauft. Schon diese Dienstleistung ist für eine ordentliche Kapitalanlage gut: Fuhrpark, Lagerhallen und Logistik der Auslieferung sind prächtige Gelegenheiten, mit Kapital einzusteigen, Lohnarbeit anzuwenden und zu akkumulieren. Für den Bauern ist die Verderblichkeit seines Produkts ein unlösbares Problem, das ihn zum Notverkauf zwingt; für Kapitalisten ist dieser Umstand eine Geschäftsgelegenheit. Sie schießen ihr Kapital in Lastwagen, Kühlhäuser etc. vor, mit denen transportiertes und gelagertes Gut für die nötige Zeit gebrauchsfähig gehalten wird, und machen ihre Investition wie jeder andere Gewerbezweig durch den Einsatz bezahlter Arbeit rentabel. Deshalb sind solche Unternehmen auch immer für den technischen Fortschritt aufgeschlossen. Im Dienste der freien und flexiblen Kalkulation mit dem zeit- und preisgerechten Ein- und Verkauf von Naturprodukten investieren sie gerne in den Sachverstand von Lebensmittelchemikern, die mit immer neuen Verfahren dem Gebrauchsgut eine nach oben offene Haltbarkeitsdauer verleihen. Auch chemische Verfahren, welche die Fortsetzung von Reifungsprozessen im Zuge von Transport und Lagerung ermöglichen, leuchten solchen Unternehmen schwer ein, wenn sie sich darum kümmern, den Zeitaufwand für die Bereitstellung der Produkte zu senken und damit den Einsatz ihres Kapitals möglichst kosteneffektiv zu gestalten.
Der Aufwand, der zu treiben ist, um die Rohprodukte des Bauern zu verkäuflichen Lebensmitteln zu verarbeiten und dem Konsumenten zu präsentieren, liegt erst recht außerhalb der Reichweite seines Gewerbes. Hier agieren Großkonzerne, die in verschiedener Zusammensetzung Transport, Verarbeitung und Verkauf in einer Hand zusammenfassen; dort, und nicht bei Privathaushalten, landet zunächst die Masse des bäuerlichen Produkts.[2] Mit großen Kapitalmassen machen sich diese Firmen daran, landwirtschaftliche Erzeugnisse endgültig zum Rohstoff eines industriellen Fertigungsprozesses zu degradieren und unter ausgiebigem Einsatz fließbandmäßig organisierter Arbeit zu neuen Gebrauchswerten umzugestalten. Die Natureigenschaften des Agrarprodukts, die den Umschlag des bäuerlichen Kapitals behindern und ihm das Geschäft erschweren, werden hier zum Gegenstand lebensmittelchemischer Forschung und Technologie – alles zu dem Zwecke, am Rohprodukt alle einem kontinuierlichen Kapitalumschlag hinderlichen Eigenschaften auszuräumen – und zugleich lauter neue Eigenschaften an den Lebensmitteln hervorzubringen, die sie zum Angebot für eine mit Zeit und Geld nicht eben reichlich ausgestattete Kundschaft machen. In Großlabors dürfen sich Lebensmittelchemiker austoben, essbare Stoffe analysieren, separieren und neu zusammenfügen, um daraus dann, ergänzt um allerlei konsistenzsichernde, geschmacksfördernde, haltbarmachende Zusatzstoffe, neue Produkte zu kreieren. Da gibt es viel zu tun; aber nichts, was nicht mit Geld zu bewerkstelligen wäre.
Im Ergebnis ist die bäuerliche Rohware nicht wieder zu erkennen – sie ist unter Einsatz von Naturwissenschaft und Technologie in ein kapitalistisch rentabel erzeugtes Industrieprodukt verwandelt, dessen Gebrauchseigenschaften sich ganz der Kalkulation mit dem geldlichen Aufwand und Ertrag verdanken, dem diese Produktion gehorcht. Wie viel einerseits an Kostenaufwand nötig ist; wie viel andererseits an Aufwand eingespart werden kann; was ohne verkaufsschädliche Behelligung des Produkts an teuren Stoffen ersetzbar ist; was an kostensparenden Modifikationen in Sachen Haltbarkeit, Konsistenz, Geschmack, Ansehnlichkeit, Form usw. machbar ist, was durch technische Fortschritte an markttauglichen, d.h. verkaufsfördernden und rentabilitätsverbessernden Eigenschaften herstellbar ist: Das alles wird ausprobiert und macht aus der Lebensmittelherstellung ein Großexperiment in Sachen gewinnträchtiger Konfektion von Gebrauchseigenschaften. Das schließt bekanntlich des öfteren eine mehr oder minder weitreichende Beschädigung des ‚Nähr‘-Gebrauchswerts ein, führt zu manchen Abstrichen in Sachen Bekömmlichkeit und Genießbarkeit, aber auch zu manchen kompensatorischen Qualitätsfortschritten auf demselben Feld und zu einer nicht zu übersehenden marktorientierten Vervielfältigung der Geschmacks- und Ernährungsgewohnheiten im Gefolge der Vervielfältigung des konkurrierenden Produktangebots. Dass in diesem Procedere die Gebrauchseigenschaften der Nahrungsmittel zur abhängigen Variablen des kapitalistischen Rechnungswesens herabgesetzt werden, ist denn auch niemandem ein Geheimnis – am wenigsten denen, die den Dauertest darauf, was der Volkskörper und was die Zahlungsfähigkeit der Massen verträgt, zu ihrer Geschäftssphäre und Bereicherungsquelle gemacht haben und dabei damit kalkulieren, was die staatliche Aufsicht alles erlaubt oder zulässt. Denn diese bewährte Praxis wird aus gutem Grund vom Staat besonders ausgiebig überwacht und geregelt, weil er die problematischen Folgen des Geschäfts mit den Lebensmitteln für Volksgesundheit und Umwelt kennt und unter Kontrolle halten will, ohne dieses Geschäft über Gebühr einzuschränken. Er schreibt die Bekanntgabe von Verfallsdaten und die Auflistung der Inhaltsstoffe auf jeder Packung vor; in Grenzwerten regelt er den zulässigen, demnach mit der Volksgesundheit verträglichen Grad von Vergiftung und schreitet in machen Fällen auch zu Verboten. Damit ist dem Verbraucherschutz Genüge getan und der Verbraucher selber gefragt. Er darf als – selbstverständlich kritischer – Konsument darüber räsonieren, dass man als Kunde nicht mehr weiß, was man alles isst, und mit seinem Geldbeutel und seinen mehr oder weniger engagierten Preis-Leistungsvergleichen den diversen Kreationen der Lebensmittelchemie zum Erfolg verhelfen. Dabei unterstützen ihn die Hersteller mit Werbung und Produktinformationen, die heftigst den Schein des Genusses pflegen und den Schöpfungen ihrer Geschäftskalkulation das Image eines durch und durch natürlichen und damit gesunden Produkts verpassen. Seien es Herkunftsbezeichnungen, Markennamen, hübsche Bildchen von Kühen und Hühnern oder die Abwesenheit irgendeines nach neuesten Erkenntnissen der Gesundheit oder dem Genuss abträglichen Stoffes, der ansonsten allüberall zu finden ist: Je konsequenter die Lebensmittelindustrie die Gebrauchseigenschaften der Lebensmittel technisch produziert, desto heftiger wirbt sie mit deren ‚Natürlichkeit‘ als Qualitätsmerkmal.[3]
All diese Geschäftszweige folgen den Notwendigkeiten kapitalistischer Akkumulation. Wie jedem anderen Gewerbezweig geht es ihnen um schnellen und kontinuierlichen Umsatz; diesem Zweck verdanken sich die technischen Mittel und Verfahren, die sie zum Einsatz bringen. Transportmittel wollen ausgelastet, Lagerhallen kontinuierlich beschickt und entleert sein; die Regale der Supermärkte wollen kontinuierlich, saisonunabhängig und flexibel gemäß dem Stand der Nachfrage gefüllt sein. Die Anwendung dieser Gesichtspunkte auf Naturprodukte ist für diese Firmen nicht Problem, sondern im Gegenteil steter Anreiz, ihren Ingenieuren und Chemikern neue Aufträge für passende Verfahren zu erteilen. Für den optimalen Einsatz der technischen Mittel ist wie überall die Masse des Kapitals entscheidend. Also schreitet auch in Lebensmittelhandel und -industrie die Konzentration des Kapitals voran. So sind in den letzten Jahrzehnten regionale bzw. produktspezifische Monopole entstanden; inzwischen sind die Firmenlogos der großen Lebensmittelproduzenten und -händler auf Lebensmittel jeder Art europa- oder gleich weltweit zu finden. Die neue Kapitalgröße ist wiederum Grundlage für die räumliche Ausdehnung von Einkaufs- und Liefergebieten.[4] Mit der Größe des Unternehmens wächst auch die Masse Produkt, die es tagtäglich transportiert, verpackt, verarbeitet. So wachsen Lebensmittelfirmen zu Weltmarktgröße heran;[5] und so wird auch der Bauer zum Weltmarktteilnehmer.
Dazu muss er sich noch nicht einmal von seiner Scholle weg bewegen. Als Lieferant einer Industrie, die sein Produkt als Rohstoff einer industriellen Massenproduktion kalkuliert, ist er in deren Kapitalkreislauf einbezogen und unter ihn subsumiert. Der herkömmliche, beschränkte Kreislauf seines Geschäfts, in dem er seine Produkte je nach Jahreszeit und Ernteertrag auf den nächst entfernten Markt trug, ist abgelöst durch einen neuen Kreislauf, in dem sich der Bauer als Zulieferbetrieb zu bewähren hat – nach den Kriterien der Nachfrage, die sein Großkunde ihm präsentiert. Dieser tritt dem Bauern nämlich mehr oder weniger als Monopolist gegenüber und kauft ihm sein Produkt nicht einfach ab: Nach Maßgabe seiner Geschäftsrechnung stellt er Ansprüche an dessen Beschaffenheit. Hier stimmt es einmal, dass der Kunde König ist und der Markt die Produktion diktiert: Weil der Bauer über all die rentabilitätsstiftenden Mittel nicht verfügt, über die seine Abnehmer gebieten, sind sie es, die ihm die Konditionen des Geschäfts vorbuchstabieren. Die Rentabilität ihrer Kapitalanlagen steht und fällt mit der kontinuierlichen und flexiblen Auslastung ihrer Produktionsmittel; also hat der Bauer seine Produktion daraufhin zu orientieren, dass sein Angebot dieser Nachfrage Genüge tut. In der jeweils passenden Menge, termin-, form- und qualitätsgerecht, kontinuierlich und zugleich flexibel hat er genau die Ware abzuliefern, die gerade in die Produktions- und Absatzplanung von Nestlé oder Metro hineinpasst. Dabei darf er nach der Seite des Preises keine Ansprüche stellen, welche die Kostenrechnung seiner Abnehmer allzu sehr belasten. Dass diese Anforderungen einigermaßen widersprüchlich sind, schert die Kunden des Bauern wenig – schließlich sind sie es ja, die ihm den Marktzugang allererst eröffnen. So beschert die Industrie dem Bauern jedes Problem, das sie ihm abnimmt, in neuer Form als Sachzwang des kapitalistischen Rechnungswesens.
2. Die Produktion
Wenn der Bauer den Anforderungen seiner Kundschaft gerecht werden will, kann seine Produktion nicht bleiben, wie sie ist. Die Richtung, in der sie umgewälzt werden muss, steht fest: Als verlässliches Mittel der Belieferung einer kapitalistisch rechnenden Großindustrie – und damit als Einkommensquelle des Bauern – taugt die landwirtschaftliche Produktion nur, wenn ihren eigenen Produktionsvorgängen immer mehr der Charakter eines industriellen Produktionsprozesses verpasst wird. Auch an dieser Front wird der Bauer nicht allein gelassen. Die Nöte, die ihm der Auftrag bereitet, sich entgegen der Spezialität seines Gewerbes wie ein gewöhnlicher industrieller Zulieferer aufzuführen, bilden den Einstieg für weitere Abteilungen des industriellen Kapitals.
Die Branchen, die hier tätig werden, richten ihren Geschäftssinn auf die technische Bewältigung natürlicher Produktionsprozesse. Wie ihre kapitalistischen Kollegen aus der Abteilung ‚Vermarktung‘ leiden auch diese Industrien nicht unter den Restriktionen, denen der Bauer mit seinem Versuch unterliegt, im Kapitalismus Geld zu verdienen. Umgekehrt: Jedes Problem, das er hat, ist eine Geschäftschance für eine Abteilung der Produktionsmittelindustrie. Maschinenbau und Automobilindustrie versorgen ihn mit landwirtschaftlichen Maschinen, die ihn zur produktivitätssteigernden Bebauung immer größerer Flächen befähigen. Mit neuartigen Produktionsanlagen überwinden moderne Agrarbetriebe die Beschränkungen, die Standort, Bodenbeschaffenheit, Jahreszeit, Wetter usw. ihrer Produktion auferlegen. Auch unterstützen diese hilfreichen Geschäftszweige den Bauern darin, sich in seiner Produktion von der Größe der ihm verfügbaren Fläche unabhängig zu machen. Chemieindustrie und Gentechnologie leisten ihren Part mit der Entwicklung von Stoffen und Verfahren, mit denen Erträge gesteigert, Naturprozesse verkürzt oder durch ganz neue ersetzt werden. Mit immer neuen Wachstumshilfen, Bodenzusätzen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Medikamenten verschiedenster Art stellen sie sich ganz in den Dienst des Auftrags, Wachstums- und Reifungsprozesse nicht nur zu beschleunigen, sondern nach Dauer sowie Zeitpunkt des Ertrags soweit wie möglich von natürlichen Gegebenheiten zu emanzipieren.
Die Produktion dieser Techniken liegt gänzlich außerhalb der Reichweite des bäuerlichen Gewerbes; die Ergebnisse stehen ihm als Anwender zur Verfügung, dem es ganz borniert auf den Effekt ankommt. Um den als brauchbares Geschäftsmittel zu würdigen, muss er selbstverständlich die genaue Wirkungsweise der diversen Präparate nicht kennen; erst recht gehen ihn die „Nebenwirkungen“ der diversen Chemikalien- und Hormonbeigaben nichts an, die die Öffentlichkeit in regelmäßigen Abständen als „Preis des technischen Fortschritts“ bzw. „Folge agrarischer Großproduktion“ besorgt zur Kenntnis nimmt. Der Bauer ist bloß der interessierte Abnehmer der diversen Cocktails, die abhängige Variable einer chemisch-biologischen Großproduktion, die sich für sein Gewerbe in dem Maße unverzichtbar macht, wie sich ihr Nutzen für die marktgerechte Zurichtung seines Betriebsablaufs bewährt. Diese Industrie kann sich ihres kontinuierlichen Absatzes und des dazugehörigen Profits deshalb sicher sein: Ohne sie wäre der Bauer gar nicht imstande, den Anforderungen seiner Abnehmer zu genügen. Je härter der Druck der Lebensmittelindustrie auf den Bauern lastet, um so verlässlicher können seine Zulieferer mit ihm als Kunden rechnen. So entwickeln sich diese Unternehmen selbst zu Weltmarktteilnehmern, die auch und gerade in Zeiten gute Gewinne schreiben, in denen die Bauern über rückläufige Einnahmen klagen.[6] Die Forschungsabteilungen dieser besonderen Sorte „global player“ gelten inzwischen bei Freunden wie Gegnern der modernen Agrarwirtschaft als der Hort des agrartechnologischen Fortschritts, und Firmen wie Monsanto präsentieren sich selbst als die eigentlichen Garanten für die zukünftige Ernährung der Menschheit, die die Bauern ja offensichtlich allein so schlecht hin bekommen. Daran ist soviel wahr: Mit ihrem Kampfprogramm um die Erschließung immer neuer Märkte wollen Agrarmultis ihre Chemieprodukte, Gentechnik- und Saatgut-Patente endgültig zum unverzichtbaren Produktionsmittel der Bauern in aller Welt machen – also die gesamte Menschheit in ihrer Ernährung von deren weltweitem Einsatz abhängig machen und daran verdienen.
Mit dem Einsatz von Technik und Chemie wird der Bauer befähigt, seine Produkte nach Qualität, Preis, Menge und Fertigstellungszeitpunkt immer perfekter an die Anforderungen seiner Abnehmer anzupassen. Das Unpassende für kapitalistische Verwendung, das dem bäuerlichen Produkt von Natur aus anhaftet, wird auf diese Weise immer weiter zurückgedrängt; dem Ideal der fabrikmäßigen Herstellung wird immer mehr entsprochen. Das Beschränkte an den bäuerlichen Produktionsanstrengungen wird damit allerdings keineswegs aufgehoben. Am Bauern hängt es nach wie vor, das Kunststück hin zu bekommen, zwischen den Preisen seiner Abnehmer auf der einen Seite und den Preisen seiner Lieferanten auf der anderen Seite Naturprozesse so zu organisieren, dass sie sich nicht nur als verlässliche Mittel der Produktion eines nach Preis und Menge passenden Produkts bewähren, sondern ihm obendrein noch ein halbwegs angemessenes Einkommen sichern. Mit einem trotz allem immer noch mehr oder weniger unkalkulierbaren Naturprodukt hat er sich in die just-in-time-Produktion seiner Abnehmer einzupassen: Das ist der trostlose Rest des Stoffwechsels mit der Natur, der im ganzen großen Kreislauf agrarisch-industrieller Produktion an ihm hängen bleibt und nicht zufällig den Charakter eines fortschreitenden Raubbaus an der Natur annimmt.[7] So und nicht anders, nämlich auf dem höchsten Niveau des technischen Fortschritts, werden biologische Organismen in verkäufliche Produkte verwandelt; der Bauer hat mit den verbliebenen – und in zunehmendem Maße auch mit ganz neuen – Widrigkeiten des Naturanteils der Produktionsprozesse einer Ernährungsindustrie zu kämpfen, die ihn zum Lückenbüßer dafür macht, dass sich das Programm einer rentabilitätsgerechten Steuerung natürlicher Wachstumsprozesse nie vollständig verwirklichen lässt. Hühner in Legebatterien wollen am Leben und legefreudig gehalten werden, Herbizide verhindern nicht, dass es die Ernte verhagelt, auch hormongedoptes Vieh will halbwegs gesund zur Schlachtreife gebracht sein; und wenn die modernen Produktionsmethoden oder die Natur in Gestalt von Krankheiten, Wetter o.ä. zuschlagen, dann ist es immer noch die bäuerliche Geschäftsrechnung, die durcheinander kommt – seine Kunden und Lieferanten haben in ihrem Kapital das Mittel, sich schadlos zu halten bzw. an den Widrigkeiten der bäuerlichen Produktion zu verdienen. Selbst wenn der Bauer solche Fährnisse glücklich bewältigt, ist die Sache keineswegs erledigt. Denn seine Großabnehmer kaufen ihm Überschussmengen nicht einfach ab, sondern drücken die Preise, so dass die mit guten Ergebnissen tendenziell sinkenden Marktpreise es schon wieder fraglich machen, ob seine vergangenen Anstrengungen genügend Geld einbringen, um die Rechnungen der Lieferanten bezahlen und die häuslichen Unkosten decken zu können.
Das also ist das Ergebnis der bäuerlichen Mühen: Von den Notwendigkeiten des Geldverdienens lässt sich der Bauer alle Maßnahmen diktieren, mit denen er die Emanzipation der agrarischen Produktion von der Natur vorantreibt – von seinen Geldsorgen befreit er sich damit nicht. Mehr noch: In dem Maße, wie die Hilfsmittel der Zulieferindustrie zur notwendigen Ausstattung dafür werden, dass der Bauer am Markt, d.h. in der Konkurrenz um die Nachfrage der industriellen Kundschaft besteht, sieht er sich zu stets neuen und größeren Geldvorschüssen genötigt. Zunächst einmal, um überhaupt für die Ausstattung seines Betriebs nach neuestem Stand der Technik zu sorgen; des weiteren, weil sich diese Ausstattung in aller Regel erst dann halbwegs lohnt, wenn mit ihrer Hilfe die Produktion ausgeweitet und der Absatz gesteigert wird. Sein Betrieb muss wachsen, um zu bestehen.[8] Tüchtig, wie die Bauern nun einmal sind, versagen sie sich auch diesem Auftrag nicht.
3. Die Finanzen
Um seine Produktion für den Markt zurecht zu machen, benötigt der Bauer Geld, das er nicht hat. Auch da wird ihm geholfen: Schon wieder ist ein ganzer Geschäftszweig aktiv und nimmt sich der Finanzsorgen der Bauern an. Die Rede ist vom Bankkapital: Das ist wie immer zur Stelle, wenn es gilt, aus dem Geldbedarf anderer ökonomischer Subjekte ein Geschäft zu machen. Und es steht nicht an, auch Bauern in den Umkreis seiner Schuldner einzubeziehen; schließlich handelt es sich bei ihnen um Eigentümer, die in ihrem Grund und Boden über eine werthaltige Sicherheit verfügen. Die bringen sie ein, wenn sie bei der Bank um Kredit nachsuchen. Damit erhält ihr Grund und Boden neben der Funktion als Produktionsmittel die zweite, den Bankkredit abzusichern.[9] Was diese Sicherheit bankmäßig gesehen wert ist, erweist sich allerdings – wie bei jedem anderen Bankschuldner – an der Fähigkeit des Bauern, aus seinem Eigentum einen Ertrag zu schlagen, aus dem sich die Verzinsung bedienen lässt. Der Umstand, dass der Bauer diese Verzinsung nicht wie solventere Kreditnehmer aus einem Überschuss bezahlt, die Zinsen für ihn vielmehr Abzug vom Einkommen sind, ist der Bank selbstverständlich bekannt. Insofern legt sie Wert auf gewisse Beweise für die Fähigkeit des Bauern, ihren Kredit auch zu bedienen, als Bedingung dafür, überhaupt in ein Kreditverhältnis einzutreten.[10] So ist vor jedem ökonomischen Ertrag, den der Bauer erwirtschaftet, auf jeden Fall schon einmal sichergestellt, dass seine Aufwendungen an anderer Stelle kapitalbildend wirken.
Auch mit einer zweiten Abteilung des Finanzkapitals darf der Bauer ausgiebig Bekanntschaft machen: Die Rede ist vom Versicherungsgewerbe. Das hat schon früh in den besonderen Umständen der landwirtschaftlichen Produktion eine lukrative Einnahmequelle entdeckt und bietet dem Bauern an, sich gegen Gebühr gegen nicht zu bewältigende Unbilden der Natur zu versichern. Ob ihm ein eventueller Ernteschaden die sicher zu bezahlende Gebühr für die Hagelversicherung wert ist, darf er selbst entscheiden.
Das Finanzkapital, mit dessen Hilfe der Bauer gegen seine Geldnot angeht, lässt freilich im Endeffekt die bäuerlichen Finanzsorgen nicht geringer werden. Im Gegenteil. Der Kredit für modernere, erweiterte Produktionsanlagen und/oder zusätzliches Pachtland muss mit Zinsen aus den Einkünften bedient werden, die der Bauer mit seinem gewachsenen Absatz erzielt. Dafür, dass das gelingt, hat er mit der Modernisierung seines Betriebs zwar die notwendige, keineswegs aber die hinreichende Bedingung geschaffen. Auf dem Markt sieht er sich mit dem Sachverhalt konfrontiert, dass seine Konkurrenten es ihm gleich getan haben. Die allseitige Erweiterung der Produktion gestattet es den Abnehmern, die Preise zu drücken; so muss mancher Bauer feststellen, dass der Erlös, den er mit seiner gewachsenen Produktenmenge erzielt, die – nun auch noch um Zinszahlungen vermehrten – Kosten seiner Produktion nicht deckt. Dem Finanzkapital fällt damit die Aufgabe zu, unter der Bauernschaft zu sortieren. An der Höhe der Verschuldung und am Stand der Kreditbedienung ermitteln die Banken, über welche Höfe endgültig das Urteil zu fällen ist, dass sie in der Konkurrenz nicht bestehen können; solchen Betrieben wird der Kredit gestrichen und ihre Existenz damit beendet. Anderen wird durch Kreditverlängerung eine Gnadenfrist eingeräumt. Dritten kann mit neuem Kredit zu weiteren Produktions- und Markterfolgen verholfen werden. So tut das Bankkapital das Seine dazu, dass die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktionssphäre als Nebeneinander von Höfesterben, Ausweitung der Betriebsgrößen der verbleibenden Betriebe und wachsender Verschuldung der Bauernschaft insgesamt abläuft.[11]
4. Bäuerliche Anpassungskünste – kein Mittel gegen den Ruin
Die Mitglieder der Bauernschaft sehen zu, dass sie sich dieser Sachlage akkommodieren. Die wenigsten arbeiten sich zu Eigentümern technisch bestens ausgerüsteter landwirtschaftlicher Produktionsstätten vor, in denen sie auf eigene Rechnung quasi industriell ein Stück landwirtschaftlichen Produktionsprozesses abwickeln – bei entsprechender Betriebsgröße lohnt sich dann sogar der mehr oder weniger dauerhafte Einsatz von Lohnarbeitern.[12] Mehr verbreitet ist die Praxis, sich in eine neue Sorte Verlagssystem einzufügen, in dem die Bauern als unmittelbare Zulieferanten für Lebensmittelkonzerne fungieren.[13] Sie produzieren auf Vorgabe der Abnehmer, werden regelmäßig bezahlt und liefern bei Fertigstellung; das „unternehmerische Risiko“ bleibt ihnen selbstverständlich erhalten. Dritte wiederum leisten es sich, ihren Hof als „Nebenerwerbsstelle“ zu halten – wobei von „neben“ höchstens nach der Seite des Einkommens, keineswegs aber nach der Seite der anfallenden Arbeit die Rede sein kann.
Auch fehlt es nicht an Versuchen, auf die eine oder andere Weise der „Marktmacht“ zu entkommen, mit der sich die Bauern in Gestalt der Liefer- und Abnehmerindustrien konfrontiert sehen. Bauern haben sich schon früh in Genossenschaften organisiert. Diese bezwecken, mit kollektiv beschafften Maschinenparks die Anschaffungskosten für landwirtschaftliche Produktionsmittel für den einzelnen Hof bezahlbar zu halten; sie kaufen Düngemittel, Saatgut etc. als Großabnehmer ein, die bessere Preise aushandeln können, und fungieren als Sammelstellen und kollektive Verkäufer der Produkte der Genossenschaftsmitglieder. Mit der zunehmenden Zentralisierung dieser Funktionen in ihrer Hand haben sich die Genossenschaften inzwischen selbst als Lieferanten und Zwischenhändler gegenüber den Bauern auf der einen Seite und der eigentlichen Industrie auf der anderen Seite etabliert; manche haben sich zu Verarbeitungsbetrieben weiter entwickelt. Dem einzelnen Bauern treten sie heutzutage selber in der Rolle des Handelskapitals gegenüber, das ihm Kauf- und Verkaufspreise diktiert. So ist es nur konsequent, dass sich viele Genossenschaften als Aktiengesellschaft organisieren, die zwar noch die Bauern als Anteilseigner kennen, aber ihren Kredit wie reguläre Kapitalisten auf ein Geschäft ziehen, das sich lohnt.
Bleibt noch die Nische, in der sich ein kleiner Teil der Bauernschaft einzurichten sucht: das Geschäft mit dem Luxuskonsum von Lebensmitteln. Die Existenz eines solchen eigenen „Marktsegments“, das heutzutage unter Titeln wie „Direktvermarktung“, „Zurück zur Natur!“ oder „ökologischer Landbau“ läuft, wirft nur ein weiteres Licht auf die großzügige Art und Weise, in der die kapitalistische Lebensmittelproduktion die Ernährung der Volksmassen erledigt: Für Leute, die Zeit und Geld genug haben, lassen sich durchaus bessere und – jedenfalls dem Qualitätssiegel nach – gesündere Lebensmittel produzieren als die Konsumgüter, die für das gemeine Volk vorgesehen sind. Das wird darüber nicht vergessen: Schließlich stellen die vielen Verbraucher mit ihrem durch die einschlägigen Skandale geförderten Interesse an ‚gesunder Kost‘ ein nicht zu verachtendes ‚Kundenpotential‘ dar für eine wachsende neue Geschäftssphäre, in der alles „Bio“ ist. Auf diese Weise profitiert die Agrarindustrie noch von den negativen Wirkungen auf das Vertrauen der Konsumenten, die ihr gewöhnliches Produzieren zeitigt.
Der Bauer mag sich drehen und wenden, wie er will – um seine Geldnot zu überwinden, hat die Marktwirtschaft kein taugliches Angebot zu machen. Der Bauernstand muss daran allerdings nicht scheitern: Um seinen Fortbestand kümmert sich die Politik.
III. Das politische Geschäft mit den Bauern
Weil der Bauernstand, der nützliche Dienste für das nationale Kapitalwachstum leistet, selbst auf keinen grünen Zweig kommt, mischt sich der Staat ein. Er betreut den schwierigen Stand dauerhaft, um diese Dienste zu sichern, und anerkennt damit praktisch, dass es sich da um einen ökonomischen Ausnahmefall handelt, um eine Branche, die einerseits nötig, andererseits in ihrer Gesamtheit nicht in der Lage ist, „aus eigener Kraft“ die verlangte Rolle in der Marktwirtschaft zu spielen.[14]
Die elementare Leistung, um die es dem Staat zunächst einmal zu tun ist, ist die Sicherung der nationalen Ernährungsbasis. Dass die dafür zuständige Landwirtschaft Grundlage und Quelle jeder Industrie ist, drücken Wirtschaftspolitiker aus, wenn sie die geringe Zahl der noch in der Landwirtschaft tätigen Arbeitskräfte als einen Erfolg der Entwicklung ihrer Industrienation anführen: So weit ist der Reichtum der Nation schon über seine agrarische Grundlage hinausgekommen; zu dem Luxus einer agrarischen Überproduktion, die dann gesteuert und gedrosselt sein will, muss es ein Land eben erst einmal bringen. Um die Nahrungsgrundlage der Nation kümmert sich der kapitalistische Staat in der Weise, dass er sich ums Einkommen der Bauern kümmert. Die Sicherung der Volksernährung geht auf in dem höheren Ziel, die Bauernwirtschaft soweit überlebensfähig zu halten, wie sie als Grundlage des profitablen Geschäfts mit ihr gebraucht wird. Für ihre Rolle als Standortfaktor sollen genügend Bauern in der Konkurrenz bestehen können. Der Beitrag des Staates zum Funktionieren seiner agrarischen Basis sieht daher glatt aus wie eine Förderung der Bauern. Und so viel stimmt daran ja: Nur mit öffentlichen Zuschüssen verdienen genügend Bauern ein Einkommen, das sie befähigt, ihr Bemühen, durch die Produktion von Nahrungsmitteln Geld zu verdienen, fortzusetzen.
1. Der europaweite Agrarmarkt zwingt eine rückständige Branche zur „Modernisierung“.
Die notwendige Betreuung der Landwirtschaft organisieren
die Gründungsmitglieder der EU gemeinsam. Für ihr
Projekt, zu einer mit den USA konkurrenzfähigen
Wirtschaftsmacht aufzusteigen, finden sie eine
zuverlässige Grundversorgung ihrer Länder mit
industriellen Grundstoffen sowie mit Nahrungsmitteln
unverzichtbar und richten beides in europäischem Maßstab
ein: die Montanunion für Kohle und Stahl, den gemeinsamen
Agrarmarkt für die Sicherung der Ernährungsbasis. In
Bezug auf diese Basis sehen sich die europäischen
Industrienationen, die nach dem zweiten Weltkrieg neu
loslegen wollen, schlecht gerüstet. Die Sorge aller
Regierungen gilt einer wenig leistungsfähigen, in ihren
Augen „rückständigen“ Branche: In allen EWG-Ländern sind
erstens die Bauern arm; zweitens ist ihre Leistung
keineswegs gesichert, zuviel Regen oder Dürre oder der
Kartoffelkäfer können noch zu Versorgungsengpässen
führen. Und drittens brauchen die Bauern für ihre
schwache Leistung überall staatliche Beihilfen und
belasten die Staatshaushalte. Dass diese Ärgernisse ihre
Ursache in den politökonomischen Besonderheiten der
Sphäre, nämlich ihrer schlechten Eignung für den
kapitalistischen Gelderwerb haben, kümmert die nationalen
Hüter dieses Erwerbs naturgemäß nicht – Befassung mit den
Ursachen würde dem praktischen Herangehen auch gar nichts
nützen, um das es ihnen geht. Sie subsumieren alles, was
ihnen an der Bauernwirtschaft unzureichend vorkommt,
unter ihre Diagnose der Rückständigkeit – und fordern
Entwicklung. Von der Einrichtung des alle nationalen
Märkte umfassenden gemeinsamen Agrarmarkts versprechen
sie sich nicht nur eine Verbesserung der
Versorgungssicherheit – reichliche und dürftige Ernten
gleichen sich im großen Verbund besser aus –, sondern
eine Mobilisierung des ganzen Sektors. Von der soll
außerdem noch eine weitere Wirkung ausgehen – wie sie,
wie stets bei der Gründung der EU, ein Blick auf die USA
belehrt: Die höhere Produktivität der Landwirtschaft beim
großen Konkurrenten senkt die Lebensmittelpreise und
entfaltet wohltätige Wirkungen auf Inflationsrate und
Lohnkosten. Ihrem gemeinsamen Agrarmarkt verordnen sie in
Artikel 39 der Römischen Verträge ein komplexes Bündel
von Zielen: Er soll die Produktivität der
Landwirtschaft steigern
, das Pro-Kopf-Einkommen
der Bauern anheben und ihnen eine angemessene
Lebenshaltung gewährleisten, Märkte stabilisieren, die
Versorgung und die Belieferung der Verbraucher zu
angemessenen Preisen sicherstellen.
Preiswerte
Lebensmittel für die Kunden und ordentliche Einkommen für
die Bauern, gesicherte Versorgung und garantierte
Qualität – das alles zusammen ist ein bisschen viel auf
einmal. Für die harmonische Verwirklichung aller dieser
agrarpolitischen Ziele setzt man auf die Schlüsselgröße:
die Steigerung der Produktivität. Sie soll der
europaweite Markt ohne innere Grenzen, dafür mit hohen
Zollschranken nach außen, ebenso erzwingen wie
ermöglichen.
Dieser Markt ist ein Angebot an den Handel und das Lebensmittelkapital, ihre Produkte europaweit zu vermarkten und überall den lokalen Produzenten und Verarbeitern Konkurrenz zu machen; er ist zugleich ein Angebot an sie, sich die Rohstofflieferanten im gesamten EU-Raum zu suchen. Bäuerliche Betriebe, die nach gesicherter Lieferfähigkeit, Qualität, Menge und Preis den Anforderungen der industriellen Abnehmer entsprechen können, werden vom beschränkten Aufnahmevermögen lokaler und nationaler Märkte befreit und können wachsen; für andere, die diesem Maßstab nicht oder vergleichsweise zu wenig genügen, gilt die andere Seite des damaligen und noch immer gültigen Mottos der europäischen Landwirtschaftspolitik: Wachsen oder Weichen! So werden die Bauern, die ja gar nicht ans Ausland verkaufen, sondern die nächste Molkerei, Mühle, Zuckerfabrik oder Raiffeisen-Genossenschaft beliefern, in einen europaweiten Produktivitätsvergleich gezogen, in dem sie die Konkurrenzfähigkeit ihrer Produkte, Produktionsmethoden, Hofgrößen und technischen Ausrüstungen zu beweisen haben.
Der erwarteten und erwünschten Preiskonkurrenz nach unten ziehen Europas Agrarpolitiker eine Schranke ein. Die Marktordnung sieht „Interventionspreise“ vor, unter denen kein Bauer seine Ernte verkaufen muss; denn zu diesen Preisen nimmt ihm die europäische Kommission das Zeug ab. Das Niveau dieser Preise, auf das sich die zuständigen Minister jährlich zu einigen haben, berücksichtigt nicht nur, dass für die Sicherung der europäischen Lebensmittelbasis in der gesamten EU genügend Bauern überleben müssen, sondern dass jedes der Mitgliedsländer seine nationale Landwirtschaft mit Hilfe des großen Marktes entwickeln und als Wirtschaftsfaktor nicht nur erhalten, sondern zu Wachstum bringen will. Gemeinsam zielt ihr großer Markt auf die Senkung der Lebensmittelpreise und die Verringerung der relativen Größe der Landwirtschaft an der europäischen Ökonomie. Für sich sucht jedes Mitgliedsland vom europäischen Agrargeschäft einen möglichst großen Teil zu sichern – was im Übrigen ganz und gar nicht dasselbe ist wie das Ziel, möglichst viele Bauern zu erhalten, auch wenn die Landwirtschaftsminister dem Publikum diese Verwechslung nahe legen, wenn sie ihr wohltätiges Wirken in Brüssel daheim erläutern. Jedenfalls einigen sie sich in den ersten Jahrzehnten auf Interventionspreise, zu denen in allen in Bezug auf Klima, Mechanisierung und Betriebsgrößen sehr unterschiedlichen Ländern für die nationale Kalkulation hinreichend viele bäuerliche Betriebe bestehen können – selbstverständlich unterschiedlich gut in den verschiedenen Ländern.
Für die Bauern ist der Interventionspreis, der eigentlich nur als Sicherheitsnetz gegen allzu stark fallende Marktpreise zum Einsatz kommen sollte, das entscheidende Datum ihrer Kalkulation: Sie müssen Gestehungspreise erzielen, mit denen sie auch zum staatlichen Mindestpreis noch verdienen können; wer dem Zwang zu diesem Produktivitätsniveau nicht entsprechen kann, muss aufgeben. Andererseits bringt der Mindestpreis einige Sicherheit in die bäuerliche Kalkulation: Er wird garantiert gezahlt, und zwar für so viel Produkt, wie der Betrieb herzustellen fähig ist. Auf seiner Basis kann der Bauer den Finanzaufwand für eine Steigerung seiner Produktivität und ihre Wirkung auf sein Einkommen kalkulieren und sich leisten, was er sich leisten muss: Investieren, vermehrt Kapital einsetzen, sich verschulden, um konkurrenzfähiger zu werden. Denn der Garantiepreis stellt sicher, dass eine steigende Produktivität der Arbeit, also ein wachsendes Produkt auch zu mehr Einkommen führt und sich nicht gleich in einem sinkenden Verkaufspreis rächt.
2. Der Erfolg des Agrarmarkts und der Kampf gegen Überschüsse
Die beabsichtigte Wirkung der Marktordnung lässt nicht lange auf sich warten: Die Landwirtschaft wird immer produktiver; die Hofgrößen steigen; die Zahl der in der Landwirtschaft tätigen Personen nimmt ab; die produzierten Mengen steigen, und die Marktpreise sinken generell auf das Niveau der Interventionspreise. Versorgungsprobleme, wo es sie noch gegeben hat, verschwinden, Industrie und Handel machen mit dem agrarischen Produkt und seinen regulierten Preisen ihre Geschäfte.
Der Erfolg schlägt sich bei der Europäischen Kommission als stetige Verteuerung der Agrarpolitik nieder. Die steigende Produktivität resultiert in wachsenden Mengen agrarischen Produkts, das durch die Garantiepreise ja ohne Rücksicht auf das Fassungsvermögen des Marktes vermehrt wird. Der Logik der administrierten Preise zufolge landet das Mehrprodukt, das keinen Markt findet, bei den Interventionsstellen. Die Trennung des Preises von der Marktlage ist die gewollte Leistung dieser Garantie; ihre Kehrseite sind die Überschüsse, die „Brüssel“ aufkaufen und verwalten muss. Das strapaziert den Haushalt der Kommission doppelt: Erst werden Mittel aufgewendet, um den Bauern ihr Überangebot abzukaufen, und dann um die diversen „Butterberge“, „Milchseen“ und andere Interventionsbestände, die den Charakter von Nahrungsmittelreserven längst überschreiten, zu kühlen und zu lagern; denn weggeschmissen wird erst einmal nichts, und wenn doch, dann ist noch nicht einmal das umsonst zu haben.
Der Fortschritt der landwirtschaftlichen Produktivität erlaubt und erfordert die periodische Reform der Marktordnung. Seit 1992 senkt die Kommission ihre Garantiepreise und setzt neue Schranken der mindesten Produktivität, die die Höfe erreichen müssen. Die Senkung der Interventionspreise verbilligt erstens die Kosten der Intervention; sie führt zweitens zur Senkung der Marktpreise, also der Einkaufspreise der Lebensmittelindustrie, und schließlich zur Senkung der Verkaufspreise, die der Konsument bezahlt, – mit wohltuender Wirkung auf die Berechnung des Warenkorbs und der Inflationsrate. Das dritte Ziel, durch Senkung der Interventionspreise auch die Überschussmengen zu reduzieren, die die Marktordnungsbehörde ankaufen muss, wird dagegen in der Regel verfehlt. Zwar scheitern Höfe an der neuen Preisschranke und geben ihre Produktion auf. Die anderen aber sehen zu, den Einkommensverlust, den sie hinnehmen müssen, durch Mengenausweitung wett zu machen, und das nicht nur auf eigenen Flächen, sondern zusätzlich auf solchen, die andere aufgeben. Jede Preissenkung leitet eine neue Runde von Produktivitätssteigerung, Überschussproduktion und einer weiteren Senkung der Stützpreise ein. So bekommen die Bauern die Konkurrenz wieder zu spüren, deren ruinöse Folgen die Marktintervention gebremst hatte: Der Druck ihres Überangebots wirkt nun über die Neufestsetzung der politischen Preise. Immer wieder nimmt „Brüssel“ den Bauern ihren Fortschritt wieder weg und lässt sie trotz aller Produktivitätssteigerung in einer so prekären Einkommenssituation zurück wie eh und je.
Zugleich moderiert die Kommission das Höfesterben, das sie auslöst. Betriebsaufgaben sind erwünscht; 2%-3% pro Jahr sind fest eingeplant. Sie sollen das Wachstum der erfolgreichen Höfe begleiten und ermöglichen. Der Prozess soll aber kontinuierlich und „sozial verträglich“ ablaufen. Daher wird die Absenkung der garantierten Preise um Techniken der Mengenbegrenzung ergänzt, die Überschüsse reduzieren, ohne in demselben Maß die Einkommen der Bauern zu senken. Für Milch wird jedem Hof nach Größe und Produktionskapazität eine Quote zugewiesen, über die hinaus er nicht produzieren darf. Das Wachstum der Feldfrüchte begrenzt die Kommission durch „Flächenstilllegung“; sie bezahlt den Bauern Prämien dafür, dass sie nichts anbauen. Natürlich beschränkt die politisch verordnete und mit Geld angereizte Mengenbegrenzung die zugleich erwünschte Wirkung der Produktivität als Waffe der Konkurrenz zwischen den Höfen und als Hebel des Wachstums der erfolgreichen. Milchquoten und Flächenstilllegungen gelten als Notbehelf, den weitere Reformen des Agrarmarkts wieder abschaffen sollen.
Auf der anderen Seite entwickelt die Kommission Wege, die allfälligen Überschüsse zu verwerten, um die Kosten ihrer Markt-Intervention zu senken. Man hat es wohl als einen Index des agrarischen Fortschritts zu verstehen, dass eingelagerte Lebensmittel denaturiert, d.h. zu spottbilligen industriellen Rohstoffen verarbeitet werden, um ihnen irgendeinen Markt zu schaffen und wenigstens etwas Geld in die Brüsseler Kasse zu bringen: Butter und tierische Fette werden zu Schmiermitteln, Wein zu technischen Alkoholen verarbeitet. Daneben subventioniert die EU schon beim Anbau die Umstellung von der Lebensmittel- auf „Non-Food“-Produktion, etwa auf Raps für Bio-Diesel. Die landwirtschaftlichen Hauptprodukte aus ihren Interventionsbeständen, Getreide und Rindfleisch, setzt die Kommission auf dem Weltmarkt ab. So werden Überschüsse des heimischen Marktes immerhin zu Geld gemacht und Interventionskosten gesenkt. Den Verlust, der entsteht, wenn sie die zu Interventionspreisen angekaufte Ware zu den viel niedrigeren Weltmarktpreisen wieder verkauft, verbucht sie schon wieder als Kosten, die für Exportförderung aufgewendet werden müssen. Diese Lösung des Überschuss-Problems aber schafft neue Probleme. Alle großen Agrarnationen machen das so; und das sind bis auf wenige Ausnahmen zugleich die großen Industrienationen, allen voran USA und EU. Bei den industriellen Weltmächten gibt es erstens Kapital, das auf die Leistungen einer einheimischen Landwirtschaft angewiesen ist und mit ihnen geschäftlich etwas anfangen kann; bei ihnen gibt es zweitens einen Staat, der bestrebt ist, aus der Landwirtschaft einen seinem Industriekapitalismus entsprechenden Teil der Nationalökonomie zu machen, und der daher mit seinen Hilfen und Vorgaben dafür sorgt, dass in dieser Sphäre die Produktivität vorangetrieben wird, so dass sie schließlich das Weltniveau agrarischer Produktivität vorgibt und zugleich damit eben die vielen Überschüsse produziert, die der nationale Markt nicht ‚aufnehmen‘ kann. Die großen Agrarexportnationen haben also sowohl Grund wie Mittel, diese überschüssigen Mengen auf den Weltmarkt zu werfen, kommen sich dadurch aber mit ihren subventionierten Exportpreisen in die Quere und verderben einander das Preisniveau. Ihr Subventionswettlauf verteuert überall die Agrarpolitik und heizt die handelspolitischen Gegensätze zwischen ihnen an.
3. „Agenda 2000“ – die sogenannte „Wende in der Agrarpolitik“
Im neuen Jahrhundert kämpft die EU-Landwirtschaftspolitik mit einer ganzen Reihe von neuen Herausforderungen: mit der BSE-Krise, mit anderen Tierseuchen und Lebensmittelskandalen; mit den hohen Kosten der Agrarpolitik, die noch immer fast die Hälfte des Brüsseler Haushalts verschlingt und wenig Geld übrig lässt für Forschung und Entwicklung, für den Ausbau der transeuropäischen Netze und anderes, was die EU bis 2010 zum wachstumsstärksten Wirtschaftsraum der Welt machen soll. Verschärft wird der Gesichtspunkt der Kosten durch den anstehenden Beitritt der agrarlastigen und armen Länder Mittel- und Osteuropas. Zu guter Letzt haben die Maßnahmen und Regelungen der Agrarpolitik auch noch den handelspolitischen Zielen der Union zu genügen, d.h. sie sollen geeignet sein, im Rahmen der WTO-Diplomatie fremden Protektionismus abzuwehren und europäischen Exporten, industriellen wie agrarischen, den Weg zu ebnen.
Die Liste neuer Probleme bilanziert zunächst den Erfolg der europäischen Agrarpolitik: Von Versorgungssicherheit, aber auch von Produktivitätsförderung und Hofgrößen ist keine Rede mehr. Routinemäßig senkt die Runde der Agrarminister das Niveau der Stützpreise, die langsam auf dem der Weltmarktpreise zu liegen kommen, und nimmt wichtige Agrarprodukte ganz aus der Intervention heraus. Die entscheidende Minderheit der Betriebe, die das Gros des landwirtschaftlichen Produkts liefert, hat offenbar das Produktivitätsniveau der USA, Australiens etc. in etwa erreicht. Nach Ansicht der Kommission brauchen diese Betriebe keine Anreize und Hilfen mehr, um ihre Produktivität weiter zu steigern. Die Mehrheit der Kleinbauern und Nebenerwerbslandwirte aber ist abgehängt; ihre Arbeit wird für das europäische Geschäft mit Lebensmitteln nicht mehr benötigt, ihre Produktivität muss und soll nicht weiter staatlich gefördert werden. Auf Basis des Erfolgs wendet sich die Politik in doppeltem Sinn dem Preis zu, den er kostet: Man fragt, ob sich Europa noch so viele Bauern und noch so viel staatliche Ausgaben für die Bauern leisten muss wie früher. Und die EU-Agrarpolitiker machen sich daran, die Instrumente der Landwirtschaftspolitik für eine Korrektur der unerwünschten Nebenwirkungen der bäuerlichen Produktivität zu verwenden, die immer groteskere Ausmaße annehmen.
Die Scheidung in wachstumsfähige Agrarfabriken und ruinierte Kleinbauern ist fertig – Marktordnung und ländliche Sozialhilfe werden getrennt
In diesem Sinne nehmen sie eine grundsätzliche Änderung der Subventionspraxis in Angriff. Einen Teil der Finanzmittel, die früher für die Stützung der Lebensmittelpreise aufgewendet wurden, bekommen die Bauern als „Kompensation für Einkommensverluste durch Preissenkungen“ in der Form von „produktionsunabhängigen Direktzahlungen“ gewährt, die sich an der bewirtschafteten Fläche eines Betriebs und am mittleren Hektarertrag seiner Region orientieren. Auf diese Weise beziehen die Bauern – große wie kleine – nach wie vor mehr als die Hälfte ihres Einkommens nicht über den Markt, sondern aus dem Staatshaushalt; aber eben nicht mehr in der Weise, dass ihr Produkt politisch verteuert wird und sie Überschüsse produzieren müssen, um sich diesen Einkommensteil anzueignen. Sie bekommen das Geld ohne Leistung; in ihrer Produktion aber dürfen und müssen sie sich daran ausrichten, was auf dem Markt welchen Preis bringt. Für die europäische Obrigkeit sinkt dadurch der Aufwand für die Landwirtschaftspolitik beträchtlich; was Agrarkommissar Fischler so auszudrücken beliebt, dass der Nutzeffekt der aufgewendeten Finanzmittel beträchtlich steige, weil die Subventionen „gezielter“ eingesetzt würden und „den Bauern direkt zugute“ kämen.[15]
Aber dabei bleibt es nicht. Fischler fordert von den
Mitgliedsländern, von 2002 an schrittweise die
Agrarbeihilfen für Großbetriebe zu kürzen
und
freiwerdende Mittel für neue
landwirtschaftspolitische und soziale Zielsetzungen
zu verwenden – „Modulation“ heißt das in der Amtssprache
der EU. Demnach brauchen die Großbetriebe diese Hilfen
nicht mehr; sie können auf dem Niveau der Weltmarktpreise
Geld verdienen. Ihnen will Fischler nur noch ein
Sicherheitsnetz für katastrophale Markteinbrüche knüpfen.
Den Kleinbauern und Nebenerwerbslandwirten aber ist mit
Preisstützung auf diesem Niveau und mit Direktzahlungen
gar nicht mehr zu helfen; denn sie leben schon nicht mehr
wirklich von ihrem Betrieb.[16] Ihnen wäre nach Ansicht des
Kommissars mit richtigen Arbeitsplätzen bei richtigen
Kapitalisten mehr geholfen oder mit Zuschüssen zum Aufbau
von ein bisschen Tourismus, Fremdenzimmern, Golfplätzen,
mit Bezahlung für Landschaftspflege und Naturschutz oder
mit einer Art Sozialhilfe. Im Blick auf die wachsende
ländliche Überschussbevölkerung will er – in
Kofinanzierung mit den Mitgliedstaaten – Förderprogramme
für die „Entwicklung des ländlichen Raumes“ auflegen, die
mit Landwirtschaft nicht mehr viel zu tun haben.
Verbote und neue Anreize: Marktwirtschaftliche Instrumente gewährleisten Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und Verbraucherschutz
Angesichts der erreichten internationalen Konkurrenzfähigkeit geraten sogar bei Agrarpolitikern die seit Jahrzehnten bekannten ‚Nebenwirkungen‘ der politisch geförderten Produktivität in die Kritik. Was sie beklagen, sind die Wirkungen genau der kapitalistischen Effizienz, die sie fordern und fördern; Wirkungen einer Produktivität, die ihr Maß in der Differenz von Geldvorschuss und Geldertrag hat. In der Betriebswirtschaft des Bauern ist es eben rational, Böden zu überdüngen und dadurch Grundwasser und Flüsse zu ruinieren, preisgünstige Schädlingsbekämpfungsmittel einzusetzen, die das Produkt vergiften, Vieh in Massenhaltung zu züchten, die die Ausbreitung von Seuchen erleichtert usw. Am Schluss löst BSE, die durch Methoden der Rindermast erzeugte Tierseuche, die eine neuartige tödliche Volkskrankheit auszulösen droht, das berühmte Umdenken aus, das keines ist. Immerhin ruft die Sorge um die Volksgesundheit den europäischen Gesetzgeber auf den Plan; nicht weniger freilich die ebenso gewichtige Sorge um das Geschäft, besonders das Exportgeschäft der Fleischbranche, das zusammenbricht, sobald das Auftreten von BSE in einem europäischen Mitgliedsland nicht mehr zu verheimlichen ist. Unter dem Vorzeichen von Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz zieht die Politik neue Grenzen zwischen erlaubten und verbotenen Hebeln der Produktivität – nicht nur bei der Rindermast und dem Tiermehl.
Die haarkleinen gesetzlichen Vorschriften darüber, welche Stoffe, Hormone, Antibiotika in welchen Mengen dem Futter zugesetzt werden dürfen, wie viel Recht auf Lebensraum eine Legehenne, ein Schwein etc. hat, wie breit die Spalten im Boden des automatisch gespülten Stalles sein dürfen, dokumentieren nicht nur, was da alles üblich ist; sie anerkennen und billigen diese Praxis, wenn sie sie rechtlich regulieren, Grenzwerte erlassen, erlaubte und geduldete Inhaltsstoffe auflisten: Diesseits des ausdrücklich Verbotenen ist alles „gute fachliche Praxis“. Dabei beseitigt ein Verbot selbstverständlich nicht den betriebswirtschaftlichen Grund, aus dem die bedenklichen Mittel eingesetzt werden. Das Recht droht lediglich für den Fall einer entdeckten Übertretung Sanktionen an und nötigt den Bauern, den sicheren geschäftlichen Nutzen unerlaubter Mittel seiner Produktivität gegen den möglichen Eigentumsschaden durch eine Bestrafung abzuwägen. Darüber hinaus drängt es ihn, Phantasie und Arbeit aufzuwenden, um sicherzustellen, dass Gesetzesverstöße, wenn schon nötig, wenigstens nicht nachweisbar sind.
Besonders schön demonstriert diesen Zynismus des Rechts die neue Gesetzgebung zum Anbau gen-veränderter Pflanzen. Ein Gesetz braucht es überhaupt nur, weil Unverträglichkeiten dieser Pflanzen für den menschlichen Organismus und Risiken für Flora und Fauna bei ihrer Ausbringung zu befürchten sind. Deswegen wird ihr Anbau in der freiheitlichen Landwirtschaft aber noch lange nicht unterbunden. Da ist der Verbraucher für seine Gesundheit selbst verantwortlich; sein Recht beschränkt sich darauf, vom Hersteller über die Verarbeitung von Gen-Mais und ähnlichem auf der Verpackung unterrichtet zu werden. Einen regelungsbedürftigen Konflikt sieht der Rechtsstaat nur, wo der Anbau solcher Pflanzen durch Pollenflug und Überwucherung hergebrachter Züchtungen das Recht anderer Bauern tangiert, nicht-gen-veränderte Feldfrüchte anzubauen und mit der Sortenreinheit ihrer Produkte zu werben. Die ganzen nicht geklärten Risiken der Bio-Technik werden übersetzt in Fragen der Haftung bei möglichen Vermögensschäden Dritter. Die Haftung, die Beweispflicht im Schadensfall etc. werden gesetzlich geregelt – und damit ist alles geregelt, worauf es in der Welt des Eigentums ankommt.
Im Kreis der EU-Landwirtschaftsminister gibt es je nach Mitgliedsland und Lage der nationalen Landwirtschaft mehr und weniger Entschlossenheit zur „Modulation“ bisheriger Direktzahlungen und zur Umorientierung des Subventionswesens auf neue Ziele. Die deutsche Ministerin drückt aufs Tempo, klagt ihre Vorgänger an, „Masse statt Klasse“ gefördert und verkehrte – in Wahrheit: inzwischen nicht mehr nötige – Anreize gesetzt zu haben. Sie will „umsteuern“, den Verzicht auf Dünger, Insektizide, Pharmaka in der Aufzucht gesunder Tiere und die Extensivierung der Tierhaltung voranbringen. Das alles selbstverständlich wieder mit Geld; nicht nur per Strafandrohung, sondern – soweit wünschenswertes Verhalten über die „gute betriebliche Praxis“ hinausgeht – mit neuen Zuwendungen. Damit ist auch schon klar, was daraus wird. Die Bauern werden wieder viel zu kalkulieren haben: Sie müssen zusehen, wie sie die neuen Subventionstatbestände erfüllen, ohne die Produktivität ihrer Erzeugung zu beschränken. Im Ergebnis dieser Rechnung gibt es dann nur noch gesunde und wohlschmeckende Nahrungsmittel.
Schließlich zielt die Umstellung des Subventionswesens noch auf die Förderung des ökologischen Landbaus. Abgesehen von den genannten Zuwendungen für Verzicht auf problematische Wachstumsbeschleuniger, für die sich ökologische Betriebe qualifizieren, hilft ihnen die Politik im Wesentlichen durch ein neues Etikett und Markenschutz. Sie normiert Praktiken und Standards, die Öko-Bauern erfüllen müssen, kontrolliert deren Einhaltung und zertifiziert Betriebe, die sich um das Etikett bewerben. Das ist ein interessanter Versuch, einen neuen Zweig der Landwirtschaft aufzuziehen, dessen Geschäftsbasis die allgemeine Lebensmittelruinierung ist. Über dem Qualitätsniveau der Massenware will man ein Premium-Segment etablieren, das sich mit unterproduktiven und überwachten Produktionsverfahren ein besonderes Vertrauen der Kunden in die Qualität seiner Produkte verdienen soll, um es sich in höheren Preisen honorieren zu lassen. So haben die Lebensmittelskandale doch ihr Gutes. Das Projekt der rot-grünen Regierung, den Anteil der ökologischen Landwirtschaft erheblich zu steigern, spekuliert auf den Geldbeutel der verunsicherten und anspruchsvollen Kundschaft: Wenn man sie durch Werbung für die neuen Qualitätszeichen dazu kriegt, sich ihre Sorge um gesunde Ernährung mehr Geld kosten zu lassen, wenn also höhere Lebensmittelpreise durchsetzbar werden, schafft die Politik für einen Teil der Bauern tatsächlich neue Verdienstchancen – oder hilft wenigstens dabei.
Unterordnung I: Landwirtschaftspolitik in Abhängigkeit vom europäischen Haushaltsstreit und der Ost-Erweiterung
Die Bauern mögen sich von den Instrumenten der Gemeinsamen Agrarpolitik mehr gefordert oder mehr gefördert finden – auf sie und ihr Urteil kommt es nicht an, heute weniger denn je. Selbstverständlich berufen sich die Landwirtschaftsminister bei ihren Beratungen über Stützpreise, Direkt- und andere Hilfen auf Lage und Entwicklungsstand ihrer jeweiligen Bauern, tatsächlich aber ist die Frage nach Nutzen oder Schaden der Landwirtschaftspolitik für die eigenen Bauern längst unter die andere Frage nach Nutzen oder Schaden für den eigenen Staatshaushalt subsumiert. Die Regierungen der Mitgliedsländer vergleichen, was sie in den Brüsseler Haushalt einzahlen mit den Summen, die sie vor allem in Form von Agrarsubventionen aus Brüssel erhalten, und betrachten eine günstige Bilanz als einen nationalen Besitzstand, den sie sich nicht wegnehmen lassen. Sie finden an landwirtschaftlichen Hilfen nötig, was ihrem Staatshaushalt Finanzmittel der Partnerstaaten zuführt, bzw. das Abführen solcher Mittel zugunsten der Partner erspart – und sie finden eine Landwirtschaftspolitik unnötig bis schädlich, deren Finanzierung zu unvorteilhaften Geldströmen führt. Die Freiheit, mit der die landwirtschaftlichen Ziele dem nationalen Haushaltsvorteil untergeordnet werden, gibt Auskunft darüber, wie weit der ursprüngliche Bedarf, Bauern zu erhalten und zu entwickeln, überwunden ist. Heute fordern Nettozahler die Modernisierung und Verbilligung der Agrarpolitik, weil sie Nettozahler sind, und die Nettoempfänger verhindern genau das, weil sie Nettoempfänger sind. Der innereuropäische Machtkampf ums Geld, bei dem alle Hebel der Erpressung zwischen den Partnern zum Einsatz kommen, entscheidet darüber, wie viel Rücksicht die Bauern noch erfahren.
Die Osterweiterung der EU steht von Anfang an unter dem Vorrang der nationalen und europäischen Haushaltspolitik. In Bezug auf die Beitrittsländer, in denen die Landwirtschaft noch eine viel größere Rolle spielt, haben die Altmitglieder nie wissen wollen, wie viel Preisstützung und sonstige Hilfen deren rückständige Bauern brauchen, um sich zur europäischen Konkurrenzfähigkeit zu entwickeln bzw. sich in wachstumsfähige und scheiternde Betriebe zu sortieren. Da gilt immer schon, dass die Landwirtschaftspolitik „endgültig unbezahlbar“ würde, wenn man zuließe, dass die neuen Mitglieder mit den gleichen Rechten auf Beteiligung an den europäischen Subventionstöpfen ausgestattet würden. Die EU der 15 hat ihre Entwicklung zum Welt-Agrar-Standort eben hinter sich. Der Aufwand für die staatliche Betreuung der Landwirtschaft war im Westen „bezahlbar“, weil man die Entwicklung weltmarktfähiger Betriebe für nötig hielt; für die zehn neuen Länder, die wegen ihres Mangels an industrieller Konkurrenzfähigkeit darauf ganz besonders angewiesen sind, ist derselbe Aufwand nicht mehr „bezahlbar“.
Weil ihre Bauern in Europa nicht gebraucht werden, gibt es den Standpunkt nicht mehr, dass die nationale Bauernschaft ihre Eingliederung in den großen Agrarmarkt aushalten können muss. Die Anwendung der Standards der Produktion und der Förderbedingungen des gemeinsamen Marktes auf das östliche Beitrittsgebiet lässt viele der dortigen Kleinbauern und Lebensmittelbetriebe als Konkurrenten gar nicht erst zu: Selbstversorger-Höfe sind zu klein, um überhaupt unter die Förderbestimmungen zu fallen (für sie gibt es eine zeitlich befristete Sonderhilfe von 1000 Euro pro Jahr). Molkereien und Schlachthöfe, die die Hygienestandards und technischen Normen der EU nicht erfüllen, müssen schließen. Größere Betriebe werden in eine Agrarförderung einbezogen, die schon so weit reformiert worden ist, dass sie für die Altmitglieder „bezahlbar“ bleibt. Stützpreise auf westeuropäischem Niveau, die die Erzeugung in Polen etwa lohnend machen würden, sind weitgehend abgeschafft. Direkthilfen werden an den relativ zum alten Europa niedrigen Hektarerträgen bemessen – und außerdem vorerst auf 25% der daraus errechneten Flächenprämie begrenzt; dies ausdrücklich mit dem Argument, höhere Subventionen würden den erwünschten „Zwang zum Strukturwandel“ abschwächen. Das den Beitrittsländern gewährte Recht, diese Hilfen, wenn sie es nötig finden, um bis zu 30% aus anderen national verfügbaren Finanzmitteln aufzustocken, verschärft nur die Nöte ihrer Staatshaushalte. Und mit der anderen Säule der Landwirtschaftspolitik verhält es sich ebenso: Eine „Förderung des ländlichen Raumes“ könnten die neuen Mitglieder dringend gebrauchen, da sie ihr Bauernlegen viel schneller und härter abwickeln müssen als das westliche Vorbild; aber gerade die ländliche Armutsbetreuung können sie sich nicht leisten: Die EU-Regeln sehen Brüsseler Geldflüsse nur vor, wenn die Nationalstaaten einen Teil der Kosten selbst tragen – und so kommt es, dass die Neumitglieder es für einen Erfolg im Beitrittspoker halten, dass sie von der Pflicht zur „Modulation“ der Direkthilfen für die nächsten Jahre ausgenommen bleiben.
Die Lebensmittelkonzerne der EU betrachten die Erweiterung als Erweiterung ihres Marktes und natürlichen Expansionsraum ihres Geschäfts. Wenn sie die Lebensmittelbetriebe im Osten erst niederkonkurriert und sich auch dort zu den ausschließlichen Versorgern der Völker gemacht haben, werden sie wohl auch vor Ort produzieren und auf lokale Produzenten zurückgreifen, die ihre Lieferbedingungen erfüllen können. Darauf wiederum warten schon potente Agronomen, die in der EU groß geworden sind. Sie bereiten sich darauf vor, in den neuen Mitgliedsländern, wo Boden und Arbeit noch für Spottpreise zu haben sind, Landwirtschaft auf so richtig rentabler Stufenleiter zu betreiben.
Auf die sozialen Schäden und Konflikte, die die Neumitglieder auszuhalten haben, können sie fest rechnen, nicht so fest können sie auf das Bündel aus Übergangsregelungen, Hilfen und Ausnahmen bauen, das sie in den Beitrittsverhandlungen herausgeholt haben. Das steht nämlich unter einem dicken Vorbehalt. Deutschland und Frankreich, die großen Opponenten in den früheren Konflikten um die Finanzierung der Agrarpolitik, sind mit einem gemeinsamen Ultimatum hervorgetreten: Der Agrarhaushalt darf bis zum Ende des Jahrzehnts um nicht mehr als die Inflationsrate wachsen trotz des Beitritts der zehn zusätzlichen, besonders subventionsbedürftigen Mitgliedsländer. Schröder und Chirac geben eine neue Linie vor: Sie sagen, was die Landwirtschaft in Europa kosten darf; die Kommission und die zuständigen Minister dürfen die feststehende Summe unter die Mitgliedsländer verteilen – und die Bauern müssen mit dem zurecht kommen, was für sie übrig bleibt.
Unterordnung II: Agrarpolitik nach Maßgabe des handelsdiplomatischen Kräftemessens in der WTO
Heute ist der Welt-Agrarmarkt das Feld, auf dem die landwirtschaftlichen Produzenten bzw. die Vermarkter und Verarbeiter ihres Produkts konkurrieren. Seine Benutzung eröffnet ihnen die Chance, ein immerzu wachsendes Produkt abzusetzen und selbst zu wachsen. Eine letzte und endgültige Förderung leistet die EU ihren Bauern, indem sie dem Agrar-Export die Bahn frei macht und fremde Märkte öffnet. Die notwendigen Subventionen lohnen sich für die europäischen Staatshaushalte dadurch in dem neuen Sinn, dass die ewig hilfsbedürftige Branche selbst einen Beitrag zum Verdienen am Ausland und zur Verbesserung der Außenbilanzen leistet.
Damit gerät die Landwirtschaftspolitik aber auch in den internationalen Streit um Freihandel und Protektionismus. Nicht, dass die agrarischen Rohstoffe oder die Endprodukte der Nahrungsmittelindustrie einen riesigen Posten in den Handelsbilanzen kapitalistischer Großmächte ausmachen würden[17] – sie sind halt auch ein Posten, und dazu einer, bei dem staatliche Einflussnahme und hohe Zollschranken dem handelspolitischen Streit Stoff bieten und handelspolitische Durchbrüche noch Wachstum versprechen. Die Konfliktparteien – einerseits die großen Agrarexporteure, USA und EU, andererseits die vereinten Industrieländer in Konfrontation mit den sogenannten Entwicklungsländern, die sich, wenn überhaupt, bei landwirtschaftlichen Produkten eine Konkurrenz- und Exportfähigkeit erhoffen – werfen einander vor, den Markt des anderen benutzen, den eigenen dagegen für Importe nicht ordentlich öffnen zu wollen. Und so ist es ja auch: Jede Seite will an der anderen möglichst einseitig verdienen.
Dieser Streit rückt die Instrumente der Landwirtschaftspolitik in ein neues Licht: Als ob es für sie nie interne Gründe gegeben hätte, werden sie als Handelshemmnisse angegriffen und verdächtigt, überhaupt nur für protektionistische Absichten erfunden worden zu sein. Tatsächlich taugen Gesetze, die im Interesse von Lebensmittelsicherheit, Gesundheits-, Umwelt und Tierschutz erlassen werden, immer zugleich als Instrumente der Abwehr unerwünschter Importe und werden von denen, die sie formulieren, auch genau so verstanden. Der Vorwurf des Protektionismus richtet sich längst nicht mehr nur auf gesetzliche Vorschriften und noch bestehende Zölle, sondern inzwischen vor allem auf Subventionen: USA und EU beschuldigen einander, ihren Landwirten mit Einkommensbeihilfen eine unfaire, künstliche Konkurrenzfähigkeit zu verschaffen und dadurch die eigenen Agrarexporteure zu diskriminieren. Alle Parteien berufen sich dabei auf den durch und durch verlogenen Maßstab echter Weltmarktpreise, die die andere Seite nicht zulässt – dabei ist niemandem unbekannt, dass auf diesem Sektor alle Preise, nationale wie internationale, Ergebnis nicht nur der bäuerlichen Produktivität, sondern ebenso der staatlichen Garantien, Hilfen und Vorschriften sind. Aber den Handelspartnern ist schon klar, wie sich unter ihnen „echt“ und „unecht“ verteilen: Zölle, Hygienestandards, Subventionen etc. der eigenen Seite sind sachlich begründet, notwendig und ein Recht; dasselbe auf der andren Seite ist ein Verstoß gegen den Freihandel und eine Verfälschung fairer Konkurrenz. Praktisch zielt der theoretisch nicht vermittelbare Konflikt auf Vereinbarungen darüber, in welchem Maß die Handelspartner sich diese politischen Waffen der Konkurrenz genehmigen wollen bzw. verbieten können. Dafür suchen sie zu vorläufig verbindlichen, gemeinsamen Definitionen und Kategorisierungen erlaubter und verbotener Agrarsubventionen zu kommen, damit sie ihre Partner auf die Einhaltung der Regeln festnageln können.[18]
Beim gegenseitigen Erpressen und Angebote-Machen auf dem Forum der WTO geht es selbstverständlich nicht nur – und auch gar nicht an erster Stelle – um die Landwirtschaft und ihre staatlichen Existenzbedingungen; wenn die Handelspartner Konzessionen machen und Konzessionen fordern, dann wird alles mit allem kommensurabel: die Streitfragen des geistigen Eigentums, des Investitionsschutzes für ausländische Anleger mit den Landwirtschaftssubventionen und allem anderen; die Balance des Gebens und Nehmens entscheidet sich an der umfassenden Handels- und politischen Erpressungsmacht der involvierten Parteien. Was schließlich herauskommt beim generellen Aufrechnen der Ansprüche, die Weltmächte an einander stellen können, und der Konzessionen, zu denen sie sich im Sinn ihrer Handelsinteressen genötigt sehen, das entscheidet darüber, wie nächstens mit den Bauern verfahren wird. So bekommt der frühere Nährstand, dessen Elend nicht mehr das der Nation ist, seinen Platz in ihr zugewiesen.
[1] Marx hat den
Gegensatz zwischen selbstarbeitendem Bauern und
kapitalistischem Grundeigentum als einen Grund
gekennzeichnet, warum sich Kapitalismus und rationelle
Agrikultur widersprechen: Die Ausgabe von
Geldkapital für Ankauf des Bodens ist also keine Anlage
von agrikolem Kapital. Sie ist pro tanto eine
Verminderung des Kapitals, über das die Kleinbauern in
ihrer Produktionssphäre selbst verfügen können. Sie
vermindert pro tanto den Umfang ihrer Produktionsmittel
und verengert daher die ökonomische Basis der
Reproduktion… Sie widerspricht in der Tat der
kapitalistischen Produktionsweise… Der Konflikt
zwischen dem Bodenpreis als Element des Kostpreises für
den Produzenten und Nichtelement des Produktionspreises
für das Produkt … ist nur eine der Formen, worin sich
überhaupt der Widerspruch des Privateigentums an Boden
mit einer rationellen Agrikultur, mit normaler
gesellschaftlicher Benutzung des Bodens darstellt.
Andrerseits ist aber Privateigentum an Boden, daher
Expropriation der unmittelbaren Produzenten vom Boden –
Privateigentum der einen, das das Nichteigentum der
andern am Boden einbegreift – Grundlage der
kapitalistischen Produktionsweise.
(Marx, Das Kapital, Bd. III, S.818ff)
[2] Wie rückständig auch in dieser Hinsicht der „reale Sozialismus“ war, eröffnet sich deutschen Zuckerproduzenten beim Einstieg in den neuen osteuropäischen Markt: Während die Zuckerfirmen in Deutschland 85% des Zuckers an „Industriekunden“ verkaufen, wird in Osteuropa nach Auskunft des Chefs der „Nordzucker“ immer noch 60% der Produktion in den Haushalten verbraucht.
[3] Das Ideal der ‚Natürlichkeit‘ der Lebensmittel hat auch dann nichts für sich, wenn es von Öko-Anwälten einer gesünderen und umweltschonenderen Lebensweise ernst genommen und gegen die kapitalistische Lebensmittelproduktion ins Feld geführt wird. Genießbarkeit und Bekömmlichkeit sind – übrigens genauso wie ressourcenschonende rationelle Produktionsverfahren – ganz und gar nicht dasselbe wie ‚unverfälschte‘ ‚Natürlichkeit‘; und schon gleich nicht identisch mit einer Rückkehr zur ‚Orientierung‘ ausgerechnet an ‚naturnäheren‘, womöglich überkommenen ‚Lebensformen‘.
[4] „Die dänische Handelskette Netto hat in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) ihre Zentrale für Osteuropa errichtet. Allein in Polen entstanden bereits 150 Netto-Supermärkte. Aldi errichtete ein Lager an der – noch im Bau befindlichen – Autobahn 20.“ (FAZ, 12.2.04)
[5] Entsprechend spektakulär fallen die Pleiten aus, die Multis in dieser Sphäre hinlegen. Anlässlich des Zusammenbruchs des Firmenimperiums „Parmalat“ erfährt der staunende Zeitungsleser, wie sich aus der Verarbeitung von Tomaten und Milch im italienischen Norden ein weltweit agierender Konzern basteln ließ, der am Ende unter anderem 10% der brasilianischen Milchwirtschaft kontrollierte, im Nachhinein betrachtet aber bedauerlicherweise mit seiner „rapid expansion“ nach Lateinamerika, den USA und Osteuropa im wesentlichen „losses“ akkumulierte. (Financial Times, 20.2.04) Warum sollte diese Sphäre auch eine Ausnahme bilden von der kapitalistischen Logik, nach der das Kapital mit riesigen Kreditmassen Märkte mit Beschlag belegt, um dann festzustellen, dass die zahlungsfähige Nachfrage soviel Realisierungsansprüche dann doch nicht bedient.
[6] „Der größte Agrarchemiekonzern der Welt Sygenta hat 2003 ein unerwartet gutes Ergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss stieg um 37% und damit erheblich stärker als der Umsatz… Nach der sommerlichen Dürre in Nordeuropa, die den Absatz von Pflanzenschutzmitteln vermindert hatte, brachte das zweite Halbjahr eine Belebung, vor allem in Nord- und Südeuropa.“ (FAZ, 13.2.04)
[7] Zum Beispiel beim modernen Fischfang, bei dem der Produktionsprozess nichts anderes als Raubbau ist. In der konsequenten Ruinierung der natürlichen Grundlagen bewährt sich die Logik einer Produktionsweise, bei der die Verwandlungsfähigkeit eines Gebrauchswerts in Geld das einzige Produktionskriterium ist und die sich deshalb ebenso technisch perfekt wie rücksichtslos aller Natur als Geldquelle bemächtigt – solange sie noch da ist. In den leer gefischten Gewässern macht sich dann mit der Zucht von essbarem Meeresgetier ein neues kapitalistisches Gewerbe breit.
[8] Das betrifft bei allem Kapitaleinsatz immer noch und nicht zuletzt die Fläche: „Die deutschen Bauernhöfe brauchen mehr Land! … Die weitaus meisten Haupterwerbsbetriebe im Westen Deutschlands hätten es wesentlich leichter, ein ausreichendes Familieneinkommen zu erzielen, wenn sie zwei- bis dreimal mehr Land zur Verfügung hätten… Die Vergrößerung der Bodenfläche der landwirtschaftlichen Betriebe zu fördern, wäre eine sehr wichtige Aufgabe der Landwirtschaftsministerin.“ (Heinz Vetter, FAZ, 8.3.01) Das Ziel der Entwicklung kann im Osten bewundert werden: Die Sozialisierung des Bodens und die Schaffung „landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften“ durch die DDR-Kommunisten zahlt sich nun kapitalistisch aus. Mit den Betriebsgrößen der östlichen Güter ist – nach der Entlassung von 80% der Beschäftigten – die deutsche Landwirtschaft voll auf Weltniveau.
[9] Die Bewegung der Bodenpreise hat für die Geschäftskalkulation der Bauern daher widersprüchliche Konsequenzen: In dem Maße, wie der Bodenpreis, also auch die Kosten für Zupacht sinken, verfällt andererseits der Wert des eigenen Bodens als Kreditsicherheit.
[10] Im Verhältnis zwischen den Bauern und dem Bankwesen hat sich historisch am längsten der Kredit als reines Wucherverhältnis gehalten, in den Konditionen eher ähnlich dem Kleinkredit an arme Leute als dem Kredit an die Geschäftswelt. Der Not der Bauernschaft, überhaupt von der Kreditwirtschaft als solventer Kreditnehmer gewürdigt zu werden, verdankt sich ehedem die Gründung von speziellen Geldinstituten für den bäuerlichen Kreditbedarf; die sorgten zunächst mit Geldvorschüssen von Ernte zu Ernte dafür, dass Bauern überhaupt in der entstehenden kapitalistischen Geldwirtschaft überleben konnten. Von solchen genossenschaftlichen Gründungen sind heutzutage im Wesentlichen die Namen übrig geblieben: Credit Agricole in Frankreich, Cassa Rurale in Italien, die deutsche Raiffeisen-Genossenschaft arbeiten wie normale Geschäftsbanken, die sich zugleich, soweit sie die Bauern als Kundschaft betreuen, zumeist politischer Garantien und staatlich subventionierter Zinsen erfreuen. Zu viele Kredite werden offenbar nicht bedient und zurückgezahlt, als dass sich dieser Sektor für das normale Bankgeschäft aus sich heraus lohnen würde. Und die ersatzweise Aneignung von bankrotten Bauernhöfen und nicht profitabel nutzbarem Land ist eben keine besonders interessante Form der Bereicherung für eine Bank. In den USA wird deshalb ein großer Teil der Subventionen des Staates für die Landwirtschaft unmittelbar in Form von Kredithilfen sowie von staatlich unterstützten Ernteversicherungen ausgezahlt.
[11] Mit den Hofgrößen, mit denen sich ein bäuerliches Einkommen erzielen lässt, wächst deshalb auch die Verschuldung, die die Bauern aus ihren Einkommen finanzieren müssen.
[12] Um Lohnarbeit
nach den üblichen Standards entwickelter
kapitalistischer Nationen handelt es sich bei solchen
Arbeitsverhältnissen allerdings nicht, wie sich z.B. am
südspanischen Gemüseanbau illustrieren lässt: In
mitteleuropäischen Warenhäusern zahlt man für ein Kilo
südspanischer Frühgemüse etwa soviel, wie der
marokkanische Landarbeiter, der sie geerntet hat, in
der Stunde verdient… Auf das Preisdiktat des
Großverteilers reagieren die andalusischen
Treibhausbesitzer mit einem erweiterten Angebot und dem
verstärkten Einsatz von Pestiziden… Unter Plastik
werden im Jahr gegen 3 Millionen Tonnen Gemüse und
Früchte produziert… Hier vegetieren nicht nur Gemüse
und Früchte, sondern auch Menschen, unter dürftigen,
durch Plastik und Bretter geschützten Verschlägen…
Manchmal haben sie Arbeit, im Winter einige Tage im
Monat, und sie verdienen kaum, was sie für das eigene
Überleben sofort wieder ausgeben müssen… Das
Vermarktungssystem und das Preisdiktat zwingt die
Pflanzer zu flexiblen Lösungen; manchmal braucht man
viel, manchmal wenig Arbeitskräfte. Diese müssen auf
Abruf bereit stehen oder eine unbezahlte Präsenzzeit
akzeptieren.
(NZZ,
12.2.04) Da trifft es sich gut, dass für jeden
kapitalistischen Zwang das dazu passende
Menschenmaterial bereit steht.
[13] Entsprechend sieht die Erfolgsbilanz eines deutschen Agrarstandorts heutzutage aus. Wenn dank „Pfanni“ im Kartoffelanbau 1500 Arbeitsplätze gesichert sind, „Netto“ die örtliche Brauerei betreibt, eine große Entsorgungsfirma Tierabfälle zu Biodiesel („eine Weltneuheit“) verarbeitet und eine amerikanische Firma eine Störzucht plant – dann hat man es laut FAZ (12.2.) mit einer blühenden landwirtschaftlichen Gemeinde zu tun.
[14] Historisch ist es gelaufen wie immer, wenn sich der bürgerliche Staat um soziale Notlangen kümmert, die die kapitalistische Produktionsweise schafft: Von sich aus reagiert die Staatsgewalt erst einmal mit Repression, wo sich Unzufriedenheit rührt. Mit ihrem demokratisch-parlamentarischen Pluralismus eröffnet sie den Geschädigten daneben einen Weg, sich mit ihren Überlebensinteressen „einzubringen“: Sie dürfen verlangen, dass die Staatsgewalt sie soweit schützt, wie es auf sie als unentbehrlichen Bestandteil der kapitalistischen Klassengesellschaft ankommt; dafür übersetzen sie umgekehrt ihre Notlage in die Bereitschaft, mit den Notwendigkeiten marktwirtschaftlichen Geldverdienens zurecht zu kommen. Mit dieser doppelten Leistung haben sich bei der Entstehung des demokratischen Klassenstaats auch Bauernparteien etabliert. Der Staatsmacht haben sie Betreuungsleistungen abgerungen; und ihren Bauern haben sie den Weg gewiesen, unter dem Druck der „Verhältnisse“ und mit staatlicher Nachhilfe zu einer speziellen Klasse von Marktteilnehmern zu werden und als solche den selbstbewussten Staatsbürger in sich zu entdecken: den stolzen Eigentümer seiner Scholle, der umfassende Erfolgsgarantien vom Staat einfordert und dabei den Gestus pflegt, der Staat solle sich aus seinem fachkundigen Umgang mit Pflanze und Vieh gefälligst heraushalten. Die Dezimierung des Bauernstands im Zug des kapitalistischen Fortschritts hat den Bauernparteien in den modernsten Demokratien die Wählerbasis entzogen. Und die großen Volksparteien stellen sich zu den sozialen Nöten der Bauern wie zu jeder Unzufriedenheit im Volk, das sie als Massenbasis für ihren Wahlerfolg in Anspruch nehmen: Sie empfehlen sich mit Alternativen für die Führung auch des Landwirtschaftsministeriums und zitieren alle materiellen Drangsale, unter denen die Bauern leiden, als Beispiele für die Notwendigkeit, mit um so größerem Erfolg, für den selbstverständlich ihre Führungsfiguren einstehen, die Nation als Kapitalstandort und Machtzentrum voranzubringen. Was sie davon haben, wundert dann die politisch erzogenen Bauern – wie alle anderen Wählerschichten –, ohne dass sie aus Schaden klug würden. Leichter werden sie auf nationale Weise radikal, halten fest an dem Glauben, dass Landwirtschaftspolitik ihrem Wohl zu dienen hätte, fühlen sich daher von „ihrem Minister“ verraten und entfalten eine von den meisten sonstigen Demonstrationen unerreichte Militanz, wenn sie ihr Recht auf ihren Heimatmarkt und gute Preise durch Grenzblockaden, das Umstürzen ausländischer Tomatenlaster und Weincontainer verteidigen.
[15] Die Zeiten, in
denen es primär darum gegangen ist, den Hunger zu
stillen, sind in Europa längst vorbei. Seit wir das
Niveau der Selbstversorgung überschritten haben, also
seit rund 20 Jahren, sind die Agrarmärkte von der
Nachfrage her bestimmt, es ist daher nur logisch, die
Agrarpolitik vom Konsumenten her zu denken… Die
Aufgabenstellung für die Landwirtschaft hat sich
tiefgreifend geändert, die Gemeinsame Agrarpolitik hat
sich zwar auch geändert, aber noch nicht ausreichend…
Solange wir auf künstlich hochgehaltene Preise gesetzt
haben, hat die EU einen beträchtlichen Teil ihres
Agrarbudgets dazu verwendet, die Getreide-, Fleisch-
und Butterberge zu finanzieren oder einen Teil der
Produktion zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt zu
werfen. Fast 70% unseres Agrarbudgets sind 1991 für
Exporterstattungen und Interventionen draufgegangen.
Die Abkehr von diesem Produktionswettlauf hat
mittlerweile dazu geführt, dass in Zukunft nur noch 20%
für Marktstützung gebraucht werden. Stattdessen werden
dann, wenn die Agenda 2000-Reform voll umgesetzt ist,
fast 70% für Direktzahlungen – direkt an die Bauern –
verwendet werden.
(Fischler,
Rede zur Eröffnung der Grünen Woche, Berlin,
18.1.01.)
[16] Warum gehen
bislang nur 10% der Mittel in die ländliche Entwicklung
(90% also in Preisstützung und Direktzahlungen), obwohl
nahezu die Hälfte der Bauern in der EU bereits
Nebenerwerbslandwirte sind und es für ihre Familien
immer wichtiger wird, im ländlichen Raum eine
ansprechende Arbeit zu finden?
(Fischler, ebd.)
[17] Im heutigen Deutschland sind noch etwa 2,5% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft tätig; sie produzieren knapp 1% des Bruttosozialprodukts und tragen weniger als 1% zum Exportwert bei; die Lebensmittelindustrie fügt dem etwa 3,7% des nationalen Exportvolumens hinzu. Entsprechende Zahlen für die EU der 15 liegen etwas höher: Hier tragen 4% der Erwerbstätigen 2% zum Sozialprodukt und (einschließlich Lebensmittelindustrie) 6,2% zum Export bei. (Zahlen 2001, Quelle Europäische Kommission)
[18] Man hat sich
darauf verständigt, die diversen staatlichen
Landwirtschaftshilfen in drei Kategorien
einzusortieren: Maßnahmen der Agrarpreisstützung und
Exportsubventionen gehören in die „amber box“; ihnen
sagen die WTO-Vertragspartner gemeinsam nach, sie
würden Produktion stimulieren, Überschüsse generieren
und Weltmarktpreise verfälschen, sie sollen
schrittweise abgeschafft werden. Direkthilfen, die
nicht direkt an der Menge der Erzeugung orientiert
sind, werden der „blue box“ zugeschlagen; sie sind
anerkannt, sollen aber abgesenkt werden. In die „green
box“ gehören Geldflüsse an die Bauern, mit denen ihnen
die Gesellschaft Leistungen anderer Art als die
Lebensmittelproduktion entgilt – etwa bei Umwelt-,
Gewässer-, Tierschutz, Erhaltung nicht
landwirtschaftlich genutzter Flächen, Pflege des
gewachsenen Bildes und Erholungswerts der Landschaft;
sie will sich die EU mit ihrer „multifunktionalen
Landwirtschaft“ auf keinen Fall nehmen lassen. Soll
niemand fragen, wie sich die Zahlung an die Bauern von
ihrer Wirkung auf deren Konkurrenzfähigkeit trennen
lässt; immerhin bekommen sie – unter welchem Titel auch
immer – einen Teil ihres Einkommens vom Staat und sind
nur deshalb in der Lage, Ware auf dem Weltmarkt zu
Preisen anzubieten, von denen sie sich und ihre Höfe
nicht erhalten können. Aber so ist nun einmal das
Resultat der Handelsdiplomatie – und ihm wird die
Landwirtschaftspolitik angepasst: Auf dem Weltmarkt
für Agrarerzeugnisse zeichnet sich ein starkes Wachstum
mit lohnenden Preisen ab. Das derzeitige Niveau der
GAP-Preise ist aber zu hoch, als dass die Union ihren
internationalen Verpflichtungen nachkommen und aus der
Expansion des Weltmarktes Nutzen ziehen kann. Damit
besteht die Gefahr, dass in der Gemeinschaft und
weltweit Marktanteile verloren gehen. Die
Wettbewerbsfähigkeit muss durch entsprechend
umfangreiche Preissenkungen sichergestellt werden, um
die Absatzmöglichkeiten auf dem Binnenmarkt zu
verbessern und eine stärkere Beteiligung am Weltmarkt
zu gewährleisten. Diese Preissenkung wird durch
verstärkte direkte Beihilfen ausgeglichen, so dass das
Einkommensniveau gesichert ist.
(Website der EU-Kommission, Stichwort: Agenda
2000) Diese Reform sendet auch ein klares
Signal an die Welt: Wir haben uns heute weitgehend von
einem alten, handelsverzerrenden Fördersystem
verabschiedet. Die neue Agrarpolitik ist
handelsfreundlich, insbesondere was ihre Auswirkungen
auf die Entwicklungsländer betrifft. Die EU hat ihre
Hausaufgaben gemacht. Jetzt ist es an den anderen, sich
zu bewegen, zum Beispiel an unseren amerikanischen
Freunden, die in den letzten Jahren im Gegensatz zur EU
ihre alte, handelsverzerrende Förderwelt wiederbelebt
haben und ihre Agrarsubventionen massiv erhöht haben.
Wasser predigen und Wein trinken ist nicht
akzeptabel.
(EU-Agrarkommissar
Fischler, Pressekonferenz am 26.6.2003)