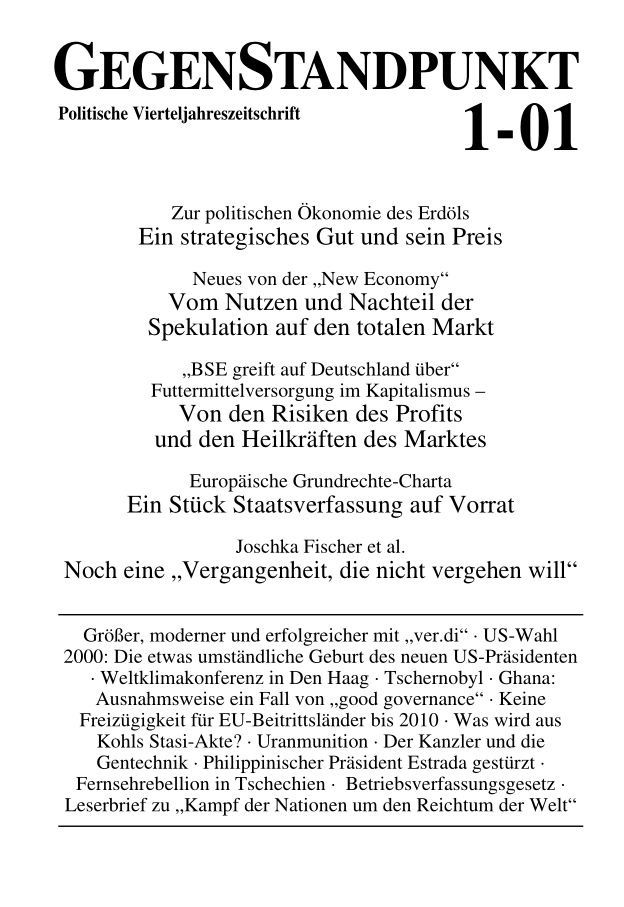Joschka Fischer et al.:
Noch eine „Vergangenheit, die nicht vergehen will“
Die Opposition wird energisch, will die reine Machtfrage in den Mittelpunkt stellen, indem sie einen führenden Amtsinhaber der Regierung moralisch als Politiker disqualifiziert und reif für den Abschuss macht. In der Debatte über Fischers Vergangenheit kommt nicht eigentlich diese, sondern die Frage zur Sprache, ob deren „Bewältigung“ so einen wie den ehemals „gewaltbereiten“ Studenten Fischer jetzt zum Tragen von Verantwortung in der „höchst legitimierten Nation“ berechtigt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Joschka Fischer et al.:
Noch eine
„Vergangenheit, die nicht vergehen will“
Joschka Fischer ist unter Beschuss geraten. Der erste deutsche Außenminister, der nach 1945 einen Krieg – in Jugoslawien – androhen und dann bis zum Sieg diplomatisch begleiten durfte, soll tatsächlich schon in seiner Frankfurter Sponti-Zeit „unpolitisch, aber gewaltbereit“ gewesen sein. Der anvisierte Widerspruch ist zwar kaum wahrnehmbar, schreit aber nach Meinung aller interessierten Beobachter entweder zum Himmel oder nach Aufklärung: Darf jemand mit so einer „militanten Vergangenheit“ überhaupt Außenminister sein und die deutschen Rechte in der Welt mit dem guten Gewissen vertreten, dass Gewalt dabei garantiert nur im Namen der höchsten Menschheitswerte zum Einsatz kommt? Aus den Reihen der CDU werden die ersten Rücktrittsforderungen laut. – Kaum steht die Frage im Raum, trifft Umweltminister Trittin den Sohn des ermordeten Generalbundesanwalts Buback im Zug und distanziert sich nicht deutlich genug von der „klammheimlichen Freude“, die ein gewisser Mescalero vor 25 Jahren angesichts des damaligen RAF-Attentats bekundet hat. Schon ist der nächste „Gewalttäter“ in der Regierung dingfest gemacht, und die Springer-Presse – die auch eine Vergangenheit hat – diskutiert die nächste Frage: Was trieb Schröder eigentlich seinerzeit?
1. Der Anlass: Eine Opposition besinnt sich auf „Sachthemen“
Ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist das Ganze schon. Selbst der frühere Bild-Chefredakteur Peter Boenisch gibt seine Verwunderung darüber zu Protokoll, dass auf einmal alte Geschichten ausgegraben werden, obwohl die „Ergebnisse“ dieser Regierung doch gar nicht so schlecht sind:
„Fischer war, wie er war, und er ist, wie er ist. Heute entscheiden allein seine diplomatischen Ergebnisse und nicht die Bilder aus einer beiderseits gewalttätigen und hasserfüllten Vergangenheit.“
Da muss dem inzwischen altersweise gewordenen Hassschriftsteller allerdings die Erinnerung an die Spielregeln seines Gewerbes abhanden gekommen sein. Sein „obwohl“ liest sich da nämlich immer noch als ein „gerade deswegen“. Natürlich ist dem aufgeregten Getue zu entnehmen, dass weder die konservative Opposition noch ihre gleichgesinnten Medien in der Sache besonders viel am Kurs der rotgrünen Regierung auszusetzen haben. Sonst könnten sie ja das zum Thema machen und müssten nicht auf unscharfen Photos nachschauen, ob der Außenminister Polizisten geohrfeigt hat oder sein Umweltkollege in Gesellschaft von Bolzenschneidern unterwegs war. Aber die glorreiche Neuordnung des Balkans, die neueste Steuererhöhung oder der wirtschaftsfreundliche Kurs des „Autokanzlers“ geht auch für die demokratischen Konkurrenten so sehr in Ordnung, dass ihnen bestenfalls gelegentliche Mäkeleien über mangelnde „Professionalität“ und so Zeugs einfallen. Eben deshalb kommt freilich eine zweite Seite des freiheitlichen Parteienstreits zum Tragen, die ihn erst richtig schön macht. Nur wegen ihrer Zufriedenheit mit der Regierungspolitik beschränkt sich eine Opposition doch nicht auf Glückwünsche und Verbesserungsvorschläge! Wo bliebe denn da das Opponieren, das energische Dagegenhalten, das spätestens beim nächsten Wahlakt zur Entscheidung zwischen dem einen Kreuzchen und dem anderen dringend benötigt wird? Gerade die Unumstrittenheit der nationalen Anliegen, ihrer Methoden und Maßstäbe macht es umso dringlicher, ganz grundsätzlich und immer mal wieder die reine Machtfrage in den Mittelpunkt zu stellen. Kann und darf die jetzt mit dem Regieren betraute Mannschaft weiterhin sagen, wo’s langgeht, – oder ist die Politik, zu der niemand Alternativen kennen will, nicht vielmehr bei der eigenen, fähigeren, glaubwürdigeren Crew viel besser aufgehoben? Bei der spannenden Frage, wer besser als der andere zur Machtausübung berechtigt ist, haben die C’ler in letzter Zeit genug einstecken müssen, wg. Schwarzgeld, „Ära Kohl“ und Zänkereien in der eigenen Führung. Da boten die Bilder und Erlebnisberichte aus grün-militanter Vorzeit eben die beste Gelegenheit, diesen langweiligen Spieß umzudrehen und obendrein noch politmoralische Pluspunkte zu sammeln: Was sind schon leicht unkoschere Parteigeld-Affären gegen den Verdacht, leibhaftige Vertreter der Staatsgewalt hätten sich früher einmal gegen genau das staatliche Gewaltmonopol versündigt, in dessen Namen sie heute Gefolgschaft verlangen?
2. Aufarbeitung, erste Etage: Ein Politiker bewältigt seine Biographie
Die Brisanz dieses Verdachts, der seine Karriere in ganz anderer Weise gefährdet als z.B. ein gescheiterter EU-Gipfel – der eher die Notwendigkeit seines außenpolitischen Wirkens unterstreicht –, ist Minister Fischer wohl von Anfang an klar gewesen. Immerhin teilt er den Maßstab, der im Versuch seiner moralischen Disqualifikation als Politiker an ihn angelegt wird: Auch für ihn ist der Absolutismus einer Staatsgewalt, die nicht nur praktisch, sondern obendrein moralisch als höchstes Gut gewürdigt werden will, ein zu hoher Wert, um diesbezügliche Anwürfe gegen ihn einfach als durchsichtiges Manöver politischer Neider und Konkurrenten abzutun. Der Fall Kohl, der die nervenden Fragen nach irgendwelchen Spendernamen mit bestem Gewissen aussitzt – was dem Staate nützt, hier genauer: dem Aufbau der Ost-CDU, kann doch nichts Schlechtes sein! –, ist mit der ethischen Dimension des Falles Fischer eben nicht zu vergleichen. Das Ansinnen, dem Amtsinhaber mit der aufgeworfenen „Gewaltfrage“ die moralische Qualifikation zur hoheitlichen Tätigkeit so grundsätzlich abzusprechen, dass jede Verteidigung hart an die Selbstanklage gerät, verbietet ferner eine zu umstandslose Distanzierung von der Vergangenheit, bloß weil der Beschuldigte sich inzwischen geläutert hat: Die Vorwürfe kreiden Fischer schließlich an, dass er überhaupt jemals auf den Gedanken verfallen ist, das Allerheiligste der Demokratie – die zutiefst legitime staatliche Gewaltausübung – in Zweifel zu ziehen, und sind mit dem Verweis auf spätere Bekehrung keineswegs zufriedenzustellen.
Er selbst fühlt sich ja auch herausgefordert, erwies sich dem Moralismus seiner Kritiker aber durchaus gewachsen. Wenn man ihn so hört, könnte man glatt meinen, er hätte das Thema auch ohne Klein-Prozess und CDU-Bundestagsanfragen ganz von selbst aufs Tapet gebracht:
„Ohne meine Biographie wäre ich heute ein anderer, und das fände ich gar nicht gut. … Ja, ich war militant.“ (Stern 2/01; aus diesem Interview sind auch die folgenden Zitate)
Hat er auch nie verheimlicht, die ehrliche Haut. Die Unmöglichkeit, sich Joschka Fischer etwa mit der Biographie von Guido Westerwelle vorzustellen, lässt schon erahnen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich im Sinne des albernen Willy-Brandt-Spruchs, dass gerade ein wenig jugendlicher Überschwang die beste Voraussetzung dafür abgibt, hinterher umso mehr staatsmännische Verantwortung zu tragen – wenigstens lassen sich, wenn man einmal im Staatsamt gelandet ist, selbst eingestandene Jugendtorheiten zu wertvollen Bildungserlebnissen verklären. Und in der Tat: Wenn seine damaligen Aktionen den Verdacht einer allzu grundsätzlichen Gegnerschaft zu dem „System“ nahe legen, dem er inzwischen an maßgeblicher Stelle vorsteht, dann liegt hier natürlich nicht einfach ein Gegensatz vor. Erstens waren die Zeiten so, dass Missverständnisse auf allen Seiten geradezu vorprogrammiert waren:
„Sie müssen den Gesamtzusammenhang sehen. Es war eine Zeit, in der auf Rudi Dutschke geschossen wurde, eine Zeit der härtesten Konfrontation, des öffentlich gepredigten Hasses gegen die Studenten, wo für uns die deutsche Demokratie ein Gesicht zeigte, das die Kontinuität des Nationalsozialismus wieder aufscheinen ließ. Das hat bei uns Feindbilder in den Köpfen geschaffen.“
Wer hätte bei so viel Konfrontation wohl der
Konfrontation ausweichen können? Wenn die Demokratie
demonstrierenden Studenten aus unerfindlichen Gründen ein
„Gesicht“ zeigte, das höfliche Jungakademiker als
Schatten des Faschismus interpretieren mussten – weil es
ihrer Vorstellung vom Wesen der Demokratie widersprach –,
muss sich niemand wundern, dass aus dieser Fehldeutung
ganze „Feindbilder“ entstanden, die im Grunde auch nicht
so gemeint waren. Für den lernfähigen Staatsmann erweist
sich die gut gemeinte Faschismusdiagnose von damals also
im Nachhinein als optische Täuschung: Was für eine
Verstrickung! – Das mit der „NS-Kontinuität“ gibt der
Sache dann auch noch eine zweite, andere Note. An dieser
irgendwie durchaus verantwortungsbewussten
Problemstellung merkt man doch, dass ein Politiker,
selbst wenn auch er vor zeitbedingten Irrtümern nicht
gefeit ist, nie und nimmer ein bloßes Produkt einer
aufgeheizten Zeit darstellt. Das würde ja, bei aller
Tauglichkeit zur nachträglichen Rechtfertigung, den
Modellcharakter von Fischers Aufstieg für mindestens eine
ganze „Generation“ herabwürdigen. Die Ergänzung, dass der
Jungrebell damals wie heute natürlich immerzu mit den
besten Absichten unterwegs war, darf also nicht fehlen:
Schon immer gegen das Unrecht dieser
Welt eingestellt, wollte er nicht werden wie seine
„Elterngeneration“ mit ihrem „Wegducken“ vor den
NS-Greueln, weshalb ihm zu dem Zeitpanorama Vietnam,
Notstandsgesetze, der Mordanschlag auf Rudi Dutschke
gar nichts anderes einfallen konnte als der erwähnte
Kontinuitätsverdacht zwischen NS-Staat und
Bundesrepublik
und damit der Einstieg in seine,
Joseph Fischers, historische Mission. Die Feindbilder von
damals mögen ja dank gegenseitiger Aufschaukelei etwas
übertrieben gewesen sein –
man wollte ganz praktisch den Sturz der
verfassungsmäßigen Ordnung…, so verrückt das heute
klingen mag
–,
im Kern ging es den Straßenkämpfern aber darum, die Demokratie in die richtigen Hände zu bekommen, damit sie in den falschen nicht pervertiert werde. Im Auftrag des Guten und der Guten im Volk, denen der Staat mehr ist als eine bloße Obrigkeit – nämlich ein Instrument, den Rest der Menschheit zu bessern: das Leitbild aller Politiker –, ließ man sich also von „Konfrontationen“ mitreißen, die im historischen Rückblick geradezu die Züge einer griechischen Tragödie annehmen. Moralisch unausweichlich, führten sie dennoch zu einer Entzweiung in Staat und Volk, die eigentlich von keiner Seite beabsichtigt war.
Deshalb darf die Seite des letztendlich überflüssigen Irrtums nicht übertrieben werden. Sonst käme dem biographischen Telos des Außenministers ja der dritte Grundstein des politischen Lebenslaufs abhanden, der die leidige Gewaltfrage im Sinne eines unverbrüchlichen Moralisten beantwortet und die heutigen Kritiker als abgebrühte Taktiker blamieren soll. Ein Fischer, der sich zur Militanz von gestern bekennt, verzichtet doch nicht darauf, seine heutige Einstellung zu diesem, für jeden wahren Staatsmann konstitutiven Thema als Ergebnis eines persönlichen Lernprozesses darzulegen und damit zu beweisen, dass er den Zusammenhang von Staat, Gewalt und Moral viel gründlicher ernst nimmt als die „Lämmerschwänzchen“ von Union und FDP. Also von wegen, man müsste ihm gerade auf diesem Feld ans Bein pinkeln! In eigenen Worten:
„Ich akzeptiere, gerade aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, Gewalt nur noch als äußerste Ultima Ratio – wo es um das Leben und die Freiheit geht und andere Mittel nicht mehr helfen. Ansonsten ist Gewalt extrem gefährlich, und ich lehne sie ab.“
Hier spricht endlich wieder der Kosovo-Krieger, der „Ultima Ratio“ sogar steigern kann und allen Ernstes aus Erfahrungen gelernt haben will, dass die Bombardierung von Städten nebst Verwüstung ganzer Landstriche in Ordnung geht, weil allerletztes Mittel für „Leben und Freiheit“ (fragt sich nur, wessen), die „extrem gefährliche“ Gewalt dagegen dort angesiedelt ist, wo studentische „Putzgruppen“ ihre Stellvertreterschlachten mit Polizisten austragen. Diese gemütliche Geisteshaltung lernt man eigentlich nicht. Man hat sie, und woher, spricht der rückblickende Minister auch freimütig aus. Einerseits zum fünfzigsten Mal aus der „NS-Geschichte“, die „gelehrt“ hat, dass man staatliche Bösewichter mit überlegener Gewalt wegputzen muss, weil die braven Bürger mehr oder weniger zum Opportunismus neigen. Andererseits ist das auch nur dann schlüssig, wenn man sich die heutige Staatsmacht unbedingt mit einem guten, letztlich sogar „oppositionellen“ Grund zurechtlegen will:
„Es gibt manchmal sehr gute Gründe, sich zu wehren. Deswegen bin ich auch nie Pazifist gewesen und werde es nie werden, weil ich den letzten Grund, für seine Freiheit und für sein Leben zu kämpfen, nie ausschließe. Aber in dem Moment, in dem Sie zuschlagen, beginnt ein Mechanismus zu wirken, wo man Macht spürt, und das ist verführerisch, vor allem bei jungen Männern. Ich habe daraus für mich eine Lehre gezogen. Für Gewaltanwendung braucht es institutionelle Barrieren, demokratische Kontrolle, sie muss begrenzt sein auf ein staatliches Gewaltmonopol. Und Sie brauchen in sich auch eine moralische Barriere. Sonst kommt es zu dem Verbrechen des linksradikalen Terrorismus, der die Politik ‚Der Zweck heiligt die Mittel‘ verfolgt.“
Eine schöne Aufarbeitung der ministeriellen Vita, die dem Geschichtsbild der Fischer-Gegner besser recht gibt, als es der Springerpresse in ihrer Blütezeit je geglaubt wurde: Bloß weil der Staat in den Studentenprotesten nichts als eine Herausforderung seiner Gewalt sehen wollte, erspart sich auch der heutige Minister jede Erinnerung daran, worum es in den damaligen Auseinandersetzungen gegangen ist, hält Steinewerfen für die Vorstufe des Terrorismus – mit dem Argument des „verführerischen Machtgefühls“, das Leuten wie ihm offenbar sauplausibel ist – und landet schließlich bei der uralten Staatsableitung, wonach es ein Gewaltmonopol ausgerechnet zur Verhinderung von Gewalt braucht. Im Weltbild eines Demokraten heiligt die Methode der „demokratischen Kontrolle“ eben jeden Staatszweck; der so legitimierte Zweck heiligt dann alle Mittel, die jedem anderen als moralische Todsünde vorgehalten werden; und das autobiographische Bekenntnis dazu macht aus einer gerade umstrittenen Politikerkarriere einen echt glaubwürdigen staatsbürgerlichen Bildungsroman.
3. Aufarbeitung, zweite Etage: Eine Republik bewältigt ihre Nachkriegsgeschichte
Die fachliche Eignung des Führungspersonals und seine moralischen Maßstäbe gehören zu den Problemkreisen, die in der Öffentlichkeit Anklang finden. Während sonst jede politische Streitfrage auf dieses unterhaltsame Niveau heruntergebracht wird, liegt in Sachen Fischer/Trittin sogar der Ausnahmefall vor, dass von vornherein gar nichts anderes auf dem Tapet ist. Freie Bahn also für Meisterleistungen der Einordnungskunst, die ungetrübt von der politischen Wirklichkeit ihren Ausgangspunkt ausschließlich in den unterschiedlichen Bildern haben, die die Leitartikler sich vom Zustand und Fortschritt der Demokratie zu machen belieben. Der ist in erster Linie ein geistiger und mit der Frage am besten charakterisiert, was eigentlich der „Sinn“ der jüngeren BRD-Geschichte ist.
Dem Frankfurter Weltblatt, hinter dem immer ein kluger Kopf steckt, missfällt an Fischer deshalb nicht nur, was er seinerzeit in der Sponti-Szene getrieben hat. Richtig giftig wird die FAZ beim Verdacht, hinter seiner Rechtfertigungsstrategie stecke auch noch der Versuch, ihr und allen Rechten im Land eine ganz ungehörige Geschichtsinterpretation überzustülpen. Wenn dieser Minister sich bemüht,
„seiner frühen politischen Geschichte einen Sinn, vielleicht gar eine volkspädagogische Bedeutung abzutrotzen“ (FAZ, 5.1.),
dann muss die „Zeitung für Deutschland“ energisch darauf hinweisen, dass das ewige Demonstrieren weder damals einen Sinn machte noch verdient, nachträglich einen zugeschrieben zu bekommen. Wenn hier was eine volkspädagogische Bedeutung hat, dann die mannhafte Haltung der Republik, die ihre demonstrierenden Spinner in die Schranken wies und ihnen auf diese elegante Weise ihre Überlegenheit nahebrachte:
„Die Republik ist geworden, was sie ist, weil sie diesen Ansturm der neuen Barbaren überlebte und weil es ihr gelang, die Stürmer von der Überlegenheit der bürgerlichen Gesellschaft und der repräsentativen Demokratie zu überzeugen.“ (ebd.)
Dass das schönste Lob der BRD-Demokratie darin bestehen soll, dass es noch nie etwas an ihr zu kritisieren gab, gefällt wiederum den Pressekollegen aus dem liberalen Eck nicht so gut. Sie sind Anhänger einer „lebendigen Demokratie“, finden sie erst heute über jeden Zweifel erhaben und gelangen über die komplizierte Vorstellung, welche grandiosen „Integrationsleistungen“ der „verkrustete“ Staat in den 70ern zuwege gebracht habe, zu erstaunlichen Gedankenspielen:
„Gerade die Verfechter eines starken Staats sollten stolz auf die Integrationskraft dieses Staates sein. … Man kann die Frage stellen, was passiert wäre, wenn der Staat frühzeitig die Weichen anders gestellt hätte, wenn er De-Eskalation nicht erst qualvoll hätte lernen müssen. Vielleicht hätte es eine RAF nicht gegeben, vielleicht wäre Ulrike Meinhof heute Familienministerin.“ (SZ, 5.1.)
Aber mindestens! Wenn man die Tatsache, dass von Opposition gegen „diesen Staat“ nicht (mehr) viel zu sehen ist, für einen Grund zum Glückwunsch hält – ohne die Frage, ob es Anlässe zur Kritik gibt, überhaupt zu berühren –, und das noch dahingehend verallgemeinert, dass Ausmaß wie Form der Opposition ihren letzten Grund im mehr oder weniger geschickten staatlichen Umgang mit ihr haben, dann wird wirklich alles denkbar.
Solchen wohlmeinenden Interpreten ist schon die Vorstellung, dass es in einer Klasse-Demokratie wie der BRD irgendwann einmal eine wirkliche „Systemopposition“ gegeben haben könnte, fremd genug. Wenn die jungen Leute von damals heute überwiegend „vernünftig“ geworden sind, kommt ihnen das ungefähr so vor wie der lebensgeschichtliche Abschied vom Glauben an Weihnachtsmann und Klapperstorch. Die Betrachtung mündet daher nicht ohne innere Logik bei so hübschen Gedanken wie dem, dass ein bisschen wohldosierte Aufmüpfigkeit noch niemandem geschadet hat und eher zur Farbigkeit der Republik beiträgt, die sie so wohltuend von dem bekannten Einheitsgrau anderswo und seinerzeit abhebt:
„In der deutschen Republik gibt es genug Leute, die ihre Karriere vom Tag ihres Eintritts in die Schülerunion systematisch vorangetrieben haben. Da tut es dem Gemeinwesen ganz bestimmt gut, wenn es andere gibt, … die im Protest gegen das konservativ-kleinbürgerliche Elternhaus erst militant-linksradikal werden und sich später wieder mit großer Mühe von ihren Illusionen verabschieden.“ (H. Riehl-Heyse, SZ 11.1.).
Nachdem auch die Seite, was für „Anstöße“ die 68er nicht alle gegeben haben, um die Republik zu einem so unumstrittenen Gesamtkunstwerk wie heute zu machen, im Blätterwald des öfteren aufgeschlagen wird, legen die Anhänger der genuin moralischen Staatsgewalt einen Zahn zu. Im Grunde genommen sind Staatsgegner „moralische Rigoristen“, die ihre Maßstäbe noch über die jeweils gültigen stellen; und solche Scharfrichter sind, auch und gerade wenn sie „geläutert“ daherkommen, die eigentlichen Urheber der Unmoral in der Gesellschaft:
„Die Achtundsechziger haben die Gesellschaft in einer Weise polarisiert, die tiefe Spuren hinterlassen hat. Sie spielten sich zu Scharfrichtern über ihre Väter auf und fällten moralische Urteile, ohne sich selbst an Moral und Sittlichkeit gebunden zu fühlen. … Der Gewalt hat Fischer abgeschworen – nicht aber jenem moralischen Rigorismus, mit dem er damals ‚das System‘ bekämpfte und heute politische Gegner in die rechte Ecke stellt.“ (FAZ 16.1.) „Es ist wahr, dass diese ‚Freiheitsrevolte‘ (Fischer) von Beginn auch einen intoleranten Zug hatte. Wer an ihr teilhatte und das weiß, kann nicht zufrieden zurückblicken.“ (FAZ 17.1.)
Da muss die FAZ wirklich in aller Toleranz daran erinnern, dass „dem System“ neben dem fraglosen Gewaltmonopol selbstverständlich auch das Moralmonopol zusteht und nichts schlimmer ist als Rigorismus bei Figuren, die eigentlich selbst in irgend so eine „Ecke“ gestellt gehören.
Und überhaupt. Die „höhere Legitimation“, die sich die linken Obermoralos fortwährend anmaßen, obwohl sie dazu gar nicht legitimiert sind, lenkt doch nur von der wahren Dimension der geistigen Schande ab, die sich dem wiederholten Rückblick erschließt. Wer einmal – mit welchem Anliegen auch immer – bei einer Gegnerschaft zum staatlichen Gemeinwesen erwischt worden ist, das nun einmal sämtliche guten Gründe für sich gepachtet hat und eifersüchtig über seinen Besitzstand an Höchstwerten wacht, der hat sich ein- für allemal disqualifiziert und soll abtreten, statt die echt Anständigen im Land durch seine verharmlosenden Geschichtsklitterungen noch extra zu beleidigen. Sonst ist nicht auszudenken, was geschieht!
„Man stelle sich nur einmal vor, ein glatzköpfiger Schläger aus Guben wäre irgendwann in dreißig Jahren erfolgreicher Innenminister von Brandenburg und würde ähnlich flapsig, ähnlich achselzuckend über seine wilden Jahre reden. Ein Sturm der Entrüstung ginge zurecht durch unser Land. Der grüne Außenminister aber kann sich heute hinstellen und unter dem Beifall vieler Verharmloser und befreundeter Exkulpateure über seine Jugendstreiche grinsen. Dabei ist es nicht nur das Ausmaß und auch nicht der Zynismus gegenüber all jenen, die auf der Strecke blieben. Fischer bricht mit einem Grundgesetz unserer Nachkriegsrepublik: dass sich Vergangenheit eben nicht ablegen lässt wie ein alter Hut.“ (Die Welt, 9.1.) „Wird Fischer verziehen, dürfte es künftig schwer fallen, noch irgendjemandem aus seiner Vergangenheit Vorhaltungen zu machen, übrigens auch nicht in zwanzig Jahren, wenn der erste geläuterte Rechtsradikale politische Verantwortung übernehmen möchte.“ (Die Welt, 13.1.)
Mit solchen Tiraden drehen die Aufpasser über die
richtige Geschichtspflege endgültig durch. Man möchte ja
gar nicht wissen, wie viel geläuterte Rechtsradikale bei
Bildzeitung und „Welt“ daran mitwirken, jeden Anflug von
auch nur ideeller Infragestellung des besten
Deutschlands, das es je gab, aufzuspüren und an den
Pranger zu stellen. Beim Auswalzen der rotgrünen Erbsünde
handelt es sich jedenfalls um einen typischen Fall der
Übernahme politischer Verantwortung. Getreu dem
altbewährten „Grundgesetz unserer Nachkriegsrepublik“
werden zwischen politischen Aktionen und
Verhaltensweisen, die miteinander nichts gemein haben,
Vergleiche angestellt, deren Qualität als Sockenauszieher
beabsichtigt ist – Es geht dabei nicht um die
Gleichsetzung der Taten. Denn das wäre absurd. Es geht
aber sehr wohl um die Vergleichbarkeit der
Verantwortung.
(Die Welt,
9.1.) –, weshalb sich umso zwangloser
Judenverfolgung, Stasi-Schnüffelei, das Umnieten von
Ausländern und das von jeder Demonstration bekannte
Einkesseln und Verprügeln von Polizisten in eine Reihe
stellen lassen:
„‚Über Gräber vorwärts‘ (!!) hieß die grauenhafte Parole, mit der man zweimal im letzten Jahrhundert, 1945 wie 1989, glaubte zur Tagesordnung übergehen zu können, und jedes Mal dominierten die Zwänge des täglichen Lebens. Noch nicht einmal die können die militanten Straßenkämpfer und Revolutionsschwadroneure nach 1968 für sich in Anspruch nehmen. Auch ihnen war ein Menschenleben, wenn es auf der anderen Seite der Barrikade stand, am Ende nicht mehr viel wert, schon gar nicht, wenn es in einer Polizeiuniform steckte.“ (ebd.)
Die „Vergleichbarkeit der Verantwortung“, die diese ebenso unglaubliche wie unglaubwürdige Gedankenfigur belegen soll, besteht nur in dem auf die Spitze getriebenen Absolutheitsanspruch der heutigen Demokratie, die nicht nur als Herrschaft anerkannt, sondern auch und gerade gesinnungsmäßig als Endziel aller bisherigen Geschichte gewürdigt werden will. Da spielt es keine Rolle, ob die Judenvernichtung jetzt ein Verstoß gegen das staatliche Gewaltmonopol gewesen ist, die Stasi ein Instrument zur Aufwiegelung gegen die Polizei, ausländerfeindliche Neonazis Demonstranten neuer Art oder die „Straßenkämpfer“ Anno 68 womöglich verkappte Völkermörder: Worauf es ankommt, ist einzig und allein die Bekundung des Abscheus über eine Geisteshaltung, die der – erfolgreichen – Herrschaft nicht von vornherein und historisch zurückschauend auch das höhere Recht gibt, das sie erwarten kann.
Da das praktisch auch wieder nichts anderes heißt – wie schon 1945 und 1989 –, als diese vor Respekt vor jedem Menschenleben nur so strotzende „Bewältigung“ der Vergangenheit eben als Entscheidungshilfe bei der Frage in Anwendung zu bringen, wer in der höchstlegitimierten Nation Beamter oder gar Minister werden darf, können die Teilnehmer dieser Debatte ihre bescheidenen Alternativen ganz gut unter sich selbst ausmachen. Für jemanden, der an den Erfolgen wie Misserfolgen der Republik sowieso nichts Positives entdecken kann, weshalb ihm der tiefere Sinn der genehmigten oder verweigerten Zulassung zur höheren Beamtenlaufbahn eigentlich ziemlich egal ist, stellen sich andere Fragen. Und die werden trotz wochenlangen Antippens in Boulevardblättern, Talkshows und Feuilletons nicht beantwortet: Worin bestanden denn die Ziele und Erfolge der Studentenbewegung? Wer dies jenseits von biographischen Rückblicken und rechthaberischen Schönfärbereien wissen will, kann dies in einem 13 Jahre alten MSZ-Artikel nachlesen, dem wir nach wie vor nichts hinzuzufügen haben: Die Studentenbewegung – eine Abrechnung mit den Jubiläumslügen; in: MSZ – Gegen die Kosten der Freiheit, Nr. 6 und 7/8 1988[1]
[1] Die Artikel befinden sich auf der MSZ-CD-ROM, erhältlich im GegenStandpunkt Verlag, oder sind im Internet abrufbar.