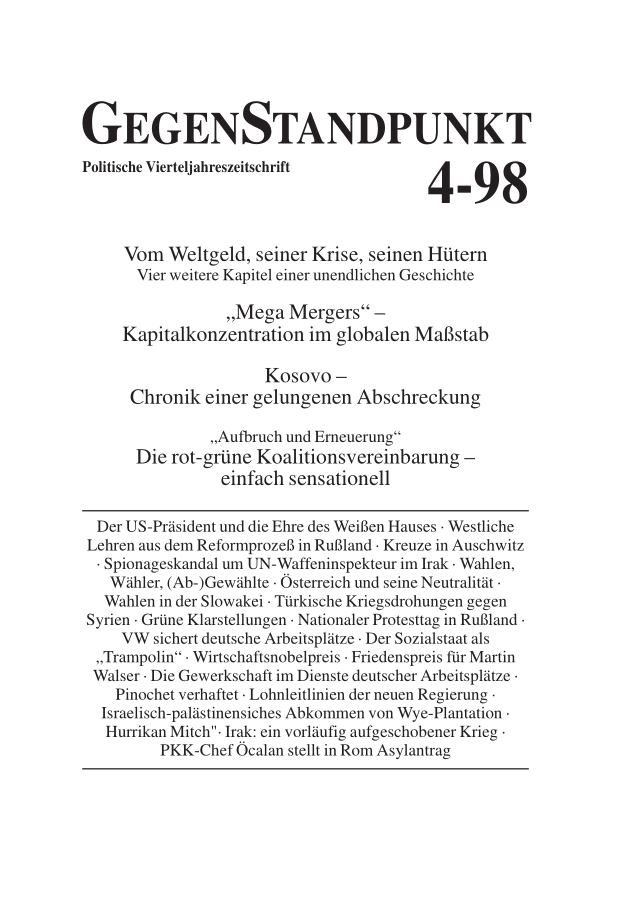Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels an Martin Walser
Dichters Aufstand gegen „Schuld“ und „Sühne“
Ein deutscher Dichter erhält den Friedenspreis und kann nicht anders, als dies als Aufforderung zur Beantwortung der nationalen Gretchenfrage „Wie hältst du es mit dem Vaterland“ zu verstehen. Seine Antwort: Deutschland früher: Auschwitz, Schuld, gesühnt. Deutschland heute: schönes Land, Vaterland.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels an Martin Walser
Dichters Aufstand gegen „Schuld“ und
„Sühne“
„Im alemannischen Sprachraum, in dem Martin Walser wurzelt, gibt es das Wörtchen „knitz“ für einen, der mit Witz und Raffinement, aber auch aufrichtig und sogar mit Risiko seiner Sache nachgeht. Auf eben diese Weise hat Martin Walser in der Frankfurter Paulskirche seinen Dank für den ihm verliehenen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels abgestattet.“ (FR 12.10.98)
Den kleinen Wurmtmichdoch, daß ein Mitherausgeber des „eher nationalkonservativen“ Konkurrenzblattes FAZ, noch dazu auf Walsers eigenen Wunsch, die offizielle Laudatio halten durfte, hat der Redakteur der nationalprogressiven FR in produktive Energie umgewandelt und eine eigene nachgereicht. „Eigene“ heißt in diesem Fall: eine von insgesamt 17 Versionen desselben Typs, die quer durch den deutschen Blätterwald rauschten. Man war sich also einig. Der Dichter hat die Ehre verdient und mit seiner Rede nachhaltig untermauert, was das Preiskomitee der Buchhändler in seiner Auslobung so treffend auf den Punkt gebracht hat: Walser habe den Deutschen ihr Vaterland zurückgegeben. – Soviel Einigkeit weckt Mißtrauen. Und siehe da: Bei allem Respekt vor den treffsicheren Analysen der Feuilletons, haben wir doch ein paar, kleine zwar, aber nicht unbedingt verzeihenswerte Lügen und andere, größere, Schäbigkeiten entdeckt, mit denen wir freilich die Preiswürdigkeit des Dichters weder in den Schmutz noch in Zweifel ziehen wollen.
1. Da ist zum einen die Sache mit dem Witz. Der geht so: „Der Ausgesuchte kam sich eingeengt vor, festgelegt. Er war nämlich, als er von der Zuerkennung erfuhr, zuerst einmal von einer einfachen Empfindung befallen worden, die, formuliert, etwa hätte heißen können: Er wird fünfundzwanzig oder gar dreißig Minuten lang nur Schönes sagen, Wohltuendes, Belebendes, Friedenspreismäßiges. Aber, so erkannte er: Fünfundzwanzig Minuten Schönes – dann bist du erledigt“ (M.W.; alle Kursivzitate aus der Preisrede). Der Ausgesuchte, der mit der Ehre, die ihm zuteil wurde, schon seit längerem gerechnet hatte, verlieh seiner Freude und Genugtuung den bescheidenen Ausdruck einer „einfachen Empfindung“, womit er auch den Dank meinte, den er den Freunden und Gönnern schulde. Und diese Schuld hätte er gerne mit Redners Münze beglichen, wäre er ein bloßer Preisträger gewesen. Indes, er war als Dichter gekommen, der nur sich selbst etwas schuldig ist, nämlich mindestens das kleine Dilemma, sich „eingeengt“ und „festgelegt“ zu fühlen auf das Klischee eines Preisträgers, dem er nach bestem Gewissen nachkommen wollte – aber auf seine Weise. Und so hat er, der geboren ist in Wasserburg am Bodensee, ausgestattet mit den Geistesgaben dieses gesegneten Landstrichs und als promovierter Germanist zudem geschult in der hintergründigen Ironie Kafkas, die akkreditierten Journalisten und anwesenden Ehrengäste mit seinem geballten alemannischen „knitz“ überrumpelt und tatsächlich lauter Schönes gesagt: Wohltuendes, Belebendes, Friedenspreismäßiges – für die deutsche Seele.
2. Über diesen wahrhaft
walserischen Einfall konnten sich die richtigen Leute
halb einschiffen, und man muß ihnen das abnehmen, weil
sie sich in Sachen Raffinement einfach
auskennen. Der Dichter nämlich hatte sich Gedanken
gemacht über seine Preisrede; und wie nicht anders zu
erwarten, hat er sich mit der Erwartungshaltung seines
Publikums auseinandergesetzt, das er nicht enttäuschen
wollte – andererseits aber schon. Eine „kritische Rede“
werde „natürlich“ von ihm erwartet. Dreimal Nein! Nicht
zu haben! Nicht von ihm! Höchstens in einer gewissen
verfremdeten Form – als Gequatsche über „die
Sonntagsrede“, die so wunderbar doppeldeutig ist:
Darüber, daß von ihm natürlich eine kritische Rede
erwartet werde, konnte der Ausgesuchte sich nicht
gleichermaßen freuen. Klar, von ihm wurde die
Sonntagsrede erwartet. Die kritische Predigt. Irgend
jemandem oder gleich allen die Leviten lesen. Die Rede,
die gespeist wird aus unguten Meldungen, die es immer
gibt.
Kaum daß der Ausgesuchte die Banalität des
Schönen verworfen und für einen kurzen Augenblick die
Aussicht auf eine gepfefferte Predigt genossen hat,
steckt er schon wieder im Dilemma. Die Gelegenheit ist
günstig, der Medienrummel groß, beste Bedingungen für ein
kritisches Wort von einem kritischen Geist, der wie der
Zipfel zum Rock zum Dichter gehört. Aber Dichter kann
nicht. Will nicht. Sein sensibles Ego hat ihm einen
Verdacht ins Ohr geflötet: daß die Gemeinde die Leviten,
die der Prediger ihr lesen könnte, nachgerade
herbeisehnt, „erwartet“. Das trübt die Freude erheblich.
Allerdings: Um ungute Meldungen, die es immer
gibt [wenn man nur will], ins Land zu unken, dazu
ist er nicht nach Frankfurt gekommen. Spätestens hier
mußte dem aufmerksamen Publikum klar geworden sein, daß
die kunstvoll verwickelte Einleitung mehr war als bloße
Kunstform. Raffiniert und subtil hat der Dichter die
Wende zu seinem eigentlichen Thema vollzogen und sich mit
einem ebenso einfachen wie genialen Überraschungscoup aus
der Erwartungsfalle befreit. Er hatte nämlich etwas
mitgebracht – „die Sonntagsrede“.
3. Damit war klar, daß eine
ziemlich „ungute Meldung“ zu erwarten war, und zwar von
denen, die solche dauernd in die Welt setzen. Mit der ihm
eigenen hemmungslosen Aufrichtigkeit
konnte der Preisträger in beliebig zitierbaren
Aussagen glaubwürdig von Leuten berichten,
sogenannten „Intellektuellen“, die über Deutschland so
Ungeheuerliches erzählen, daß es dem Dichter beinahe die
Sprache verschlägt: Man muß sich das vorstellen: Die
Bevölkerung sympathisiert mit denen, die Asylantenheime
angezündet haben, und stellt deshalb Würstchenbuden vor
die brennenden Asylantenheime, um auch noch Geschäfte zu
machen. Und ich muß zugeben, daß ich mir das, wenn ich es
nicht in der intellektuell maßgeblichen Wochenzeitung und
unter einem verehrungswürdigen Namen läse, nicht
vorstellen könnte.
Sieh an: Der promovierte Meister
der dichterischen Einbildungskraft schwächelt mit seiner
Phantasie. In seiner Eigenschaft als homo politicus
teutonicus kann er sich gewisse Vorkommnisse in der
Republik, die sein schwarz-rot-goldenes Gemüt nicht
verträgt, partout nicht „vorstellen“. Er „muß“ das
„zugeben“. Völlig zurecht wurde solch kokette
Selbstentäußerung nicht als literarische Form des
sich-blöd-Stellens mißverstanden, sondern als
Wahrheitsweg eines hochanständigen Menschen bewundert,
der mit seinen Zweifeln geradewegs auf Gewißheit
zusteuert: Ich kann solche Aussagen nicht bestreiten;
dazu sind sowohl der Denker als auch der Dichter zu
seriöse Größen. Aber – und das ist offenbar meine
moralisch-politische Schwäche – genausowenig kann ich
ihnen zustimmen. Meine nichts als triviale Reaktion auf
solche schmerzhaften Sätze: Hoffentlich stimmt’s nicht,
was uns da so kraß gesagt wird. Und um mich vollends zu
entblößen: Ich kann diese Schmerz erzeugenden Sätze, die
ich weder unterstützen noch bestreiten kann, einfach
nicht glauben. Es geht über meine moralisch-politische
Phantasie hinaus, das, was da gesagt wird, für wahr zu
halten.
Das muß man ihm glauben. Denn gäbe es sie
nicht, man müßte sie erfinden – die Modalverben. Ohne sie
käme der Ausgesuchte, der den Modus des Betroffenseins
bevorzugt, wenn er seinen Willen kundtut, nicht über den
Tag. Deswegen „entblößt“ sich der Dichter, läßt sein
Publikum schaudernd in die Tiefen seiner fragilen Seele
blicken, die nicht „kann“, wenn sie nicht will. Solche
Not wiederum mag derselbe nicht erkennen, wenn
konkurrierende Moralisten der nationalen Ehre an den
Exzessen ihrer Volksgenossen leiden und der Führung
„symbolische Politik für dumpfe Gemüter“ vorhalten. Solch
rüde Attacken aufs deutsche Gemüt „tun weh“, nämlich ihm,
dem Dichter, der im Nebenberuf glühender Nationalist ist,
der deshalb diese „Schmerz erzeugenden Sätze“ nicht
aushalten – und daher auch nicht für „wahr“ halten kann.
Aber er ist schon weiter, er hat einen Verdacht, einen
sehr präzisen sogar, den er, ganz der Dichter, so
formuliert: Bei mir stellt sich eine unbeweisbare
Ahnung ein.
Er hat die „Ahnung“ nicht bestellt, sie
hat sich „eingestellt“, bei ihm; sie ist „unbeweisbar“,
folglich aber unabweisbar, und die Bösen sind umstellt:
Die, die mit solchen Sätzen auftreten, wollen uns
wehtun, weil sie finden, wir haben das verdient.
Wahrscheinlich wollen sie auch sich selber verletzen.
Aber uns auch. Alle. Eine Einschränkung: alle
Deutschen.
Die „Wunde namens Deutschland“ – wie hat der Dichter
darunter gelitten! Um sie „offenzuhalten“, war er sogar
fast bereit, „die BRD so wenig anzuerkennen wie die DDR“,
besann sich dann aber eines Besseren. Denn nie konnte er
sich damit abfinden, „daß Nietzsche und Karl May im
Ausland geboren sein sollten, diese beiden Erzsachsen.
Ich wollte sie nicht verloren geben an ein neues, ein neu
geschaffenes Ausland“ (Interview in Die Welt, 6. Okt.
98). Das „Offenhalten“ hat sich gelohnt. Die Wunde wurde
geschlossen, Karl und Friedrich erlebten ihre zweite
Wiedergeburt, diesmal ordnungsgemäß im Inland, und der
Dichter durfte „das schönste Politikum in meinem Leben“
(ebd.) in seinem Herzen bewahren. Da war die Welt für ihn
doch um vieles schöner, „normaler“, geworden. Aber was
mußte er erleben: Aber in welchen Verdacht gerät man,
wenn man sagt, die Deutschen sind jetzt ein normales
Volk, eine normale Gesellschaft?
„Normal“ – eine
Vokabel, für die Dichter normalerweise wenig übrig haben,
für deutsche Patrioten dagegen so etwas wie Endstation
Sehnsucht, Synonym für Freiheit. Endlich so sein können
wie die „Anderen“, unbefangen borniert auf die nationale
Sache – ohne Scham. Der Ausgesuchte, dem
„Schwierigkeiten“ allenfalls aus der Werkstatt des
Dichters, beim „Erwachen der Sprache“, beim
„Sprachwerden“ seiner „Ahnungen“, geläufig sind, hat nie
ein „schwieriges Vaterland“ gekannt. Diese Manier der
moralisch guten Deutschen, die Liebe zu ihrem
vaterländischen Objekt unter den Vorbehalt des sich
Schämens für die Schande zu stellen, damit zur Liebe auch
die Leidenschaft komme, hat der moralisch nicht minder
integre Preisträger nie verstanden. Gerade als ehemaliger
„Linker“, ausgestattet mit glaubwürdiger
antifaschistischer Gesinnung, und den „Bedürfnissen und
Rechten des Volkes“ zugewandt, hat er den
„intellektuellen“ Umweg stets für einen fatalen Irrweg
gehalten. Deswegen kann er auch heute, und heute erst
recht, nicht verstehen, warum in diesem Jahrzehnt die
Vergangenheit präsentiert wird wie noch nie zuvor
.
Statt „Normalität“ im nationalen Gefühlshaushalt eine
Orgie der Anklage und Selbstanklage, ein ewiges, nicht
enden wollendes Sühnen, Mahnen, Erinnern, Schuldanklagen.
So sieht ein echter Patriot, der schließlich stolz auf
sein Land sein will und darin seine „Identität“ begreift,
die „Lage“- als Zumutung für seinen Gemütszustand, die er
schon aus Gründen der Selbstachtung zurückweisen muß:
Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz, kein
noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der
Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum; wenn mir aber jeden
Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird,
merke ich, daß sich in mir etwas gegen diese
Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar
zu sein für die unaufhörliche Präsentation unserer
Schande, fange ich an wegzuschauen.
Allerdings: So zu
reden, steht nicht jedermann zu, Jenninger kann ein Lied
davon singen. So zu reden, ist das Privileg des Dichters,
der sich auf seine Empfindungshoheit – „Etwas wehrt sich
in mir“- berufen kann und dabei exakt das ausdrückt, was
der erreichte Stand der „politisch-moralischen“
Vergangenheitsbewältigung ist.
4. Eine Gewissensangelegenheit,
natürlich. Aber machen wir uns doch nichts vor!
Ausgerechnet über das Gewissen! Diese
Scheinveranstaltung, dieses „Fließband der
unendlichen Lüge-Wahrheit-Dialektik, dieses auf
Selbstachtungsproduktion angelegte
Spiegelkabinett!“ Mit augenzwinkender
Lebensweisheit „entlarvt“ der Preisträger die Attitüde
des moralischen Gewissens und stellt sich polemisch gegen
diejenigen auf, „die sich für das Gewissen von
anderen verantwortlich fühlen.“ Denn diese „anderen“
sind „wir“, und jeder kennt unsere geschichtliche
Last, die unvergängliche Schande, kein Tag, an dem sie
uns nicht vorgehalten wird.
Die selektive Wahrnehmung
des „Unerträglichen“ führt, wie man sieht, nicht immer
zum „Wegschauen“. Beim Verfahren der nationalen Heuchelei
hat der Preisträger aufmerksam hingeschaut und sich nicht
nur die Heuchelei, sondern vor allem deren höheren Sinn
gemerkt. Sein vaterländischer Instinkt und
berufsbedingter Sinn für alles Höhere haben ihn ahnen
lassen, daß an der Idee eines Holocaust-Denkmals irgend
etwas faul sein muß. Denn wenn wir schon mit dem Denkmal
das endgültige Monopol über die Bewältigung unserer
Schande errungen haben, dann müssen wir uns diese Schande
auch von niemandem mehr vorhalten lassen. Dann ist das
Vorhalten der Schande die eigentlich schändliche Tat und
das Denkmal die Instrumentalisierung unserer Schande
zu gegenwärtigen Zwecken.
Das leuchtet ein. Genauso
wie die Lebenshilfe, die der Dichter für alle
sühnegeschädigten Deutschen bereit hält: Ich habe
mehrere Zufluchtwinkel, in die sich mein Blick sofort
flüchtet, wenn mir der Bildschirm die Welt als eine
unerträgliche vorführt. Ich finde meine Reaktion sei
verhältnismäßig. Unerträgliches muß ich nicht ertragen
können. Auch im Wegdenken bin ich geübt. An der
Disqualifizierung des Verdrängens kann ich mich nicht
beteiligen. Ich käme ohne Wegschauen und Wegdenken nicht
durch den Tag. Ich bin auch nicht der Ansicht, daß alles
gesühnt werden muß. In einer Welt, in der alles gesühnt
werden müßte, könnte ich nicht leben.
Das
Risiko, das er dabei einging –
Friedenspreis mitsamt begeisterter Presse –, nahm er
gelassen in Kauf.
***
Ach ja, fast vergessen, die „gute Meldung“, schließlich
war „Sonntagsrede“: Schließen will ich aber doch mit
einem Verdacht
, so der Preisträger mit unverhohlenem
Schalk. Eine jüngere Autorin, die auf den schönen Namen
Johanna [er meinte nicht die Wahnsinnige, sondern Johanna
Walser] hört, habe ein Buch herausgebracht. Dort heißt es
gleich zu Anfang: Verdacht. Ich habe den Verdacht, daß
alles viel schöner ist, als man darüber spricht. Alles
ist viel schöner, als man bisher es sagen kann. Und sagen
kann man bisher schon sehr viel, denn wir haben ja schon
viel geschaffen, um auszudrücken, wie schön es ist. Wir
machen neue Anläufe und versuchen immer neu,
auszudrücken, wie schön alles ist. Aber schöner ist es
trotzdem noch immer, als man es sagen kann.
Beruhigend: Der Wahnsinn bleibt in der Familie und geht
von dort aus in die Welt. Für Kontinuität ist also
gesorgt, und sogar die Frauenquote stimmt. Was für ein
schönes Land, in dem wir leben!
***
Was war das jetzt? Der schwierige „Hochseilakt“ einer „Rede wider die Paulskirchenrhetorik unter Mißachtung aller Regeln des Genres der moralischen Festansprache“ (SZ)? – Feuilletonisten, die gerne zu Übertreibungen neigen, gefallen sich in der Rolle, den kruden Mäanderwindungen des dichterischen Geistes noch eins drauf zu setzen, um mit Einfällen dieser Art einen klärenden Beitrag zur Sinnstiftung „des Wortes“ abzuliefern. Soviel Verwirrung muß nicht sein. Und deshalb möchten wir, im Interesse einer Rückbesinnung auf einfache und klare Botschaften, eine so bescheuerte Frage wie: „Was spricht, wenn Walser spricht?“ (ebd.), ganz gegen unsere sonstige Gewohnheit, nicht zurückweisen, sondern beantworten: stinknormaler Nationalismus!
Der geht so: Dichter erhält den Friedenspreis und versteht das als Aufforderung zur Beantwortung der nationalen Gretchenfrage: Wie hältst du’s mit dem Vaterland? Dichter, nicht blöd, gibt die zwei einzig korrekten Antworten: 1. Deutschland gestern, da war mal was mit Auschwitz. Eine Schuld. Wir haben sie gesühnt. Lange genug. Aber irgendwann muß Schluß sein. Und zwar jetzt. 2. Deutschland heute, schönes Land. Vaterland. Glück ist vollkommen, Freude grenzenlos. Wir sind wieder beisammen und wachsen zusammen. Sonst noch was? Irgendwelche Einwände? Kritik? Nein, das war’s.
Schon faszinierend. Von Preisträger wurde eine „Preisrede“ erwartet, und obwohl der Dichter ist, hat er sofort kapiert, daß es nur um diese eine Frage und ihre aktuelle nationale Deutung ging. Möglicherweise lag das daran, daß die Sache, um die es ging, die nationale Gesinnung, noch „viel schöner“ und weitaus primitiver ist, als man es in 30 Minuten sagen kann.