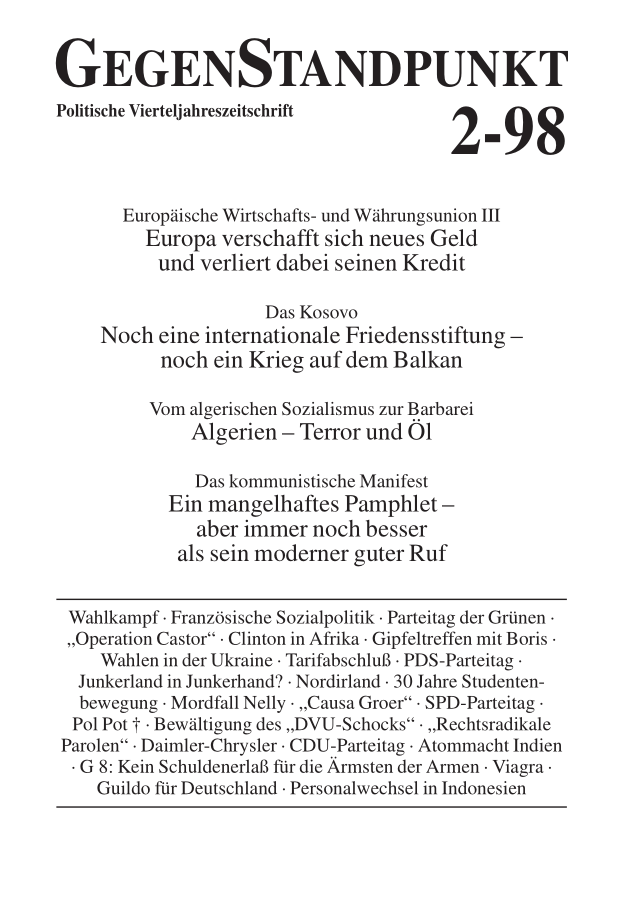Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Wahlkampfgesetzgebung
Das Verhältnis des wahltaktischen Zirkus, den die Parteien beim Gesetzgebungsverfahren veranstalten und der Sache, die dabei zustande kommt – am Beispiel der Ausführungsbestimmungen zum großen Lauschangriff
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Wahlkampfgesetzgebung
Wie der Zufall so spielt: Kaum ist der niedersächsische Wahlsonntag vorbei, die SPD „im Aufwind“ und die Koalition von einer doppelten Niederlage angefressen – die CDU hat Stimmen verloren statt hinzugewonnen, die FDP nicht genug hinzubekommen, um wieder in den Landtag einzuziehen –, da „bebt“ es schon wieder im Zentrum der Macht: Die Opposition gewinnt, die Koalition verliert eine Abstimmung über ein Gesetz im Bundestag.
1. Mit dem Inhalt des Gesetzes – es geht um die Ausführungsbestimmungen zum grundgesetzlich genehmigten „großen Lauschangriff“; zur Abstimmung steht die Alternative, ob Polizei und Justiz nur bei Abgeordneten, Strafverteidigern und Beichtvätern oder außerdem bei Journalisten, Ärzten und Steuerberatern gewisse Umständlichkeiten beim Ermitteln sowie bei der Beweisverwertung in Strafverfahren hinzunehmen haben – hat die Bedeutung des Ereignisses nichts weiter zu tun. Das geht schon daraus hervor, daß das Abstimmungsergebnis gleich als Niederlage der Regierungskoalition gewürdigt wird: Offenkundig ist die Gesetzesmaterie die eine Sache, die politische Hauptsache dagegen die Macht der konkurrierenden politischen Parteien, ihren politischen Willen überhaupt zur allgemeinverbindlichen Vorschrift werden zu lassen. Es geht um Herrschaft; und die erschöpft sich nicht in einer Anzahl wohldefinierter Gesetzesvorhaben, sondern besteht in der umfassenden Kommandogewalt über die nationale Gesellschaft. Wo sie auf dem Zusammenschluß konkurrierender politischer Parteien zu einem gemeinsamen Machtkartell beruht, muß daher „Koalitionsdisziplin“ herrschen, jenseits aller Übereinstimmung in Einzelfragen der Gesetzgebung. Finden sich umgekehrt genügend Abweichler, um ein Regierungsvorhaben zu Fall zu bringen, dann steht nicht bloß irgendeine besondere gesetzliche Regelung auf dem Spiel, sondern die Sicherheit und Exklusivität des gemeinsamen Zugriffs aufs staatliche Gewaltmonopol: Die Regierung verliert die Macht, wenn sie ihre Mehrheit nicht mehr unverbrüchlich beieinanderhalten kann.
So weit kommt es wegen der einen verlorenen Abstimmung zwar nicht. Es bleibt aber dabei, daß die Regierungsmehrheit bei einer Gesetzesentscheidung versagt, das regierende Machtkartell sich – wenn auch nur punktuell – als regierungsunfähig erweist. Und das ist im anhebenden Wahlkampf ganz schlecht. Denn nach der „Logik“ demokratischer Überzeugungsarbeit, die die Koalition sonst immerzu für sich in Anspruch nimmt, ist die an irgendeiner Stelle erwiesene Unfähigkeit, gesetzgeberische Macht auszuüben, schon so gut wie der Beweis, daß die Regierung diese Macht auch nicht verdient.
2. Für die Opposition ist eben das ein glanzvoller Sieg – und das sagt alles über Sinn und Zweck und überhaupt über die Tätigkeit des Opponierens in der parlamentarischen Demokratie: Sie besteht in dem fortwährenden Versuch, die herrschende Mannschaft praktisch der Regierungsunfähigkeit zu überführen. Mit Kritik an der Regierung hat das nichts zu schaffen; gerade umgekehrt beweist oppositionelles Geschick sich darin, Einwände und Alternativvorschläge von solcher Art vorzubringen, daß die Regierung dadurch in Verlegenheit, ihre Mehrheit in Gefahr gerät. Deswegen ist es auch nicht prinzipienlos, sondern sachgerecht und konsequent, wenn die Oppositionsparteien für einen derartigen Beweis der Schwäche der regierenden Mehrheit alle Argumente vergessen, mit denen sie ihr Nein zu einem Regierungsvorhaben ursprünglich begründet haben: Den Scharfmachern von der SPD ist es eine Abstimmung lang nicht so wichtig, die Koalition in Fragen der Verbrechensbekämpfung zu übertrumpfen; den Bürgerrechtsfreunden der Partei ist es ebenso gleichgültig wie den Grünen und der PDS, daß sie dem Ausführungsgesetz zu einer Grundgesetzänderung zustimmen, die sie neulich noch als Einstieg in den Überwachungsstaat gegeißelt haben. Gemeinsam führen sie den Beweis, daß die Macht im Staat recht eigentlich ihnen gebührt, weil sie sie der Regierung – zwar nur punktuell, aber gegen deren parlamentarische Mehrheit – tatsächlich entwinden können.
3. Es ist um so bemerkenswerter, daß sich genügend FDP-Abgeordnete finden, die ihrer Seite eine Niederlage bereiten. Zumal die Sache von den parlamentarischen Geschäftsführern der Koalition genau umgekehrt geplant war: Mit der Ablehnung des Gesetzesvorschlags aus dem SPD-dominierten Vermittlungsausschuß von Bundestag und Bundesrat wollten sie nicht bloß ihre eigene Gesetzesvorlage unverfälscht durchsetzen, sondern eben ihre intakte Gesetzgebungsmacht dokumentieren und auf der Gegenseite die notorische „Zerrissenheit“ der Sozialdemokratie vorführen. Und jetzt – genau das Gegenteil!
Natürlich kommt sofort die Frage auf, ob da eine Umorientierung der FDP auf eine neue Koalition in Gang gebracht werden soll. Nein, lautet die glaubwürdige Antwort, es geht bloß um das Gewissen, das einer Handvoll liberaler Abgeordneter in diesem Ausnahmefall verbietet, wozu es sie sonst nach wie vor verpflichtet, nämlich die Treue zur gemeinsamen Regierungsmacht. Selbstverständlich braucht diese Gewissensregung Beweggründe, die über den Unterschied zwischen drei oder sechs Berufsgruppen mit erhöhtem Abhörschutz hinausgehen. Da trifft es sich gut, daß es die längst gibt; die langwierige Diskussion über die Verfassungsreform hat sie sorgfältig herausgearbeitet: Nichts geringeres als der ewige tragische Konflikt zwischen zwei gleichermaßen höchsten und unaufgebbaren Rechtsgütern durchweht den Bundestag – hier der ‚Schutz des Staates‘, nämlich vor dem organisierten Verbrechen, das in der Privatsphäre nistet; da der ‚Schutz der Privatsphäre vor dem Staat‘, der auch nicht alles darf, was er kann, schon gar nicht seine ‚gläsernen Bürger‘ durchleuchten. Letzte Fundamente des freiheitlichen ‚Staatsverständnisses‘ stehen zur Debatte: Braucht es überhaupt einen Schutz vor dem Staat, wenn der so freiheitlich ist wie der bundesdeutsche? Andererseits: Ist der bundesdeutsche Staat noch freiheitlich zu nennen, wenn er alles kontrolliert – auch seine über jeden Zweifel erhabenen Bürger? Wieviel an Freiheit muß der Staat seinen Bürgern wegnehmen, um sie ihnen gewähren zu können? Wieviel muß er ihnen lassen, um von der geschützten Freiheit noch etwas übrig zu lassen? Fragen über Fragen – und niemand findet sich im gesamtdeutschen Parlament, der den aufgewühlten Gewissenswürmern die trostreiche Auflösung ihrer tiefempfundenen Drangsale mitteilen würde: daß es doch allemal bloß ihre eigene, nämlich die Ermessensentscheidung der politischen Machthaber ist, was die Staatsmacht ihren mündigen Bürgern als ihre private Sphäre konzediert; und daß es dafür nur eine einzige sachliche Vorgabe gibt, nämlich das Menschenrecht der geehrten Privatpersonen, als für sich selbst verantwortliche Konkurrenten ihren marktwirtschaftlichen „Lebenskampf“ durchzufechten…
Aber dann würde ja auch gar nichts von den staatsphilosophischen Prinzipien übrig bleiben, in deren Namen sich die standhaften Liberalen zu ihrer Koalitions-Untreue durchgerungen haben.
4. Und warum nun diese Untreue? Denn daß Teile der
FDP nicht wegen unaushaltbarer Gewissensqualen
mit der Opposition für die wanzenfreie Arztpraxis Partei
ergreifen, ist erstens irgendwie sowieso jedem klar;
zweitens bietet der nächste Vorstoß der SPD zur Spaltung
der Koalition die Gelegenheit zur entsprechenden
Klarstellung. Das Testmaterial ist diesmal das
Staatsbürgerrecht – auch wieder so eine bedeutungsschwere
Grundsatzfrage, die für eine höchstpersönliche
Gewissensentscheidung jenseits aller tatsächlich
praktizierten staatlichen Diskriminierung zwischen In-
und Ausländern gut ist: Wer ist überhaupt zur Teilhabe am
nationalen Kollektivismus berechtigt; wie prinzipiell
darf die prinzipielle Ausgrenzung derer von fremder
politischer Rasse höchstens, wie gründlich muß sie
mindestens sein, damit die guten Eingeborenen nicht
wieder einen Hitler wählen und ein neues Auschwitz
veranstalten…? Hier durchschaut die FDP freilich
geschlossen den üblen Trick der Opposition, einen
Gesetzentwurf des FDP-Vorstands selber zur Abstimmung zu
stellen, als zynischen und selbstverständlich
untauglichen Versuch, schwierigste Probleme der
völkischen Identität und des multikulturellen
Zusammenlebens für schnöde Parteitaktik zu mißbrauchen;
diesmal gebietet das liberale Gewissen die Vertagung des
großen Themas bis zu den Koalitionsverhandlungen mit
der Union nach einem Wahlsieg im Herbst
– also eine
Demonstration liberaler Koalitionstreue und
gemeinschaftlicher Siegesgewißheit.
Von der Art wird dann wohl auch der Grund für das abweichende Abstimmungsverhalten in der Abhör-Frage sein; und im Grunde täuscht sich da auch kein erfahrener Demokrat: Erstens muß der kleinere Koalitionspartner dauernd daran arbeiten, daß er neben der regierenden Hauptfigur, dem herrschenden Kanzler, als „eigenständige Kraft“ im Machtkartell überhaupt gescheit wahrgenommen wird – Liebhaber dieses höheren Blödsinns nennen das „Profil“. Zweitens ist die kleinere Hälfte des Parteikaders der Meinung, der fundamentalistische Bourgeois-Liberalismus der Parteiführung sei zwar gut dafür, daß ihre Partei bemerkt wird, aber nicht gut genug, um fünf Prozent der Wähler zu betören; ein Stück demonstrativer Citoyen-Liberalismus als Gegenbild zu Kanthers Law-and-Order-Wahn wäre daher nicht verkehrt, gerade nachdem die Partei dessen Hauptanliegen, dem „großen Lauschangriff“, im Prinzip und per Grundgesetzänderung zugestimmt hat. Und nachdem drittens die Niedersachsen-Wahl den Beweis geliefert hat, daß das bislang gepflegte „Profil“ für die Rückkehr in die Parlamente tatsächlich nicht reicht, hat das Gewissen einer hinreichenden Minderheit die Einsicht reifen lassen, daß gerade zum Zwecke des gemeinsamen christlich-liberalen Machterhalts einmal drastisch der Abstand zum Koalitionspartner markiert werden muß.
5. Diese Berechnungen sind, wie gesagt, kein Geheimnis. Ein Rätsel ist es schon eher, warum sie ungerührt bekanntgemacht und zur Kenntnis genommen werden, ohne daß das dem Zweck der Berechnung schadet; und daß trotzdem kein Politiker einfach ausgelacht wird, wenn er dann wieder von den Drangsalen seines Gewissens faselt. Wahrscheinlich liegt es daran, daß das Gesetzemachen als Charakterfrage genommen wird und das Urteil über die Politik und ihre Macher endlos im Kreis wandert zwischen der Anerkennung eines „guten Willens“ und der lebensklugen Entdeckung, „denen“ – den Regierenden wie den Oppositionellen – ginge es ja doch „bloß um die Macht“.
Es geht um die Macht; und die verdient nie und nimmer das Beiwort „bloß“. Die Sache der Politik ist das Regieren: die von unten gebilligte Herrschaft eines politischen Vereins – statt eines anderen – über ein -zig-Millionen-Heer von Staatsbürgern. Die – regelmäßig enttäuschte – Vorstellung, bestimmte, als besonders ehrenwert präsentierte Gesetzesinitiativen hätten den zuständigen Parteifunktionären doch wichtiger zu sein – zumindest „eigentlich“! – als die Macht zur Gesetzgebung überhaupt, liegt deswegen genauso daneben wie das kennerische Urteil, das vor lauter kritischer Anerkennung der Taktik des Machterwerbs und -erhalts gar nicht mehr die Macht zur Kenntnis nimmt: daß die nationale Führung sämtlichen Insassen der Nation die Bedingungen vorschreibt, unter denen sie ihre Interessen zu verfolgen und überhaupt ihren freien Willen zu betätigen haben.
Es geht tatsächlich um die Macht; bei der Verfertigung
von Gesetzen ebenso wie beim Taktieren um die Mehrheit
bei der Gesetzgebung; nämlich um den per Gesetz wirksamen
Zugriff derjenigen, die herrschen wollen, auf ihre
Nation. Deswegen tobt der parlamentarische Machtkampf
andauernd; und die Gesetzgebung kommt dabei keineswegs zu
kurz. Der Wahlkampfzirkus um die Durchführungsgesetze zur
grundgesetzlichen Abhörerlaubnis liefert dafür ein
drastisches Beispiel: Nach Ende des „politischen
Erdbebens“, das den Aufruhr in der „Parteienlandschaft“
so heftig belebt hat, verfügt der deutsche Staatsapparat
über das benötigte juristische Instrumentarium, um einen
guten Teil dessen offiziell und formvollendet
gerichtsverwertbar zu machen, was die Polizei ohnehin an
„Erkenntnissen“ über ihr kontrollbedürftiges Volk
sammelt. Mit der erweiterten Kontrolle sind deutlich
verschärfte Kontroll-Maßstäbe durchgesetzt worden: Der
Fraktionschef der Union scheut sich nicht, die neue
Gesetzeslage mit der Forderung zu kritisieren, es dürfe
keine überwachungsfreien Räume geben
, und der
Innenminister beschwert sich genauso öffentlich, er
verfüge jetzt über einen Wachhund ohne Zähne
.
Unter diesen Prämissen geht zugleich der Wahlkampf weiter
– darum, wer dieses Instrumentarium staatlicher
Gewalt ab Oktober zum Einsatz bringt.