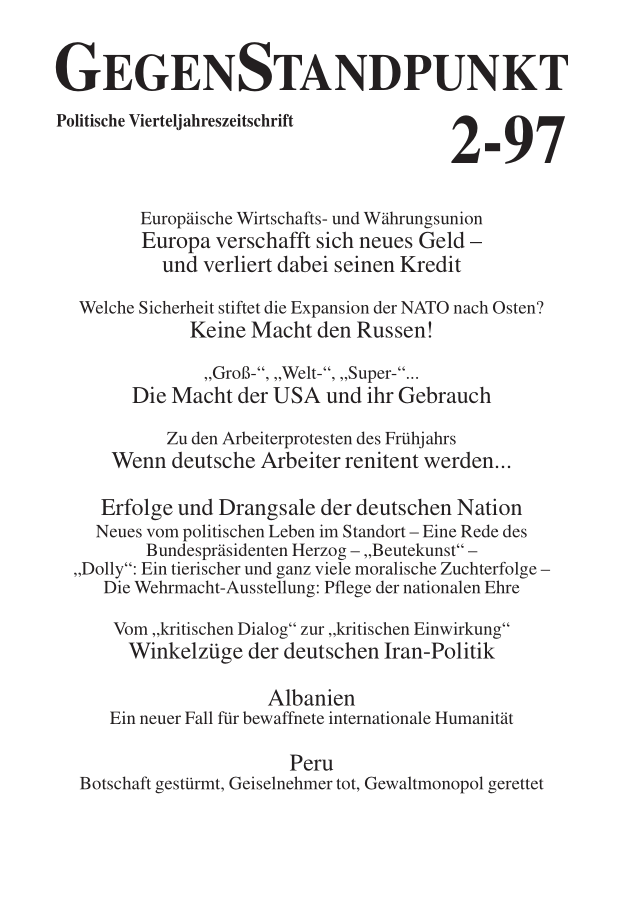Zu den Arbeiterprotesten des Frühjahrs
Wenn deutsche Arbeiter renitent werden…
Die drohende Streichung von Arbeitsplätzen in Steinkohle-, Stahl- und Bauwirtschaft nehmen deutsche Arbeiter zum Anlass für einen Kampf um Arbeitsplätze und beweisen damit, dass hiesige Lohnarbeiter aus ihrem Schaden nicht klug, sondern faschistisch werden: Sie klagen das Recht ein, sich weiter ausbeuten lassen zu dürfen, und werfen Managern und Politikern vor, dass deren Unfähigkeit ihnen den nationalen Dienst verunmöglichen würde.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Zu den Arbeiterprotesten des Frühjahrs
Wenn deutsche Arbeiter renitent werden…
Im März dieses Jahres war einiges los im Lande: Streiks in Zechen und Stahlwerken, Autobahnblockaden, Besetzung der größten Baustelle im künftigen Berliner Regierungsviertel, Sturm der Bannmeile im derzeitigen Regierungsviertel in Bonn, Blockade der FDP-Zentrale, Protestmärsche durchs Frankfurter Bankenviertel…
Ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit haben sich brave deutsche Arbeiter also getraut, Unruhe zu stiften und die öffentliche Ordnung zu stören. Lautstark haben sie verkündet, daß sie „die Schnauze voll haben“. Es fragt sich bloß, wovon. Von der hierzulande gültigen Geschäftsordnung, die sie als Arbeiter zu Opfern macht, war jedenfalls in ihren Protesten nicht die Rede. Aufgebaut haben sie sich als zu Unrecht geschädigter Teil der nationalen Arbeitswelt, der seinen Dienst immer anstandslos verrichtet hat und jetzt betrogen wird. Betrogen von einer kurzsichtigen Regierung, die die längst feststehende Schließung von Kohlezechen viel zu schnell abwickeln will; von skrupellosen Stahl-Managern, die im Verein mit gewissenlosen Bankern „Wildwest-Methoden“ in deutschen Landen einführen wollen; von verantwortungslosen Bauunternehmern, die billige Fremdarbeiter deutschen Maurern vorziehen… Herausgekommen sind ein paar „heiße Frühjahrstage“, die endgültig klargemacht haben, daß der „Kampf um Arbeitsplätze“ eine Sache ist, bei der Arbeiter gar nichts mehr richtig oder falsch machen können, weil er selbst ein einziger Fehler ist. Unter Anleitung ihrer Gewerkschaft und unter dem Beifall der SPD haben Arbeiter aus dem „Revier“ und aus der Hauptstadt ziemlich genau das vorgeführt, was SPD und Gewerkschaft immer als Gefahr beschwören: daß fortschreitende Verelendung die Betroffenen rechtsradikal werden läßt.
Der Anlaß der Proteste: Kapitalistische Geschäftskalkulationen, politisch betreut… oder: Drei Affären deutscher Standortpolitik
1. Der deutsche Steinkohlebergbau
Auch die deutsche Kohle ist ein Geschäftsartikel und wird nur als solcher gefördert. Die Besonderheit dieses Artikels liegt darin, daß er im Weltmarktvergleich, den Bergbaugesellschaften wie die Ruhrkohle AG als Importeur von Kohle aus aller Welt selber mitgestalten, zu teuer ist. Die deutsche Regierung hatte jahrzehntelang ihre guten Gründe, den Geschäftsnachteil beim Fördern und Vermarkten der deutschen Steinkohle durch staatliche Finanzhilfen an die Bergbaugesellschaften auszugleichen. Erstens gab es ein politisches Interesse an der Verfügung über einen Energieträger auf nationalem Grund und Boden, ein Interesse also an energiepolitischer Autarkie. Auf dieser Basis entstand ein weiteres wirtschaftspolitisches Interesse: Die Entwicklung einer auf dem Weltmarkt konkurrenztüchtigen Kohleförderungsindustrie wurde – ebenfalls mit staatlicher Unterstützung – vorangetrieben.
Aus diesen beiden Erwägungen heraus hat die Bundesregierung den heimischen Steinkohlebergbau jahrzehntelang mit Milliarden von „Kohlepfennigen“, die den Stromverbrauchern abgeknöpft wurden, und sonstigen Geldern unterstützt. Geldsummen, die sich nach den Gesetzen der Mathematik mühelos durch die jeweils im Kohlebergbau gerade benötigten Arbeitsplätze dividieren lassen, um dann zu so eindrucksvollen wie blödsinnigen Schlußfolgerungen zu kommen, daß doch tatsächlich jeder Arbeitsplatz im Steinkohlebergbau vom Steuerzahler jährlich mit 130000 DM gesponsert wird
. Blödsinnig sind diese Rechenkunststücke deshalb, weil die Regierung mit ihren Finanzhilfen nicht den Bergarbeitern etwas Gutes tun wollte und schon gleich nicht so hirnverbrannt war, den geschätzten Kumpels sündteure Arbeitsplätze zu spendieren, an denen sie nie im Leben so viel verdienen, wie ihr Arbeitsplatz den Steuerzahler kostet
. Gefördert wurden nicht die Bergarbeiter und ihre nicht gerade gesundheitsfördernden Arbeitsplätze, sondern das Geschäft der Ruhr- und sonstiger Kohlegesellschaften mit diesen „Plätzen“. Übrigens genauso, wie die Regierung bei der anderen, quasi heimischen Energiequelle, der Atomindustrie, mit massiver staatlicher Förderung dafür gesorgt hat, daß aus ihrem Interesse an der Verfügung über Atomstrom auf deutschem Boden ein Geschäft geworden ist. Denn wo das politische Interesse an einer national weitgehend unabhängigen Energieversorgung der Motor von ganzen Industriezweigen ist, da werden die „Gesetze der Marktwirtschaft“ vom Staat nicht außer Kraft gesetzt, sondern mit Geldzuschüssen erfüllt, so daß das Ganze als marktwirtschaftlich konkurrenzfähiges Geschäft abläuft.
Bei der Steinkohle hat sich das staatliche Interesse an einer eigenständigen nationalen Förderung in den letzten Jahren deutlich relativiert. Der Autarkie-Standpunkt ist in den Hintergrund getreten bzw. hat sich verschoben: Der Ausbau der deutschen Atomindustrie wurde vorangetrieben, derzeit ist in deutsch-französischer Koproduktion ein europäischer Reaktortyp für das nächste Jahrtausend in Planung; Erdöl steht nach Bedarf aus verschiedenen Quellen zur Verfügung, und sein Preis hängt schon längst nicht mehr von Absprachen und Förderbegrenzung der OPEC-Staaten ab; mit dem Anschluß der deutschen Ostzone wurden neue Braunkohlereviere aufgetan. Und was die Steinkohle selber angeht: Der Weltmarkt bietet ein reiches Angebot an vergleichsweise billigerer Importkohle, die häufig von deutschen Bergbaugesellschaften direkt vor Ort mit ihrer spitzenmäßigen Fördertechnik aus der Erde geholt wird. Darüberhinaus können deutsche Kohleimporteure seit der Abdankung des realen Sozialismus darauf setzen, daß die Bergbaugesellschaften der Staaten des ehemaligen Ostblocks ihre Bodenschätze zu konkurrenzlos billigen Preisen auf dem Weltmarkt anbieten; nicht, weil sie dort über eine ebenso konkurrenzlose Förderungstechnologie wie die Ruhrkohle AG verfügen, sondern weil auf Kosten der gezahlten Löhne jeder Preis akzeptiert wird, wenn er bloß in Devisen gezahlt wird.
Das ist die Sorte „Energiemix“, auf die die Bundesregierung als nationale Engergiequelle mittlerweile setzt. Deshalb definieren deutsche Politiker aller Parteien die staatlichen Förderhilfen für den deutschen Bergbau, die früher als unabweisbar galten, heute als unerträgliche Last – als Subventionspolitik, die dem deutschen Steuerzahler nicht mehr länger zuzumuten ist
. So hat die Bundesregierung schon längst mit sämtlichen Beteiligten – den Landesregierungen der betroffenen Bergbauregionen, NRW und Saarland, den Bergbaugesellschaften und nicht zuletzt der IG Bergbau – einen Konsens darüber hergestellt, daß die „Zukunft des deutschen Steinkohlebergbaus“ nur noch darin besteht, „strategische Reserven“ zu erhalten, nämlich den Zugang zu den Lagerstätten „für künftige Generationen“ offenzuhalten, sowie eine Basis für den deutschen Förderanlagenbau und die Weiterentwicklung der entsprechenden Spitzentechnologie aufrechtzuerhalten. Weitere Zechen sollen daher stillgelegt und von den derzeit noch 85000 Bergarbeitern im Jahre 2005 weit über die Hälfte nicht mehr gebraucht werden. Das war beschlossene Sache zwischen Staat, Bergbau-Kapital und Gewerkschaft, und keiner hat sich darüber aufgeregt.
Bis dann im März die Regierung im Zuge ihrer Haushaltsrevision eine Modifikation der feststehenden Pläne verkündet hat: Das Tempo des Abbaus sollte beschleunigt werden, der staatliche Zuschuß für die Bergbaugesellschaften schneller heruntergefahren werden, als diese bisher kalkuliert hatten. Das ging „den Kumpels“ auf einmal zu weit. Wie das?
2. Die Krupp-Thyssen Stahlfusion
Auch bei der zweiten Affäre, die im März für Aufregung sorgte, der Auseinandersetzung zwischen den beiden größten deutschen Stahlkonzernen Krupp und Thyssen, geht es um ein Stück kapitalistische Konkurrenz: Ein Konzern will mit seinem Stahlgeschäft europaweit gewinnen und dafür die profitablen Kapazitäten des Konkurrenten übernehmen. Abgewickelt werden soll das Ganze nach den Regeln des Aktiengeschäfts, durch Aufkauf der Majorität der Aktien des Konkurrenzkonzerns. Dafür braucht es Kredit. Dafür sind die Banken zuständig; das ist ihr Geschäft; was sollten sie auch sonst machen mit ihrer ganzen Finanzkraft. Daß sich bei neuen Geschäftsbedingungen, bei einer Fusion der beiden Stahlkonzerne, für die Beschäftigten neue Arbeitsbedingungen ergeben und noch mehr Leute entlassen werden als im Zuge der Rationalisierungen, die in beiden Konzernen schon vorher feststanden, versteht sich dabei von selbst.
Für Aufregung gesorgt hat die von Krupp geplante Übernahme des Thyssen-Konzerns bei verschiedenen Instanzen. Zuallererst beim Thyssen-Vorstand, der die Sprachregelung von der „feindlichen Übernahme“ in Umlauf brachte, sobald klar war, daß sich die Kursgewinne der Thyssen-Aktie in den letzten Monaten nicht alleine den Rationalisierungserfolgen des Unternehmens verdankten, sondern im wesentlichen durch die von Krupp in die Wege geleitete Aufkaufaktion zustandegekommen waren. Stirnrunzeln hat die Aktion auch in den Sphären der Politik ausgelöst, sowohl in Bonn als auch bei der Landesregierung von NRW, die sich dann auch sofort als Vermittler eingeschaltet hat. Gegen den Kern des Projekts – die Fusion der beiden wichtigsten deutschen Stahlproduzenten zu einem der führenden Konzerne auf dem Weltmarkt – gab es keinen politischen Einwand; dieses Vorhaben wurde sowohl von den zuständigen Wirtschaftspolitikern als auch von der deutschen Öffentlichkeit ausdrücklich als längst überfällig begrüßt. Mißfallen wurde geäußert über die Art und Weise, wie diese Fusion zustande kommen sollte: als Hin und Her zwischen konkurrienden Managern und Bankiers ganz ohne die ordnende Hand des Staates. Das war in diesem besonderen Geschäftszweig den politisch Verantwortlichen nicht ganz geheuer. Das Stahlgeschäft hat sich hierzulande schließlich, ähnlich wie die Kohleproduktion, schon immer unter der interessierten Obhut des Staates abgespielt – von der Bildung der Montanunion bis zum innereuropäischen Aushandeln von Stahlquoten. Dieser politische Vorbehalt wurde selbstverständlich, wie es sich für eine um ihre Bürger besorgte Demokratie gehört, in eine werbewirksame Sprachregelung verpackt. Alle Landesväter von NRW sahen sich zu vermittelndem Eingreifen herausgefordert; denn: Arbeitsplätze werden vernichtet – mit Wildwest-Methoden!
Statt ganz normalen urdeutschen Entlassungen, schiedlich-friedlich im Konsens mit der Gewerkschaft geregelt, jetzt diese fremdländischen Ami-Machenschaften!
Das hat bei den betroffenen Belegschaften verfangen und einigen Aufruhr ausgelöst. Wie das?
3. Das Geschäft auf deutschen Baustellen
Die Bauindustrie funktioniert als Geschäft, dessen Geschäftsmittel mittlerweile nicht mehr nur die deutsche, sondern die gesamte europäische Arbeiterklasse ist. Unter staatlicher Aufsicht und Anleitung ist längst geregelt, wie Bauunternehmen unterschiedliche nationale Arbeitslöhne ausnützen können, auch wenn gar nicht in verschiedenen Nationen gebaut wird, sondern nur in einer – im speziellen Fall in der deutschen Hauptstadt, auf der „größten innerstädtischen Baustelle des Kontinents“. Die Opfer unter den Bauarbeitern verteilen sich entsprechend: Die einen werden auch in Berlin für die in Portugal oder Polen üblichen Hungerlöhne ausgebeutet; die anderen werden oder bleiben mit ihren deutschen Pässen in Berlin arbeitslos. So gehören Geschäft und Arbeiterklasse zueinander.
Der deutsche Staat ist bei diesem Geschäft dreifach beteiligt: Erstens setzt er als Auftraggeber für ein neues Regierungsviertel die für dessen Errichtung geltenden Geschäftsbedingungen. Zweitens setzt er als politischer Betreuer der kapitalistischen Konkurrenz Geschäftsbedingungen, indem er durch entsprechende Arbeitsgesetze seiner Geschäftswelt die Chance eröffnet, auswärtige Arbeitskräfte hier billig zu benutzen. Drittens wird er als Kontrolleur tätig, weil Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung von ausländischen Arbeitern negative Wirkungen auf seine Steuereinnahmen haben. Die Konsequenzen – siehe oben.
Und dann flogen auch am Potsdamer Platz auf einmal die Bierflaschen. Gegen wen wohl?!
Das Protestecho von unten
Drei Anlässe – für ein und denselben mittlerweile schon traditionsreichen Fehler: den Kampf um Arbeitsplätze
.
Wann immer kapitalistische Geschäftskalkulationen Arbeiter überflüssig machen, unrentable Anlagen geschlossen oder mit neuer Technik und verringertem Personal wieder rentabel gemacht werden: Die betroffenen Belegschaften machen sich unter Anleitung ihrer Betriebsräte und Gewerkschaften für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze stark. Das ist – um das Wenigste zu sagen – verkehrt. Denn marktwirtschaftliche Arbeitsplätze sind ein für allemal nichts anderes als die zusammengefaßten Leistungsansprüche des Kapitals an seine Dienstkräfte. Daß die Lohnarbeiter in diesem besten aller Wirtschaftssyteme ganz elementar darauf angewiesen sind, sich für ein Unternehmen nach dessen Vorgaben, also an einem unternehmenseigenen Arbeitsplatz nützlich machen zu können, das macht die Sache nicht besser, sondern spricht erst recht gegen diese wundervolle Einrichtung. Denn offenbar und bekanntlich sind rentable Arbeitsplätze nicht bloß alles andere als ein brauchbares Lebensmittel für ihre „Besitzer“. Deren Mittel – in dem Sinne, daß sie darüber bestimmen und damit für ihren Lebensunterhalt kalkulieren könnten – ist ein Arbeitsplatz überhaupt nicht: Wo und was gearbeitet wird, zu welchen Bedingungen und ob überhaupt, das liegt voll und ganz in der freien Verfügung des Kapitals und bestimmt sich nach dessen Geschäftskalkulation. Die Einrichtung von Arbeitsplätzen folgt haargenau denselben Gesichtspunkten wie ihre „Vernichtung“ infolge von Rationalisierungen oder Firmenpleiten; die Lohnarbeiter sind in dem einen wie dem andern Fall die bloßen Anhängsel und haben zwischen den zwei Übeln – einer schlecht entgoltenen Leistung „nach Art des Hauses“ oder gar kein Einkommen – in aller Regel noch nicht einmal die freie Wahl. Wenn sie entlassen werden, erleben sie nur die zweite Seite der Abhängigkeit, die in ihrem marktwirtschaftlichen Benutzungsverhältnis liegt.
Was bedeutet dann ein „Kampf um Arbeitsplätze“?
Es handelt sich erstens nie um einen Kampf, sondern um eine hilflose Bettelei. Denn das einzige, was Lohnabhängige als eigenes Kampfmittel ins Feld führen können, um ihre Lage zu verbessern: daß ein „Arbeitgeber“ ihre Arbeit benötigt, genau das entfällt ja gerade, wenn Entlassungen anstehen. Mit ihrem „Kampf“ demonstrieren die von Entlassung bedrohten Lohn-„Empfänger“ also bloß ihre Ohnmacht – und nicht nur das. Sie bekennen sich zweitens auch noch dazu, daß sie keine Alternative haben und erst recht nie dazu übergehen wollen, für eine Alternative zu ihrer Lohnabhängigkeit zu sorgen. Sie erklären sich zu Fans ihrer Arbeitsplätze, wo sich gerade herausstellt, daß diese für das Unternehmen nichts als eine Manövriermasse und nun sogar entbehrlich sind. Sie beharren nachdrücklich auf ihrer Abhängigkeit, gerade wo sie nichts anderes als eben die zu spüren bekommen. Dabei hilft es ihnen schon gar nichts, wenn sie – wie die Gewerkschaft im Namen aller Betroffenen fortwährend beteuert – gar nichts anderes als rentable Arbeitsplätze beantragen. Denn andere gibt es sowieso nicht: Die Arbeitsplätze, die es (noch) gibt, sind rentabel, die, die abgebaut werden, eben nicht (mehr). Wenn Arbeiter sich aber zu diesem Kriterium auch noch lauthals bekennen und jedem dahergelaufenen Reporter überschwenglich versichern, wie unglaublich lohnend ihre Dienste fürs Unternehmen immer gewesen sind und daß sie etwas anderes auch überhaupt nicht im Sinn haben, dann tritt drittens das Reaktionäre an der Sache allmählich doch ziemlich penetrant in den Vordergrund. Dann wird nämlich jedem Interesse an einem halbwegs anständigen Lebensunterhalt, der bei der Bedienung des „umkämpften“ Arbeitsplatzes herauszuschauen hätte, eine Absage erteilt; und das durch die Leute selbst, die davon leben müssen. So ist in deren Namen der Ruf nach Arbeitsplätzen, ja überhaupt das bloße Stichwort „Arbeitsplätze“ – egal mit welchem Attribut davor: „sichere“, „gefährdete“ oder „zu rettende“ – zum Totschläger gegen jeden Anflug einer Forderung der Art geworden, die Menschen sollten aus ihrer Arbeit mehr für sich herausholen. „Arbeitsplätze!“ – das ist das allgemein anerkannte Argument gegen Lohn, gegen Freizeit, gegen erträglichere Lebensumstände, die heutzutage unter dem Stichwort „Umwelt“ bekannt sind. Es besiegelt die Abhängigkeit der Lohnarbeiter, die deswegen nichts als Anspruchslosigkeit an den Tag zu legen haben.
Arbeiterproteste unter dem Motto „Kampf um Arbeitsplätze“ sind also schon schlimm genug. Der Aufruhr, den Berg-, Stahl- und Bauarbeiter im Frühjahr inszeniert haben, war da allerdings noch ein Fortschritt. Von Fehlern, die um ihre Existenz besorgte Arbeiter bei der Verfolgung ihrer Interessen gemacht hätten, von materiellen Forderungen, die sie sich von einer kompromißlerisch aufgelegten Gewerkschaftsführung hätten abkaufen lassen, konnte erst gar nicht die Rede sein. Da waren auch keine Leute unterwegs, die sich im Interesse ihrer Arbeitsplätze alle Forderungen abgeschminkt hatten. Denn wenn beleidigte Arbeiter nicht nur demonstrativ darüber Beschwerde führen, was ihnen alles eingebrockt wird, also soziales Gejammer anstimmen, sondern kämpferisch fordernd auftreten und Formen des demokratischen Benimms drei Tage lang verletzen, sich also radikal gebärden, dann steht etwas anderes auf der Tagesordnung: Dann setzen sich nicht Arbeiter gegen ihre geldmächtigen Dienstherren und gegen die politische Obrigkeit, die die hiesigen Geschäftsbedingungen garantiert und absichert, in Gegensatz, sondern sie bezichtigen diese Herrschaften einer Verfehlung: Die Oberen kommen ihren nationalen Pflichten nicht nach! Mit diesem Bewußtsein haben sich die aufgebrachten Arbeiter als militante Protagonisten der Verhältnisse aufgestellt, in denen sie nichts anderes als Manövriermasse des Kapitals sind, und haben unter Einsatz eines gewissen Quantums an Gewaltbereitschaft eine ordentlichere nationale Verwaltung dieser Verhältnisse gefordert.[1]
Die protestierenden Bergarbeiter wollten sich eines nicht mehr gefallen lassen: daß die Regierung einseitig die Geschäftsbedingungen für die Unternehmen modifizierte, für die sie arbeiten. Also keinerlei Distanzierung von dem Unternehmen, das mit ihrer Arbeit wie mit ihrer Entlassung kalkuliert und subventionierte Gewinne macht; auch keine Kritik an einer Energiepolitik, die für die Benutzung ihrer Arbeitskraft ihre ganz eigenen Kriterien hat und harte Bedingungen setzt; kein öffentlicher Einwand gegen die Arbeitsplätze, an denen „ihr“ Unternehmen sie arbeiten läßt – mit garantierter Staublunge so um die 40, wenn man den geschätzten Arbeitsplatz unter Tage überhaupt solange aushält –; erst recht kein Widerruf des bereitwilligen Lohnverzichts, den sie unter Anleitung ihrer Gewerkschaft in den letzten Jahren geübt haben, um die Rentabilität „ihrer Zechen“ zu erhalten; und dem längst feststehenden und allgemein bekannten Beschluß, den ganzen Laden in einer für die Bergwerksgesellschaften lohnenden, geschäftssichernden Weise zurückzufahren, hat ihr Protestgeschrei auch nicht gegolten. Daß der Abbau ihrer Arbeitsplätze jetzt schneller vonstatten gehen sollte als ursprünglich versprochen, das war der himmelschreiende Skandal, und hat die Kumpels in Rage gebracht.
Den Gesichtspunkt dieser eigentümlichen Empörung, ihren von jedem materiellen Interesse gereinigten Beweggrund fürs Protestieren haben sie unmißverständlich kundgetan: Was die Regierung da angestellt hat, das war Betrug am deutschen Bergmann!
Also sind sie massenhaft nach Bonn gefahren, haben sich vor der FDP-Zentrale angekettet und geschrien: Wir sind das Volk!
Da ist ihnen also der alte Schlachtruf ihrer Volksgenossen im Osten eingefallen – und das keineswegs zufällig: Nicht als Arbeiter mit einem ihrer materiellen Lage entsprechenden Interesse, sondern als Repräsentanten des klassenübergreifenden Kollektivs, im Namen des Großen Ganzen, vor dem alle Sonderinteressen zurückstehen müssen, haben sie sich aufgestellt und darauf bestanden, daß die berufenen Führer des Volkes mit ihrer Basis doch nicht so ehrenrührig umspringen dürften. Zu den Freunden der „Besserverdienenden“ in der FDP sind sie hingezogen, um den Politikern die Meinung zu sagen – den vaterlandslosen Gesellen innerhalb der Regierungskoalition nämlich, von denen sich die ehrbare Basis der nationalen Energieversorgung mißachtet sieht. Was wäre Deutschland ohne Kohle!
haben sie intoniert, um die pflichtvergessene Obrigkeit daran zu erinnern, daß sie als brave, zu jeder beschissenen Arbeit bereite Knechte „Deutschland aufgebaut haben“ und deswegen das Recht auf genau so tüchtige Herren haben, die die Dienstbarkeit der unteren Abteilung zu würdigen wissen. Daß der nationale Dienst, auf den sie sich berufen, von der Nation derzeit nicht mehr gefragt ist, haben sie nicht als Klarstellung über die hierzulande gültigen Geschäftsbedingungen und ihre Rolle darin genommen, sondern die unverblümte Kundgabe einer Beschleunigung des Abbaus der Arbeitsplätze im Bergbau als Unverschämtheit der nationalen Verantwortungsträger. Im Vollgefühl ihrer beleidigten Bergmanns-Ehre war ihnen jeder Griff in die Mottenkiste der Bergmannstradition mit Blaskapelle und allem Drum und Dran gerade recht, um an die „gute alte Zeit“ zu erinnern, in der dem deutschen Bergmann seine jetzt so sträflich vernachlässigte Anerkennung seitens der Regierung noch zuteil geworden sei…
Zwei Wochen später wurde dann das Frankfurter Bankenviertel von empörten Stahlarbeitern besucht. Aufgeregt haben sie sich über die von Krupp geplante Thyssen-Übernahme ziemlich genau entlang der von oben vorgegebenen Sprachregelungen: feindliche Übernahme des größeren Konzerns durch den kleineren
unter Mithilfe von dubiosen Bankern
mit Wildwest-Manieren
, die in sämtlichen Aufsichtsräten die Drähte ziehen
und nur
an ihre bzw. die Profite der Aktionäre denken. Was ihnen an diesen Sprachregelungen eingeleuchtet hat, haben sie auch lautstark zu Protokoll gegeben: Der „kleine brave Arbeitsmann“ und der „anständige Unternehmer“ – so wie „der alte Krupp“ nach einer beliebten Ruhrgebiets-Legende angeblich einer war – werden von eiskalten Managern und dem profitgierigen Bankkapital
über den Tisch gezogen
– und das noch dazu mit Ami-Methoden
! So „systemkritisch“ äußerte sich alles andere als eine Kritik am kapitalistischen System: Leute, die Schilder mit dem Vorwurf „Casino-Kapitalismus“ hochhalten, können sich offensichtlich einen echt gemütlichen „Kantinen- Kapitalismus“ vorstellen. Daß sie damit die Realitäten der bundesdeutschen Klassengesellschaft ein wenig verkennen, ist allerdings noch das Wenigste, was man ihnen vorwerfen kann. Die Stahlarbeiter aus dem Ruhrrevier haben darauf bestanden, daß nicht das übliche marktwirtschaftliche Geschäft sie mit ihrem bißchen Lebensplanung zur Manövriermasse macht, sondern daß es „gute“ und „böse“ Geschäfte gibt. Gut – das sind nach dieser Lesart verantwortliche Unternehmen, die sich um die Produktion kümmern; schlecht – das sind Typen wie der Krupp-Manager Cromme und die Bankiers mit den Nadelstreifen, denen es „bloß um die Rendite geht“… als ob es beim Stahl je um etwas anderes ginge; als ob es ausgerechnet da eine Differenz zwischen Konzern- und Bankenchefs gäbe; als ob überhaupt die einen ohne die anderen auskämen! Doch mit sachdienlichen Hinweisen dieser Art hätte man bei den Stahlarbeitern, die sich vor der Deutschen Bank in Frankfurt aufgebaut haben, bestimmt keine Gegenliebe gefunden. Denn bei diesem Protestmarsch war es schon wieder nicht so, daß Leute, die sich über den Kapitalismus täuschen, zu einem falschen Kampf für ihre materiellen Interessen unterwegs waren. Leuten, die trotzig die Parole hochhalten: Wir sind das Kapital!
, könnte man zwar entgegenhalten, daß sie da was verwechseln, weil sie nämlich – schon gleich, wenn sie sich so aufführen – Mittel des Kapitals sind und bleiben und das wirkliche Kapital bei der Deutschen Bank zu Hause ist, wo es hingehört, und nicht in ihren starken Stahlarbeiterarmen. Aber sie wollten mit dieser verkehrten Parole ja ohnehin nicht kundtun, was sie über die politische Ökonomie ihrer Ausbeutung herausgefunden haben, sondern ihre feste Überzeugung unterstreichen: daß sie mit ihrer harten, aber nützlichen Arbeit nichts geringeres als die Basis der Nation sind; und daß, wenn man sie nicht achtet, korrupte Elemente in den Führungsetagen des Geldkapitals am Werk sein müssen, die mit ihren Finanz-Machenschaften den Schaffensdrang der anständigen Deutschen untergraben. Die entsprechenden Spruchbänder hat ihnen übrigens dieselbe Gewerkschaft in die Hände gedrückt, die immer vor einem „neuen Rechtsradikalismus“ warnt: Sie hätte ihre Parolen zum Thema „raffendes und schaffendes Kapital“ und die Erkenntnis: „Nicht das Kapital schafft Arbeit, sondern die Arbeit schafft das Kapital!“ im Wahlprogramm der NSDAP von 1933 nachlesen können.[2]
Die Bauarbeiter, die ungefähr zur selben Zeit in Berlin für Unruhe im zukünftigen Regierungsviertel gesorgt haben, hatten ihre Entlassungen schon hinter sich. Und auch sie hatten die Schuldigen für ihr Elend eindeutig ausgemacht: pflichtvergessene Bauunternehmer, die billigen Ausländern den Vorzug vor echten Deutschen geben und deswegen den letzteren die Wohltat eines Arbeitsplatzes vorenthalten. Die Schwerstarbeit auf Baustellen, mit Mindestlöhnen von um die 15 DM, die meist nicht einmal gezahlt werden, ist demnach also erstens ein Privileg, das zweitens den Falschen, nämlich denen mit dem falschen Paß zugute kommt. Das trifft den Gerechtigkeitsnerv anständiger deutscher Arbeiter; sie ereifern sich über die „Profitgier“ der Bauunternehmer. Nicht daß sie etwas gegen Profit hätten oder gegen die Unternehmer, die ihn machen; jedem das Seine. Aber daß sie als Deutsche dem profitablen Geschäft nicht dienen und das Nötigste verdienen dürfen, das regt sie auf. Noch dazu, wo es doch um den Aufbau der Deutschen Hauptstadt geht – und „weit und breit ist kein Deutscher auf der Baustelle!“. Da fühlen sich wohlerzogene deutsche Arbeiter schwer entrechtet, also einwandfrei dazu befugt, nachdrücklich klarzustellen, was ihnen am Kapitalismus stinkt. Mit dem Recht des eingeborenen Deutschen fordern sie den Nutzen ein, gewinnbringend benutzt zu werden. Es wundert nicht, daß die geschulten Funktionäre der IG Bau alle Hände voll zu tun hatten, um ihrerseits klarzustellen, daß der gerechte Zorn der deutschen Bauarbeiter „keinesfalls ausländerfeindlich“ zu verstehen wäre. Derweil brachten sich nebenan auf den Berliner Baustellen Polen und Türken schon mal vorsichtshalber vor fliegenden deutschen Bierflaschen in ihren privilegierten Wohn-Containern in Sicherheit… So wurde die Parole Wir sind das Volk!
passenderweise am Rohbau des neuen Deutschen Reichstags so richtig mit Leben erfüllt.
Alle Protestaktionen haben in der Tat einen gemeinsamen Nenner. Er liegt im beleidigten Nationalismus von unten, der das Recht einklagt auf eine funktionierende Heimat mit gerechter Führung. Entsprechend sahen die Fronten aus, die von den demonstrierenden Arbeitern aufgemacht wurden: keine Spur von einer Kritik am ganz normalen kapitalistischen Geschäftswesen und seiner politischen Betreuung. Im Gegenteil: Arm in Arm mit dem Management „ihrer“ Bergbaugesellschaften haben sich die Kumpels in einer Front gesehen gegen nationale Pflichtvergessenheit innerhalb der Regierungsmannschaft. Die Thyssen-Manager, die mit ihren Rationalisierungserfolgen der letzten Jahre so angeben, wurden von den Stahlarbeitern als Verbündete begrüßt gegen verantwortungslose Geschäftemacher und undeutsch agierende Finanzhaie. Gegen deren „dunkle Machenschaften“ galten anständige deutsche Politiker als natürliche Verbündete des Arbeitsvolks. Die Kritik an der „Profitgier“ der Bauunternehmer kürzt sich zusammen auf die Forderung: Fremdarbeiter raus, benutzt Deutsche!
Da war wirklich fast alles beieinander für den Beginn einer faschistischen Arbeiterbewegung – bis auf eines: Es hat ein Führer gefehlt, der sich an die Spitze gestellt hätte mit dem Versprechen, die Nation von gewissenlosen, korrupten Elementen radikal zu säubern. Die Häuptlinge der SPD, die im deutschen Arbeiter bekanntlich ihr natürliches Stimmvieh sehen, haben sich zwar begeistert vor den aufgeregten Massen aufgebaut und deren radikalen Nationalismus hofiert – eine Kritik daran fiele einem Sozialdemokraten im Traum nicht ein. Für das Anliegen, das da vorgebracht wurde, hatten sie tiefstes Verständnis: Eine moralisch saubere Führungselite für Deutschland, aber immer! Nur sollen dann eben auch umgekehrt die mit Recht empörten Arbeiter ein Einsehen haben und begreifen, daß die doch schon längst als wählbare Alternative in den Startlöchern steht. In diesem Sinne haben die Genossen von der SPD die aufgeladene Stimmung demokratisch verdolmetscht: Scharping hat in Bonn den Bergarbeitern, die kurzzeitig „Aufhängen!“ für das Gebot der Stunde hielten, die Gegenparole „Abwählen!“ angeboten. Den Kumpels hat diese Korrektur letztlich eingeleuchtet… Auch die Stahl- und Bauarbeiter haben sich wieder beruhigt: In den Stellungnahmen, die sie den Reportern ins Mikrophon gesprochen haben, hieß es dann, daß sie mit dem guten Gefühl, „es denen da oben einmal gezeigt zu haben“, nach Hause gefahren sind… Bis auf weiteres.
Der Ertrag der deutschen Frühjahrs-Arbeiterunruhen
Der materielle Ertrag,
der am Ende der Protestaktionen zustandekam sieht folgendermaßen aus: Die Regierung hat die Modifikation des ursprünglichen Zeitplans der Zechenstillegungen noch einmal modifiziert; die „feindliche Übernahme“ des Thyssen-Konzerns wurde unter Vermittlung der nordrhein-westfälischen Landesregierung abgewendet und statt dessen eine reguläre Fusion der Stahlproduktion von Krupp und Thyssen beschlossen. Keiner der betroffenen Arbeiter konnte ernsthaft davon ausgehen, daß damit sein Lebensunterhalt auch nur annäherungsweise gesichert wäre; aber das hat die Betroffenen selber am allerwenigsten interessiert. In beiden Fällen wird es, wie immer, wenn vor Massenentlassungen die Gewerkschaft mit am Verhandlungstisch sitzt, keine betriebsbedingten Kündigungen geben – nur die anderen Entlassungen eben, wie immer die dann auch heißen. In der Stahlbranche werden nach Auskunft des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministers bis zum Jahre 2002 so um die 7900 Stellen gestrichen; im Bergbau bis zum Jahre 2005 so um die 50.000. Vermeldet wurde als Verhandlungserfolg der IG Bergbau die Verlängerung der Anpassungsgeld-Regelung für die Überführung der 50jährigen Kumpels in den Vorruhestand bis ins Jahr 2005. Daneben war in jeder Zeitung nachzulesen, daß das Durchschnittsalter der Kumpels bei 33 Jahren liegt. Die IG Metall hat die Zusage rausgeholt, in Dortmund würden tausende „zukunftsfähiger“ neuer Ersatzarbeitsplätze geschaffen; zugleich wurde einvernehmlich ein Schiedsgremium beschlossen, dem Beschwerden im Fall der Nicht-Einhaltung dieses Versprechens vorzutragen sind… Der Aufstand der Bauarbeiter wurde bruchlos abgelöst von langwierigen konstruktiven Verhandlungen der Gewerkschaft mit den Bauunternehmern über die Wiedereinführung des Schlechtwettergeldes. Aber wen interessiert das schon noch?
Wesentlich bedeutender war für alle Beteiligten
Der politische Ertrag.
Die SPD hat versucht, für sich das Beste aus der nationalistischen Frühjahrs-Aufregung zu machen: Wählerstimmen. Nachdem Scharping und Lafontaine sich schon in Bonn bei den Bergarbeitern nützlich machten, blieb für den bekannten Arbeiterfreund Gerhard Schröder noch die Bauarbeiter-Front: Er hat sich von der IG Bau eigens von Hannover nach Berlin einladen lassen, wo er den empörten Bauarbeitern zu bedenken gab, daß auch er sich für eine Neuregelung des Schlechtwettergeldes im Bundesrat einsetzen will. So hat man ein paar Momentaufnahmen für den nächsten Wahlkampf gesammelt: Lafontaine und/oder Schröder/Scharping Hand in Hand mit echten Proleten…[3] Jedenfalls hat sich die SPD sehr um die demokratische Integration radikaler Umtriebe gekümmert – Umtriebe, die in der verkehrten Welt der BRD womöglich immer noch unter dem Verdacht der Linkslastigkeit stehen.
Zumindest die Regierung hatte diesen Verdacht. Sie ist nämlich sofort gegen das, was sie an den Bergarbeiter-Protesten offensichtlich als „soziales Element“ ausgemacht hatte, in die Offensive gegangen: „Überholtes Besitzstandsdenken“ wurde den Kumpels von Regierungsseite vorgeworfen; „längst überfällige Privilegien“ wollten sie bloß stur verteidigen, statt sich gefälligst als verantwortungsbewußte Deutsche an den „abgewickelten Braunkohle-Kumpels“ in der deutschen Ostzone ein Beispiel zu nehmen, denen noch ganz anders mitgespielt worden sei, die nicht über solche „Privilegien“ verfügten wie die Kollegen an der Ruhr und trotzdem vorbildlich die Schnauze hielten… Ein schöner demokratischer Schachzug: Die politisch Verantwortlichen, die für die „Abwicklung“ der Zonen-Arbeiter in die perspektivlose Arbeitslosigkeit gesorgt haben, berufen sich jetzt auf die von ihnen geschaffenen Opfer im deutschen Osten als unwidersprechliches Argument gegen Protest jedweder Art, wenn sie darangehen, die Lebensumstände in den Bergbaugebieten des deutschen Westens an die in der Zone anzugleichen. Bemerkenswert nebenbei auch, was heutzutage als „längst überholtes Privileg“ für Arbeiter gilt: Gemeint ist die bisher im Steinkohlebergbau übliche Methode, unter Tage verschlissene Bergarbeiter mitsamt ihren Staublungen in den Vorruhestand zu schleusen…
Zweitens hat die Regierung offensiv klargestellt, daß sie in Sachen Gewaltmonopol höchst empfindlich ist. Ein deutscher Kanzler verhandelt nicht, solange „der Mob“ auf den Bonner Straßen sein Unwesen treibt; auch nicht mit seinem Freund, dem Chef der IG Bergbau, der als – selbst nach deutschen Maßstäben – besonders regierungsfreundlich-pflegeleicht gilt. Den Kumpels, die sich darüber erst schwer aufgeregt haben, hat das anscheinend dann doch sehr imponiert.
Die Öffentlichkeit schließlich war gespalten; doch keiner der massenhaft vor Ort aufgebotenen Beobachter konnte in den randalierenden Arbeitern eine ernsthafte Gefahr für die Republik entdecken. Insbesondere wohl deshalb, weil den Protesten wirklich kein linkes Gedankengut zu entnehmen war; mit einem gewissen Behagen wurde notiert, daß kommunistische Agitatoren, wenn es sie überhaupt gegeben hätte, sich todsicher eine Abfuhr geholt und wahrscheinlich Prügel bezogen hätten. So etwas wie Rechtslastigkeit hat erst recht niemand erkennen können: Wenn brave Familienväter und fleißige Arbeiter darauf beharren, sich für die Nation nützlich machen zu dürfen – welchem aufrechten Demokraten gilt das nicht als durch und durch ehrenwertes Anliegen?
Auf dieser sicheren ideologischen Basis hat die freie Öffentlichkeit ihren Pluralismus ausgetobt und sich an die Einordnung der Ereignisse gemacht. Ganz im Sinne des Unterschieds zwischen Regierung und Opposition reichte das Spektrum von Mitleid und herablassendem Verständnis für „Familienväter mit Arbeitsplatzsorgen“ und Sympathien fürs „Revier“, das man doch nicht verkommen lassen dürfe, bis zu ordnungspolitischen Bedenken gegen die Regierung, die mit ihrer „Nachgiebigkeit“ gegenüber den Bergarbeitern einen „gefährlichen Präzedenzfall“ geschaffen hätte, und Polemik gegen „überkommene Besitzstände“. Irgendwo dazwischen – am besten gleich im Feuilleton – wurden kulturkritische Abgesänge auf die „alte deutsche Industriekultur“ und den „Mythos von der Ruhr“ angestimmt. Und da man gerade schon bei Kulturkritik war, ist manchem auch noch eine kulturpessimistische Warnung eingefallen; der Verdacht nämlich, daß „entwurzelte Menschen“ schon mal zu Unberechenbarkeit neigen und zum Ordnungsproblem werden könnten…
***
Das waren sie also, die deutschen Frühjahrs-Unruhen:
- Liberale Scharfmacher räumen auf mit kostspieligen, für die kapitalistische Konkurrenz – dem Lebensmittel der Nation – untragbaren Arbeitsplätzen.
- In ihrer deutschen Arbeiterehre verletzte Diener der Nation führen sich auf wie die Basis für einen nationalen Sozialismus.
- Berechnende Wahlkämpfer bemühen sich um Sympathien bei dieser nationalen Basis – unverkennbar, damit sie sich stimmengewaltig bemerkbar macht.
- Eine Regierung, die sich unbeeindruckt gibt von den ausfällig gewordenen Arbeiterscharen und dem aufgebrachten Nationalismus von unten ihren Law-and-Order-Standpunkt entgegensetzt.
Liberale Scharfmacher der kapitalistischen Konkurrenz, führerlose Faschisten, berechnende Wahlkämpfer und eine Regierung, die Führungsstärke demonstriert – so in etwa verlaufen die Konfliktlinien der bundesdeutschen Konsensdemokratie mit ihrer postindustriellen Streitkultur.
[1] Im Grunde genommen hatten schon die Arbeitskampf-Parolen des „Modells Deutschland“ der späten 70er und 80er Jahre nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig gelassen: Auf der einen Seite die Aufkleber der Unternehmerverbände: „Die 35-Stunden-Woche schafft Arbeitsplätze – in Japan!“; auf der anderen Seite der Vorwurf der Gewerkschaften an die national verantwortungslose deutsche Unternehmerschaft, die aus schnöder „Profitgier“ Arbeitsplätze in aller Welt schaffe – bloß nicht in der deutschen Heimat! Jetzt zeigt sich, diese Botschaft ist angekommen und verinnerlicht: Arbeitsplatznationalismus statt Klassenbewußtsein – das ist offensichtlich der Geisteszustand, der zu unserer „modernen Dienstleistungsgesellschaft“ der späten 90er paßt!
[2] In dieser Frage bewährt sich wieder einmal die Reduktion der öffentlichen „Bewältigung“ des Nationalsozialismus auf die allgemeine Verdammung des „letztlich nicht rationell erklärbaren“ Judenhasses der Nazis: Alles andere mag so faschistisch sein, wie es will – es fällt einfach nicht unter das große antifaschistische Verdikt. Hilmar Kopper, den Vorstandssprecher der Deutschen Bank, einen „Bankjuden“ zu nennen, das würde zweifellos jeder deutsche Gewerkschaftler heutzutage vehement von sich weisen. Aber daß die Front des wahren Klassenkampfes zwischen der redlich schaffenden Mehrheit und den großen Finanzmagnaten verläuft, die sich mit ihrer Wirtschaftsmacht sogar noch über „unsere frei gewählten Volksvertreter“ stellen, das ist für dieselben Antifaschisten ein ungemein einleuchtender Gedanke… Besagter Vorstandssprecher der Deutschen Bank selber hat übrigens bei dieser Gelegenheit seine Lernfähigkeit unter Beweis gestellt. Sein einstiger Fauxpas mit den „Peanuts“ – so ungefähr das einzige, was im deutschen Gemüt von der Pleite des Immobilien-Spekulanten Schneider haften geblieben ist – hat die Stahlarbeiter zu der ungemein originellen Aktion veranlaßt, die Zentrale der Deutschen Bank mit Erdnüssen zu bewerfen. Der Mann wußte sofort, wie er seinen Kritiker diesmal das Maul stopfen mußte. Er gab schlicht zu Protokoll, daß er den Protest nicht hätte hören mögen, wenn eine ausländische Bank statt eben der DEUTSCHEN dieses national wichtige Geschäft hätte finanzieren wollen. Der Mann hat offensichtlich die Stoßrichtung der Proteste gegen sein Institut gleich erfaßt.
[3] Ein Vorteil, der allerdings auch nur von kurzer Dauer ist in unserer schnellebigen Demokratie: Kaum hatte der Kanzler zwei Wochen nach dem Arbeiteraufruhr aus seinem Osterurlaub verkündet, er hätte jetzt abgespeckt und stünde im übrigen demnächst nochmal zur Wahl, wußten die Meinungsforscher, daß das „Stimmungsplus für die SPD“ schon wieder im Eimer war…