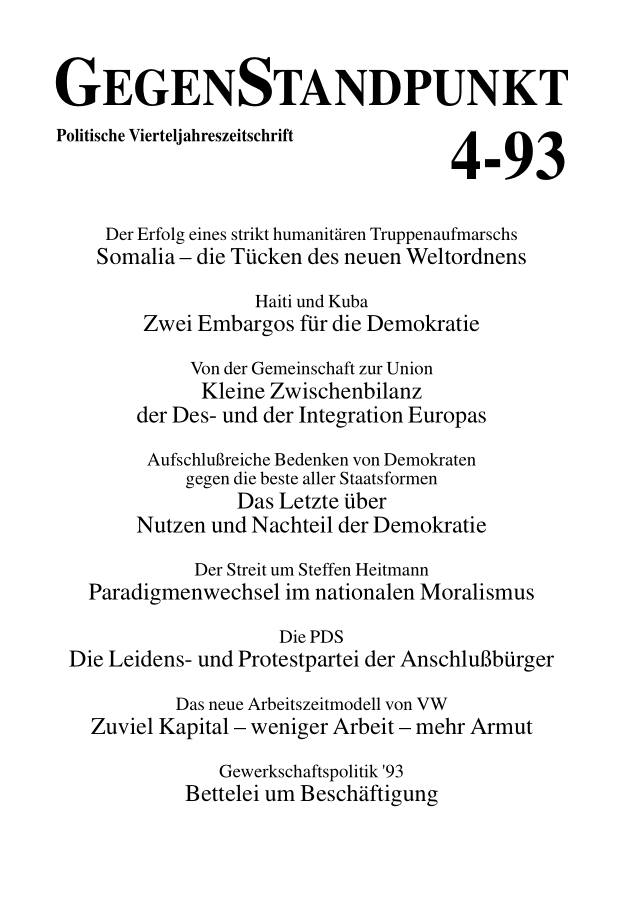Von der Gemeinschaft zur Union
Kleine Zwischenbilanz der Des- und der Integration Europas
Der Ausbau der europäischen Wirtschaftsunion zur vollständigen Wirtschafts- und Währungsunion ist in einer Krise: Deutschland konfrontiert das ökonomische Einigungswerk mit einer verschärften Anspruchshaltung und stellt das Einigungswerk damit vor eine Zerreißprobe. Andererseits wird der Anspruch formuliert, dass Europa sich neuen politischen Ordnungsaufgaben innerhalb und außerhalb Europas stellen muss, um neben den USA eine „europäische Identität“ zu erlangen; darüber soll die politische Integration Europas vorankommen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Von der Gemeinschaft zur
Union
Kleine Zwischenbilanz der Des- und
der Integration Europas
Am 1.11.93 ist der Vertrag von Maastricht in Kraft getreten und die EG zur Europäischen Union (EU) ausgerufen worden. Auf der gemeinsamen politischen Tagesordnung der Partnerstaaten steht freilich nicht der Fortgang zur – eigentlich beschlossenen – supranationalen Einheit, vielmehr eine vor allem von Frankreich und der BRD getragene Politik der höchstamtlichen Versicherungen, daß das Projekt keineswegs abgesagt sei.
Aus gutem Grund: Das Erreichte ist mehr als wacklig geworden – und um so fundamental(istisch)er auf der anderen Seite das Interesse, die machtpolitische Konkurrenz der beteiligten Nationen unter Kontrolle zu halten.
„Europäische Union“: Ein gescheitertes Programm tritt in Kraft[1]
Mit dem nunmehr zwei Jahre alten Beschluß, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft zur vollständigen Wirtschafts- und Währungsunion umzugestalten, ist alles in die Krise geraten, was diesen Umbau so vorbereiten sollte, daß er am Ende als naturwüchsige und gar nicht mehr aufzuhaltende Konsequenz aus den erreichten Fortschritten hätte vorgenommen werden können; und zwei Jahre Krise haben mittlerweile einiges demontiert.
So vor allem das Europäische Währungssystem, über das die Beteiligten zuvor so erfolgreich wechselseitige Kreditgarantien abgegeben hatten, daß die von den Staaten in Bewegung gesetzten Kreditsummen gewaltig anwuchsen, deren Wert trotzdem stabil blieb und alle EG-Gelder als brauchbare Äquivalente der wuchtigsten und vorbildlich starken, nämlich der deutschen Währung galten, die darüber zur Weltwährung wurde. Das im Unions-Vertrag von Maastricht zugrundegelegte Ideal, dieses System der allseitig garantierten Paritäten ließe sich bruchlos zur Gemeinschaftswährung fortentwickeln, ist an der im gleichen Vertrag festgeschriebenen Bedingung gescheitert, daß alle teilnehmenden Staaten „stabilitätspolitische“ Kriterien zu erfüllen hätten, von denen feststand, daß sie von den meisten gar nicht zu erfüllen waren – bzw. nur um den Preis einer nationalen Entschuldungsoperation, die einem Staatsbankrott mit anschließender Währungsreform hätte gleichkommen müssen. Zu diesem Extrem ist es – bislang – nirgends gekommen, weil das den Kredit auch aller anderen EG-Partner ruiniert hätte. Die internationale Finanzwelt hat aber ihre Konsequenzen aus einem Sanierungsgebot gezogen, das die europäischen Gemeinschaftspartner ganz unterschiedlich trifft, und mit einigen Spekulationswellen die Staaten zu dem kaum kaschierten Offenbarungseid gezwungen, daß keiner mehr nach den ursprünglichen EWS-Regeln für den Kredit seiner Partner eintritt. Abwertungen waren die Folge; die Freiheit der davon betroffenen Regierungen, sich für ihre Programme zur Krisenbewältigung Kredit zu nehmen, ist damit nachhaltig beschränkt.
Zerstört ist außerdem die wesentliche Geschäftsbedingung für den formell seit dem 1.1.93 existierenden EG-Binnenmarkt. Denn dessen administrativ herzustellende „Binnen“-Qualität relativiert sich ökonomisch gewaltig, wenn es gar nicht überall gleich gutes Geld ist, das sich in seinen verschiedenen Ecken verdienen läßt. Über die nicht mehr äquivalenten nationalen Gelder scheidet sich der eine große Kapitalstandort Europa schärfer als unter den Bedingungen des funktionierenden EWS in national definierte Standorte. Deren Konkurrenz bekommt dadurch zusätzliche Akzente, daß sie, ebenfalls seit zwei Jahren, nicht mehr um Anteile am gesamteuropäischen Wachstum geführt wird, sondern um die Verteilung des Schadens aus der europaweiten „Rezession“. Längst ist soviel Gemeinsamkeit hergestellt, daß die Krise in einem Land unweigerlich auch die Partner in Mitleidenschaft zieht; eben damit sind aber nicht europaweit etwa gleiche Geschäftsbedingungen durchgesetzt, sondern um so mehr Unterschiede in der Konzentration kapitalistischer Stärken und Schwächen auf den verschiedenen nationalen Territorien. Diese Unterschiede wirken sich in der Krise ruinös gegen die Schwächeren aus; dazu brauchen die Wirtschaftspolitiker der konkurrierenden Partner noch nicht einmal viel hinzuzutun.
Es ist aber außerdem so, daß die politisch Verantwortlichen aus der Krise, in die die Finanzspekulation das EWS gestürzt hat, den Schluß gezogen haben, sie müßten rücksichtslos national kalkulieren und handeln, um notfalls auf Kosten der anderen bei sich vom Wirtschaftsstandort Europa zu retten, was zu retten ist. Also tun sie alles für die Kapitalstandortqualitäten ihrer jeweiligen Nation. Die bemerkenswertesten Aktivitäten sind dabei auf deutscher Seite zu registrieren, weil Deutschland auch in der Krise noch in der stärksten Position ist; vor allem beim Geld. Für diesen wuchtigsten Vorteil, den ihre Nation dem europäischen Geschäftsleben zu bieten hat, setzen die Zuständigen sich mit Nachdruck ein; vor allem in der Weise, daß sie jegliche Verpflichtung von sich weisen, für die Kreditwürdigkeit ihrer Partner mit einzutreten – eine besonders überzeugende Art, Währungsspekulanten auf die starke Konkurrenzposition der deutschen Währung und die Schwäche der anderen hinzuweisen.
Ganz im Geist dieser Konkurrenz hat die Bundesregierung den Streit um die Adresse des Europäischen Währungsinstituts geführt, das ab 1.1.94 seine Tätigkeit als Vorläufer und Wegbereiter der Europäischen Zentralbank aufnehmen wird. Zwar ist überhaupt nicht klar, wie dieses Institut seinen Auftrag wahrnehmen, geschweige denn wahrmachen soll, die nationalen Gelder „einander anzunähern“, für feste Paritäten zu sorgen und die Regierungen auf eine dafür als zweckmäßig erachtete Währungspolitik festzulegen. Eben deswegen aber hat die deutsche Seite darauf bestanden, das Institut nach Frankfurt und damit die Definition seiner Politik unter ihre Kontrolle zu kriegen. Sie hat es dafür beinahe auf eine offizielle Kündigung jeder gemeinsamen europäischen Kredit- und Währungspflege ankommen lassen und auf diese Weise unmißverständlich klar- und festgestellt, daß sie die Exklusivität ihres Weltgeldes und ihre nationale Souveränität in der Verfügung darüber wahrt und kompromißlos gegen die Interessen ihrer Partner verteidigt. Die haben sich lieber erpressen lassen, als sich von den Deutschen die Absage einzuhandeln, daß andernfalls eine europäische Geldpolitik überhaupt nicht in Frage kommt und erst recht keinerlei Aussicht auf eine gemeinsame Währung mit Deutschland besteht. Daß die Bonner Regierung auf ihr unveräußerliches Entscheidungsrecht in dieser Frage gepocht und als Garantie dafür den Standort am Main durchgesetzt hat, nehmen sie wie ein deutsches Bekenntnis, daß der Stärkste im Bunde nach wie vor, wenigstens im Prinzip, zu dem Maastrichter Projekt steht. Bekannt haben sich die Deutschen allerdings bloß zu den darin vorgesehenen Stabilitätskriterien für eine Teilnahme an der Währungsunion, und zwar in der Auslegung, daß alle Partner in ihrem Bemühen um „Konvergenz“, um Minderung und Ausgleich der gröbsten Nachteile ihres nationalen Wirtschaftsstandorts, strengste Haushaltsdisziplin zu wahren haben. Den zahlreichen Paradoxien der Europapolitik fügt die deutsche Seite damit die Zumutung an die schwächeren Partner hinzu, sich in ihre politökonomische Zweit- bis Drittrangigkeit zu fügen, eine Hierarchie der Nationen als bleibendes Ergebnis der europäischen Einigung zu akzeptieren und den Versuch zur Herstellung europaweit ähnlicher kapitalistischer Erfolgsbedingungen abzuschreiben.
Auch so großherzige Angebote des Maastrichter
Vertragswerks wie der Kohäsionsfonds
können da
nichts mehr beschönigen; denn wenn die bedürftigen
Regierungen, die darauf Anspruch erheben können, das
Sparsamkeitsgebot befolgen, das von Deutschland und
seiner Geldpolitik ausgeht, dann bringen sie nicht einmal
die unerläßlichen Eigenmittel auf, zu denen dann die
Gelder aus dem Fonds – „subsidiär“, wie das im von den
Deutschen eingeführten EG-Sprachgebrauch heißt –
hinzukommen könnten. Was die anderen Posten des
EG-Haushalts betrifft, so haben die deutschen
Europapolitiker ihr früheres Einverständnis mit
Verteilungsmechanismen, die schwächere Partner
begünstigen und die BRD zum „größten Nettozahler“ gemacht
haben, widerrufen. Die Rechnung, daß Deutschlands
Vorteile aus dem freien Zugriff auf die Märkte aller
Partner allemal unvergleichlich mehr zu Buche schlagen
als ein paar Milliarden verlorener Zuschüsse an den
EG-Haushalt, gilt nicht mehr; Deutschland will sich
unmittelbar schadlos halten, mindestens. So wird zur Zeit
darum gekämpft, daß eine Wirkung der eigenen
Währungspolitik, die Abwertung der Partnerwährungen und
in der Folge des ECU, nicht – wie nach dem Rechnungswesen
des Agrarhaushalts mit seinem „grünen ECU“ eigentlich
fällig – die Summen mindert, die die Bonner Regierung aus
Brüssel für ihre Bauern überwiesen bekommt. Es wird darum
gestritten, daß die Gemeinschaftsbeschlüsse zur
Stillegung landwirtschaftlich genutzter Flächen auf die
Agrarzonen der ehemaligen DDR nicht angewendet werden
müssen. Überhaupt will Bonn für seine Ostzone
zurückerhalten, was es in den EG-Topf zugunsten
„strukturschwacher Regionen“ einzahlt. Der liberale
Wirtschaftsminister kämpft um Subventionen für die
Rettung deutscher Stahlstandorte im Osten und
gleichzeitig gegen Subventionen zur Rettung italienischer
und spanischer Stahlindustrien. Und so weiter. Was die
Belastung der EG durch die
freiheitlich-marktwirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem
befreiten Osteuropa betrifft, nämlich die
Konkurrenznachteile einer „Marktöffnung“ – was man allen
anderen, und denen im Osten schon gleich, als elementare
Vorbedingung für zivilisierte Kontakte zumutet, das kennt
man auf der eigenen Seite ganz genau als Last, deren
Übernahme man sich souverän und sehr genau überlegt! –
sowie die Kosten der „finanziellen Kooperation“, so
verbucht der deutsche Regierungschef ganz
unvoreingenommen den Löwenanteil auf seiner Seite und
fragt sich ganz nachdrücklich, ob das denn richtig sein
kann.
Die sich häufenden Verfahren „Deutschland gegen EG“ – z.B. wegen Geschäftsschädigung deutscher Bauern durch EG-Maßnahmen gegen die Schweinepest – sowie „EG gegen Deutschland“ – z.B. wegen monopolistischer Gestaltung des Kali-Bergbaus und -Marktes – sind auch nicht einfach Routine in einem zusammenwachsenden Europa, das ganz natürlicherweise entsprechend mehr Streitfälle zu regeln hat. Immerzu werfen sie für deutsche Politiker die Frage auf, ob die Gemeinschaft und erst recht deren Fortentwicklung zur Union sich für die Nation überhaupt noch lohnt. Die Frage ist gleichbedeutend mit einer nationalen Anspruchshaltung, die bislang Selbstverständliches als Zugeständnis definiert und bisherige Zugeständnisse untragbar findet.
Gleichzeitig konfrontieren die Unions-Kollegen einander mit einem rücksichtslosen Kampf um Absatzmärkte und Zugriffschancen in dritten Ländern, die exklusiv jeweils „ihren“, nämlich den auf ihrem jeweiligen nationalen Boden oder von ihm aus operierenden Kapitalisten zugute kommen sollen. Die französische GATT-Politik ist dafür nur das hierzulande aus Eigeninteresse am aufgeregtesten breitgetretene Beispiel. Führende deutsche Staatsmänner sind sich nicht zu schade, für den Erfolg einheimischer Bewerber um ausländische Aufträge gegen Konkurrenten aus EG-Nachbarländern durch die Welt zu reisen, Druck zu machen, mit Mitteln aus dem „Entwicklungshilfe“-Etat besonders günstige Finanzierungen zu arrangieren – und das auch noch an die große Glocke zu hängen. Selbst der Kanzler verliert in diesen schweren Zeiten jede Hemmung, wie der Generalvertreter von Siemens und Konsorten in China aufzutreten und den Erfolg seiner Exkursion in den paar Milliarden zu beziffern, die deutsche Unternehmen jetzt dort verdienen können – eine Wirkung der Krise in Deutschland, gewiß; gleichzeitig aber ein Beispiel für die Aggressivität, mit der die europatreuen Deutschen sich keineswegs für Europa, sondern für den Standort Deutschland gegen alle anderen Nationalökonomien der kapitalistischen Welt einsetzen.
Alles in allem ergibt sich so ein klares Bild. Das Programm einer immer engeren Wirtschafts- und Währungsunion läuft nicht. Die Staaten, die bereits ihre Bereitschaft beurkundet haben, ihre nationale Ökonomie demnächst als Teil einer EU-Nationalökonomie zu betrachten und zu handhaben, nehmen gegeneinander den Standpunkt rein national kalkulierter „Standortsicherungsprogramme“ ein. Das „europäische Deutschland“ macht seine Vorteilsrechnungen ultimativ gegen die Fonds, Einrichtungen und Haushaltsposten der Gemeinschaft geltend. Wesentliche, für das Maastrichter Projekt unerläßliche Garantien sind gekündigt, weitergehende Kündigungen erreichter Gemeinsamkeiten unter dem Titel „Subsidiarität“ angekündigt – denn der Klartext dieses Fremdworts heißt: Gemeinschaftsmittel und -garantien sollen Eigenleistungen der Mitglieder nicht ersetzen; nur wo nationaler Aufwand sich lohnt, schießt die zentrale Kasse zu.
Dieser ganze Laden heißt seit dem 1.11.93 „Europäische Union“.
Die Europa-Gegner werden aktiv
Mit der Konkurrenzlage in Europa hat sich die Diskussionslage in der BRD gewandelt. Die Anti-Europäer sind aktiv geworden. Polemisch auf dem Vorrang nationaler Interessen vor EG-Befugnissen und gesamteuropäischen Gesichtspunkten zu bestehen, ist kein Privileg der radikalen Rechten mehr. Auch in den seriösen Abteilungen der Parteienlandschaft und der Öffentlichkeit machen sich Einwände breit, die über die alten Fassungen der nationalen Anti-Europa-Legende vom „Zahlmeister Deutschland“ hinausgehen und erst recht über so vergleichsweise fachmännische Vorbehalte wie den, eine Währungsunion könne gar nicht einfach so beschlossen und politisch „gemacht“ werden, sondern nur als krönender Abschluß zu einer in allen Punkten vollendeten Einheit völlig einheitlicher nationaler Ökonomien hinzutreten „wie eine Fee“ (Ein Wirtschaftslyriker der „Süddeutschen Zeitung“). Mag sein, daß solche vornehmen Bedenken auch früher schon nichts weiter als Einkleidungen eines nationalen Standpunkts waren, der jeden Supra-Nationalismus als Verrat am einzig wahren politischen Subjekt, Deutschland eben, abgelehnt hat. Inzwischen werden solche prinzipiellen Absagen aber auch ungefähr so prinzipiell vorgetragen und deswegen noch lange nicht als „ewiggestrige“ Borniertheit aus dem demokratischen Konsens der Nation herauszensiert.
Als Berufungstitel, ohne den die neue Europagegnerschaft sich immer noch nicht sehen läßt, durch den sie sich aber zu einigem Radikalismus befugt weiß, fungiert „der Bürger“ mit seiner „Europa-Verdrossenheit“. Dem Publikum wird Verärgerung über den „Brüsseler Bürokratismus“ und dessen „Regelungswut“ unterstellt – völlig jenseits der Frage, ob der Normalverbraucher überhaupt merkt, wann eine EG- und wann eine nationale oder lokale Regelung ihn trifft, und ob es da überhaupt einen anderen Unterschied gibt als den, daß im ersten Fall eine regionale Bürokratie mit ihren politischen Häuptlingen und deren Lobby zu kurz kommt. „Angst“ wird diagnostiziert und für „nicht unberechtigt“ erklärt, nämlich die vor einem „Verlust der nationalen Identität“ – was auch immer das sein soll, diese Identität, die offenbar bei leichtester Berührung verlorengeht. Nicht bloß das Agitationsmuster, auch die Agitationsinhalte sind großenteils identisch mit denen der unvergeßlichen deutschen demokratischen Asylrechtsdebatte. Ähnlich wie damals kommt die Agitation mit der „Stimmung“, die man dem Publikum unterstellt, bei diesem sachgerecht an, seit ihm auch von ganz oben, von CDU-Parteitagen und dem Präsidentschaftskandidaten Heitmann, ein Menschenrecht auf nationale Borniertheit zuerkannt und die Sprachregelung gepflegt wird, Europa müsse „wachsen“, keinesfalls dürfe man es dem Bürger „überstülpen“. Die Verfechter dieser Anti-Europa-Linie sehen sich ihrerseits durch das Bundesverfassungsgericht ins Recht gesetzt: Das hat zwar die Verfassungsbeschwerden gegen den Vertrag von Maastricht zurückgewiesen, aber nur aufgrund der regierungsamtlichen Versicherung, mehr als eine Allianz souveräner Staaten sei nicht beabsichtigt, und nur unter dem Vorbehalt, daß nicht eintritt, was das erklärte Ziel, gerade auch der Bundesregierung, bei der Aushandlung des Vertragswerks war: daß der „Weg zur Union unumkehrbar“ wird.
Zum offiziellen Geburtstag der EU hat dann der bayerische Ministerpräsident diesen Standpunkt mit Hilfe der für seine Interview-Wünsche aufgeschlossenen „Süddeutschen Zeitung“ öffentlich auf den Punkt gebracht:
„Wir streben keinen europäischen Bundesstaat mehr an. SZ: Sie sagen gleichzeitig, Sie wollen europäische Integration. Wie soll das zusammengehen? Stoiber: Ich will ja auch den Integrationsprozeß verlangsamen.“ „SZ: Das ist ein historischer Bruch in der Tradition der Union seit Konrad Adenauer. Stoiber: Das ist richtig.[2] Diesen Bruch vollzieht die Union jetzt insgesamt. SZ: Nicht insgesamt. Stoiber: Ja nun, die CDU hat … den Bundesstaat aus ihrem Grundsatzprogramm herausgestrichen.“ „…darf es keinen Bundesstaat Europa, sondern nur einen Staatenbund geben. … Staatenbund bedeutet, daß jede Kompetenz einzeln und immer wieder neu übertragen werden muß und auch wieder zurückgenommen werden kann.“ Und so weiter. (SZ, 2.11.93)
Damit war einmal im Klartext die Kündigung des Projekts ausgesprochen, die EG irreversibel zur Union zu machen, die über eigene, von den Mitgliedsstaaten unwiderruflich abgegebene Kompetenzen verfügen und allen Ernstes die teilnehmenden Nationen erst „überwölben“, dann zusammenfassen soll. Und immerhin ist Stoiber aus dem Bundeskanzleramt und von seinem Parteichef Waigel auch bestätigt worden, er sei in der Sache gar nicht weit weg von der Linie, auf der man von Bonn aus die „Einigung Europas“ betreibe.
„Krieg oder Frieden“: Unschlagbares Argument, bleibender Grund und eigentlicher Inhalt für ein uniertes Europa
Die grundsätzliche Absage allerdings wollte die Bonner Regierung auf gar keinen Fall so stehen lassen. Schließlich bemüht sie sich schon seit der letzten EWS-Krise im Sommer 93, die sie immerhin mit der Aufkündigung der innereuropäischen Währungsgarantie, sogar zwischen DM und Franc, beendet hat, um Demonstrationen ihres dennoch fortbestehenden Europawillens und ihrer unverbrüchlichen Sonderbeziehungen zu Frankreich. In demselben Sinn hat sie auf den Vorstoß aus München mit einer kleinen Kampagne zur Bekräftigung der Europa-Argumente geantwortet, die für die deutsche Politik nach wie vor verbindlich seien.
So weiß man seither wieder, daß Deutschlands politische Führung weiß, wie dringend die deutsche Nationalökonomie den freien Zugriff auf die Märkte ihrer Partner, also den europäischen Binnenmarkt braucht und auf weiterer ökonomischer Integration besteht. Zur Kenntnis nehmen soll das vor allem die internationale Finanzwelt und sich überzeugen lassen, daß es ganz verkehrt wäre, auf weiteren Zerfall der Wirtschaftsgemeinschaft und den Ruin eines der Partner zu spekulieren, gegen die und auf deren Kosten Deutschland sich nach wie vor mit allen Mitteln durchzusetzen sucht. Den europaschädlichen Wirkungen ihrer eigenen Politik setzt die Bonner Führungsmannschaft – zwar nicht die Rückkehr zum alten EWS mit seinen Garantien, dafür aber mit um so größerem Nachdruck – den Schein entgegen, den die Geschäftswelt akzeptieren und kreditieren soll: daß Starke und Schwache in der EU neben aller erbitterten Konkurrenz unwiderruflich zusammen- und füreinander einstehen. Denn daß eine voll durchgezogene Mißtrauenserklärung des Finanzkapitals gegen einen wichtigen Partner nicht bloß diesen, sondern den Kredit der Gemeinschaft insgesamt und die Position der DM als Weltwährung genauso ruinieren würde, das ist denselben Politikern klar genug, die gleichzeitig nichts vom Nationalismus ihrer EG-Rechnung zurücknehmen und betonen, daß man sich in Deutschland auf keinerlei eigensüchtig motivierte Vorstöße der Partner einläßt und den Fortgang des „Maastricht-Prozesses“ kompromißlos unter Kontrolle hält.
Dieser doppeldeutigen Beteuerung, wie sehr Deutschland Wirtschaftspartner benötigt, die sich alles vorschreiben lassen, fügt der Chef der Nation in letzter Zeit mit wachsendem Nachdruck einen ganz übergeordneten Gesichtspunkt hinzu, der Deutschlands bedingungslosen Europawillen begründen und garantieren soll: Die „Gespenster des Nationalismus“ seien noch keineswegs besiegt und auch in Westeuropa noch nicht ausgestorben; ihre verheerenden Wirkungen seien auf dem Balkan zu besichtigen; die Einigung Europas sei daher eine Angelegenheit von Krieg oder Frieden.
Mit der Beschwörung dieser apokalyptischen Alternative will der Kanzler allen Zweiflern und Europagegnern etwas definitiv Überzeugendes entgegensetzen – und nicht nur das. Den Auflösungstendenzen selbst, die nicht zuletzt ihre Europapolitik herbeigeführt hat, begegnet die Bundesregierung mit der Propagierung eines übergeordneten, ganz außerökonomischen Zwecks, den die Europäische Union auch noch und vor allem hat: Sie will die Union auf höchster Ebene, nämlich der der reinen Machtfrage, weil sonst die gesamte politische Lage gefährlich und unkontrollierbar wird.
In dieser „Flucht nach vorn“, hin zu den letzten Fragen des souveränen Gebrauchs staatlicher Macht, ist ein Eingeständnis enthalten: Die Vereinigung der EG-Nationen zu einem supranationalen Gebilde geht so nicht wie bisher versucht; mit der Institutionalisierung immer engerer ökonomischer Abhängigkeiten und deren kollektiver Verwaltung, diesem eigentümlichen Versuch, eine neue Souveränität „von unten wachsen“ zu lassen, ist ein geeintes Europa nicht zustandezubringen. Mit der im Maastricht-Vertrag vereinbarten Abschaffung der nationalen Gelder ist die Souveränitätsfrage gestellt. Und kaum gestellt, ist sie auch schon negativ entschieden: Allein wegen politökonomischen Sachzwängen, die sie selber berechnend eingerichtet haben, geben die westeuropäischen Staaten ihre Hoheit nicht auf. Mit dieser Klarstellung ist die „schleichende“ Integration nach bewährtem Muster gestoppt, und nicht nur das: deren bisherige Errungenschaften geraten selber in Gefahr. Denn einmal die Souveränitätsfrage aufgeworfen und zum Leitfaden genommen, erweisen sich alle etablierten und bisher so produktiven „Sachzwänge“ der Einigung als lauter Relativierungen der nationalen Hoheit – eben das decken die Europa-Kritiker vom Schlage Stoibers mit ihren scheinbar so lächerlich-inadäquaten Beschwerden über „Zentralismus“ und „Regelungswahn“ in Brüssel im Grunde bloß auf, und wegen dieser Optik, nicht weil es um großartige Dinge ginge, entfalten ihre Beschwerden überhaupt bloß Wirkung.
Zu diesem Ergebnis fällt dem deutschen Kanzler also die letzte Machtfrage ein: Krieg oder Frieden. Und das ist nicht bloß eine geschichtsphilosophische Mahnung, eine warnende Erinnerung an den vorigen Weltkrieg, dessen Wiederholung durch Europas Einigung für immer unmöglich gemacht werden sollte. Mit seinen gerade erst wieder virulent gewordenen „Gespenstern des Nationalismus“ weist der deutsche Regierungschef auf die aktuellen und absehbaren Problemfälle einer europäischen Ordnungspolitik, die zunächst einmal den alten Kontinent, auf längere Sicht auch dessen weiteren Umkreis erfolgreich befrieden will; einer Ordnungspolitik, wie sie jede der namhaften EU-Mächte als ihre Sache ansieht – und für deren Durchführung keine von ihnen, allein auf sich gestellt, mächtig genug ist. Wenn sie ihre Macht nicht so vergemeinschaften, daß sie als Union unwiderstehlich jeden Frieden stiften können, den einer der Beteiligten für nötig hält, dann – so der schlagende Gesichtspunkt für Europas Einigung – müssen die westeuropäischen Staaten mit Kriegen in ihrer Nachbarschaft rechnen, die sie nicht wunschgemäß beherrschen. Jugoslawien ist der exemplarische Fall für diese Erkenntnis; aber über die Lage in der wunschgemäß zugrundegegangenen und national aufgeteilten Sowjetunion machen Kohl und seine Kollegen sich auch nichts vor.
Und nicht nur das. Die Besorgnis führender europäischer Machthaber für den Fall, daß eine weitergehende Integration ihrer Staaten ausbleibt, entstammt ihrer Gewißheit, daß keiner von ihnen sich durch fehlende Macht davon abhalten läßt, in die politischen Zustände und vor allem Zerwürfnisse bei ihren Nachbarn hineinzuregieren, notfalls mit Waffengewalt. Daß sie je für sich allein für gewisse Arten des Durchgreifens zu schwach sind, macht sie ja nicht bescheiden. Die in der EU versammelten Mächte haben ihre Ansprüche auf wirksame Bevormundung Dritter; erworben in den Zeiten, als sie noch unter amerikanischer Führung „der Westen“ waren und gemeinsam die „freie Welt“ unter Kontrolle hatten. Sie haben diese Ansprüche nicht reduziert, seit die übermächtige Bedrohung aus dem Osten verschwunden und die Beschränkung ihrer Kontrollmacht auf den Globus außerhalb des „Ostblocks“ aufgehoben ist, sondern nach oben angepaßt und nach Osten ausgedehnt; sie betrachten seither dieses weite Feld mit der gleichen Anspruchshaltung, die der Rest der Welt bislang schon von seinen kapitalistischen Führungsmächten kennengelernt hat; nämlich so, als wäre die Fügsamkeit der demokratisch erneuerten osteuropäischen Nationen ihr selbstverständliches und unwidersprechliches Recht. Und auf der anderen Seite: Sie haben Ansprüche aneinander, was die Unterstützung ihrer nationalen weltpolitischen Anliegen durch die Partner betrifft. Wenn fortwährend von „politischen Aufgaben“ die Rede ist, für deren Bewältigung der Nationalstaat heute „zu klein“ sei, dann erklären die Machthaber der Europäischen Union damit ja weder ihren Abschied von der Weltpolitik noch ihre Unterwerfung unter die Beschlüsse supranationaler Instanzen, sondern kündigen an und sprechen sich das Recht darauf zu, daß sie ihre Nachbarn und Partner für ihre Interessen mit Beschlag belegen. Die deutsche Regierung z.B. leitet aus der Lage ihrer Nation in der Mitte Europas die gebieterische Notwendigkeit ab, bei allen Nachbarn nach dem Rechten zu sehen[3]; umgekehrt sehen Deutschlands Nachbarn ihre nationale „Schicksalsfrage“ hauptsächlich darin, ob ihnen die „Einbindung“ dieses mächtigsten Mitglieds in eine gemeinsame Politik gelingt.[4] Auch diese gegenseitigen Ansprüche auf „Zusammenarbeit“ sind in den Zeiten der unauflöslichen westlichen Versicherungsgemeinschaft zu einmaliger Größe herangewachsen. Jetzt, wo es den äußeren Zwang nicht mehr gibt, der die alte Allianz so unverbrüchlich gemacht hat, treten sie unweigerlich in Konkurrenz zueinander – und das wird nach Einschätzung der führenden Machthaber selber furchtbar, wenn sie nicht auch ohne den Druck der alten „Weltlage“ eine Einigung hinkriegen. Denn aus dem bislang noch als Gemeinschaftsaktion gedachten Zugriff auf den restlichen Kontinent und darüber hinaus, aus der Kontrolle über die Affären in und zwischen den weniger intakten Staaten, würde ein ausschließendes „Du oder Ich“; aus der gewohnten wechselseitigen Stützung und Benützung würde ein feindseliger Streit um Unterordnung oder Entzug, Gefolgschaft oder Opposition.
Diese Gefahr ist jetzt akut. Nachdem die quasi automatische Preisgabe nationaler Souveränität an ein neues weltpolitisches Subjekt, an eine von sich aus souverän handelnde EU, gescheitert und ausgeschlossen ist, geht es ganz praktisch um die Alternative, die der deutsche Kanzler mit seinem Friedensargument für Europa beschwört: Entweder die Mitglieder der EU kriegen neben und ungeachtet ihrer Souveränität eine gemeinsame Ordnungspolitik hin und schaffen sich gemeinsame Machtmittel; oder verschiedene nationale Zuständigkeitsansprüche und Ordnungspolitiken kollidieren auf engstem Raum, deren Vertreter rutschen in ein zunehmend polemisches Verhältnis zueinander, und die Möglichkeit von Krieg ist wieder da.[5]
Aus übergeordneten weltpolitischen Gründen den Zerfall vermeiden, nachdem die Einigung über den politökonomischen Schleichweg gescheitert ist – dieses defensive Ziel hat seine offensive Kehrseite. Es wird damit nämlich ein wenig neu definiert, was der politische Inhalt der EU sein soll – und werden muß, wenn sie überleben soll: Jenseits von Binnenmarkt und Währungsunion sollen die Europäer sich endlich direkt um die fundamentalen Machtfragen kümmern und eine gemeinsame Entscheidungsmacht über Krieg und Frieden bilden. Ob sie darüber mehr Integration hinkriegen als über Marktordnungsfragen, ist zweifelhaft. Aber soviel ist jetzt klar: Wenn die Gemeinschaftspartner überhaupt jemals bereit sind, ihre Souveränität zu einem neuen Staatssubjekt zusammenzulegen, dann nur unter dem Gesichtspunkt, daß es um die Hegemonie über Europa geht. Das ist jedenfalls der Stoff der politischen Zusammenarbeit, den die deutsche Regierung auf die Tagesordnung ihres europäischen Vereins setzen will.[6]
Kohl hat sich dazu bereits mit Mitterrand zusammengetan. In einem gemeinsamen Brief an den belgischen Regierungschef, der derzeit den Vorsitz im Europäischen Rat innehat, beantragen die beiden De-facto-Chefs der EU eine wirksame Bündelung der weltordnungspolitischen Interessen der Gemeinschaftsstaaten und benennen als die vier wichtigsten Betätigungsfelder die Stabilität in Europa ganz allgemein, den Nahen Osten, das ehemalige Jugoslawien und Rußland: In Jugoslawien leiden sie an ihrer Konkurrenz; im Nahen Osten wollen sie nicht als Einzelne dazu verurteilt bleiben, abseits zu stehen; in Rußland fürchten sie die unbeherrschbare ökonomische und politische Katastrophenlage. Im gleichen Schreiben bekennen sie sich zur Stärkung der WEU. Und in der Woche nach Inkrafttreten des Maastricht-Vertrags haben Frankreich und Deutschland demonstrativ ihr gemeinsames „Euro-Korps“ als Vorläufer einer Unions-Streitmacht „in Dienst gestellt“.[7]
So wird das Vorhaben in die Tat umgesetzt, an dem sich Europas Schicksal nach dem Willen seiner Macher entscheiden muß: ein wirksames Abschreckungs- und Kontrollregime über Europa und angrenzende Gebiete zu errichten und auf diese Weise als eigenständiges imperialistisches Subjekt neben den USA und auf deren Kosten eine „europäische Identität“ zu gewinnen.
[1] Was in diesem Kapitel überblicksweise zusammengefaßt wird, ist in dieser Zeitschrift seit der ersten Nummer fortlaufend ausführlich kommentiert worden: GegenStandpunkt 1-92, S.31: 35 Jahre europäische Einigung – Was ist Europa? Was hat es vor? GegenStandpunkt 3-92, S.107: 35 Jahre EG, Teil II: Vom Staatenbündnis zur Staatsgründung GegenStandpunkt 4-92, S.105: Einige Anmerkungen, die Krise, Abteilung Europa, betreffend GegenStandpunkt 1-93, S.75: Die Krise in Europa und ihre Schadensfälle GegenStandpunkt 3-93, S.3: Die deutsche Krisenbewältigung: Standort-Pflege brutal GegenStandpunkt 3-93, S.107: Deutsche Außenpolitik 93: Die Einigung Europas / Die Erweiterung der EG nach Osten GegenStandpunkt 3-93, S.136: Erfolg und Scheitern des französischen Europa-Projekts: Europa in den Farben Frankreichs – mit Maastricht am Ende
[2] Stoiber spricht in
diesem Zusammenhang mit der Autorität des altgedienten
Parteiideologen eine Wahrheit über den berechnenden
BRD-Antifaschismus und über die nationale
Europagesinnung aus, die, als diese Heucheleien noch in
Kraft waren, nur von böswilligen Linksextremen
behauptet und stets empört zurückgewiesen wurde: Den
Bundesdeutschen ist mit „Europa“ ein Umweg geboten
worden, um sich aus den moralischen Bedenken gegen den
von Hitler so grandios vollendeten deutschen
Patriotismus herauszuschleichen und ideell wieder ins
imperialistische Weltgeschehen einzuklinken. Stoiber
heute: Die Befürwortung eines „überwölbenden“
europäischen Bundesstaats sei mit begründet gewesen
durch unsere geschichtlichen Belastungen. Wir
hofften, die Nation, die damals geteilte deutsche
Nation würde aufgehen in einer europäischen Nation, und
wir würden uns damit auch entlasten von den
geschichtlichen Verantwortlichkeiten.
Es gab
einmal eine europäische Bewegung in Deutschland, die
unter anderem auch glaubte, in der europäischen
Identität belastete deutsche Identität auffangen zu
können.
Stoiber drückt sich so klar aus, weil er
sich am Ende dieser Heuchelei weiß: Das ist
vorbei.
Er sieht nämlich Deutschlands neue Größe
als hinreichenden Grund für einen deutschen
Nationalismus ohne europäisches Versteckspiel an:
Mit der deutschen Wiedervereinigung haben wir nun
eine andere Situation – und wir müssen uns bewußt
werden, was die deutsche Identität eigentlich ist.
[3] Als ein Beispiel für
viele eine Bemerkung aus einer Rede Kohls von Ende
Oktober: Als Land mit den meisten Nachbarn in Europa
müssen wir Deutschen uns stets bewußt sein, daß die
Außen- und Sicherheitspolitik maßgeblich über unsere
Zukunft in Frieden und Freiheit entscheidet. Europa ist
für uns eine – wenn nicht die – Schicksalsfrage.
(Bulletin der Bundesregierung Nr.
94, 30.10.93)
[4] Die Memoiren der Lady Thatcher bieten die schönsten Belege für diesen Standpunkt, den gute Deutsche immer nicht verstehen können.
[5] Möglicherweise sind sich die Chefs der EU-Staaten derzeit noch nicht einmal mehr ganz sicher, ob ihre eigenen Nationen in Zeiten einer ewig sich hinziehenden Krise intakt bleiben und nicht selber zu ordnungsbedürftigen Problemfällen werden, wenn statt Integrationsbemühungen der „Rückfall in den Nationalismus“ auf der Tagesordnung steht. Schließlich mehren sich in Europa die Elendsregionen; und das macht selbst brave Völker unter Umständen unberechenbar. Zwar trauen sich Europas Wirtschaftsstandortpolitiker offenbar allemal zu, mit der „sozialen Frage“ als solcher fertig zu werden – sie werfen sie ja ganz unbefangen in aller Härte auf. Was aber die nationalistischen Konsequenzen betrifft, die in ihren Ländern fällig werden, wenn ihre Standortrettungsprogramme erst einmal gescheitert sind: da rechnet womöglich mancher mit national „unbeherrschbaren Situationen“, die auch international einiges durcheinanderbringen würden. (Sogar die Deutschen sollen sich ja für den Fall, daß die rechtsradikalen Parteien größer werden, Sorgen um ihre Absatzmärkte im Ausland machen…)
[6] Unter diesem
Gesichtspunkt gefällt Europa übrigens auch dem
bayrischen Ministerpräsidenten. Stoiber ergänzt seine
Absage an den „Brüsseler Zentralismus“ um die Forderung
nach einer „dauerhaften europäischen
Friedensgemeinschaft“ und bekennt sich zur „großen
europäischen Idee“: … die EG wurde doch nicht in
erster Linie als Rindfleischgemeinschaft gegründet.
Europa soll für Frieden stehen.
Auf ökonomischem
Gebiet hält der Mann die Vorteile, die die europäische
Integration der deutschen Nation bietet, für
ausgereizt; Dienste der Gemeinschaft für Deutschlands
„friedenstiftende“ Machtentfaltung nach außen, für den
Imperialismus seiner Nation, kann er sich hingegen sehr
gut vorstellen; da fürchtet er überhaupt nicht um die
„nationale Identität“. Im Unterschied zu Stoiber ist
den maßgeblichen deutschen Europa-Politikern offenbar
zumindest der Widerspruch eines so einseitig
konzipierten Benutzungsverhältnisses klar: Sie wissen,
daß sie eine imperialistisch taugliche Europäische
Union nur hinkriegen, wenn sie das pur nationale
Interesse daran dementieren.
[7] In denselben Zusammenhang deutsch-französischer Vorstöße in Richtung auf eine gemeinsame europäische Ordnungsmacht gehört der Einfall der Außenminister Kinkel und Juppé, zusammen ihrem polnischen Kollegen einen Besuch abzustatten und dort „den Wunsch Polens und anderer zentraleuropäischer Staaten“ zu unterstützen, „in die europäischen und transatlantischen Sicherheitsstrukturen stärker einbezogen zu werden.“ Sogar den „Wunsch Polens, Kontakte zwischen dem Eurokorps und den polnischen Streitkräften aufzunehmen“, nehmen sie „aufmerksam zur Kenntnis.“ (Bulletin der Bundesregierung Nr. 100, 18.11.93)