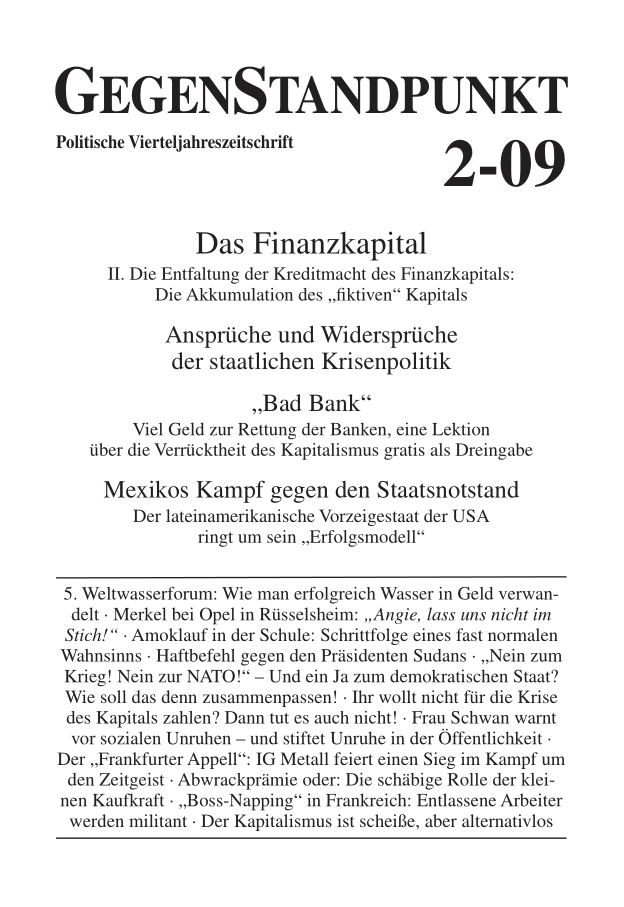Ansprüche und Widersprüche der staatlichen Krisenpolitik
Dem Staat ist aufgrund der Zerstörung von Kapital aller Art, von dessen Geschäftserfolgen er und „wir alle“ leben, eines klar: Die durch Misswirtschaft stornierten Dienste der Geldinstitute sind eine, wenn nicht die Säule des Allgemeinwohls. Die ökonomischen Potenzen des Finanzgewerbes sind zu erhalten bzw. wiederherzustellen; die sind wieder zum Gebrauch ihrer Finanzmacht zu befähigen. Ihre Rettung erfolgt durch hoheitliche Bereitstellung von Mitteln, zu deren Erwirtschaftung sie ermächtigt und gewöhnlich auch fähig sind. Daran fehlt es in der Krise. Die staatliche Politik setzt ihre Macht ein, dem abzuhelfen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Ansprüche und Widersprüche der staatlichen Krisenpolitik
I.
Dem Staat ist aufgrund der Zerstörung von Kapital aller Art, von dessen Geschäftserfolgen er und „wir alle“ leben, eines klar: Die durch Misswirtschaft stornierten Dienste der Geldinstitute sind eine, wenn nicht die Säule des Allgemeinwohls. Die ökonomischen Potenzen des Finanzgewerbes sind zu erhalten bzw. wiederherzustellen; die sind wieder zum Gebrauch ihrer Finanzmacht zu befähigen. Ihre Rettung erfolgt durch hoheitliche Bereitstellung von Mitteln, zu deren Erwirtschaftung sie ermächtigt und gewöhnlich auch fähig sind. Daran fehlt es in der Krise. Die staatliche Politik setzt ihre Macht ein, dem abzuhelfen.
a) Die rapide Kontraktion von Anlagegelegenheiten für das aufgehäufte Kapital der Gesellschaft bewirkt seine Zerstörung in allen erdenklichen Aggregatzuständen. Die heftigen Verluste beim anerkannten Lebensmittel „unserer Wirtschaft“ und das selbstverschuldete Unvermögen der Banken, ihre unverzichtbaren Dienste an der ökonomischen Basis der Nation im bisherigen Umfang fortzusetzen, rufen Kritiker aller Couleur auf den Plan, die sich zumindest in einem Antrag einig sind: Ob liberale Wirtschaftsjournalisten nach mehr Aufsicht über das Spekulationsgeschäft rufen, pensionierte Verfassungsrichter eine Neubegründung des Kapitalismus im Geiste des Naturrechts – wahlweise der christlichen Soziallehre – fordern oder inner- und außerparlamentarische Linke mit dem Gestus der Systemkritik mehr Volks- statt Kapitalfreundlichkeit auf den Kommandohöhen des demokratischen Gemeinwesens verlangen, alle rufen den Staat auf, den gemeinschädlichen Absturz des kapitalistischen Geschäfts aufzufangen.
Selten haben kritische Anträge an die Politik offenere Türen eingerannt; selten aber auch haben öffentliche Antragsteller mit ihrem Wunsch nach Wiederherstellung des sinnreichen Zusammenwirkens von Gewerbefleiß und verantwortungsvoll agierenden Bankhäusern so gründlich neben den real existierenden Verhältnissen des modernen Kapitalismus gelegen. Die herrschenden Politiker aller Parteien lassen derlei der marktwirtschaftlichen Idylle verbundene Petitionen gelten, aber keine Zweifel daran aufkommen, dass sie das wirklich Nötige unternehmen wollen. Ihrer scharfen Kritik an den schwarzen Schafen unter Spekulanten und Bankvorständen ist unschwer das entschiedene Lob der ordnungsgemäßen und rechtstreuen Leistungen des Finanzkapitals zu entnehmen. Vom Standpunkt der Brauchbarkeit dieser Branche, deren Erfolg den kapitalistischen Reichtum in Gefahr gebracht hat, wird dessen Rettung angegangen. Die ist, das wollen sie nicht bestreiten, zwar teuer, aber „ohne Alternative“.
Während normale Leute sich täuschen, wenn sie, nur weil sie davon abhängig sind, die Macht des Eigentums für ihr rettungswürdiges Lebensmittel halten, ist für die Staatsmacht die Lage klar: Sie hat schließlich nicht ihre Gesellschaft als Standort für tüchtige Privateigentümer eingerichtet, mit einer rechtsförmigen Geschäftsordnung auf Geldverdienen als ihren Lebensunterhalt verpflichtet und auf die damit verbundenen sozialen Unzuträglichkeiten aufgepasst, weil ihr diese Art Regierung gerade so recht wäre wie jede andere; sondern weil die politische Gewalt – sympathisierende Journalisten und Verfassungsrichter eingeschlossen – tatsächlich von diesen Verhältnissen lebt und sie deshalb so will, wie sie sind. In denen wird das Geld des Staates zu akkumulierendem Kapital, das die Arbeit seines Volkes als Quelle des privaten Geldreichtums bewirtschaftet. Am Erfolg der Ausbeutung sichert die öffentliche Hand sich ihren Anteil. Auf das Gelingen des privaten Kapitalwachstums richtet sich deshalb der staatliche Materialismus dergestalt, dass die Versorgung der mit diesem Wachstum befassten Gesellschaft mit vom Staat durch seine Notenbank „geschöpftem“ Geld und dessen Verwandlung in den Kredit des privaten Finanzwesens immer ein Gegenstand staatlicher Aufsicht und Betreuung ist. Wenn die Politik also eine krisenhafte Störung im Wirken der Geldinstitute konstatiert, in der diese das Interesse oder gleich die Fähigkeit verlieren, die Geschäftsleute aller Sparten weiter mit Vorschusskapital zu bedienen, dann nimmt sie das folgerichtig keineswegs als partikulares Problem, sondern als Gefahr für ihre ökonomische Staatsraison und das Allgemeinwohl überhaupt.
b) In Zeiten eines florierenden Geld- und Kreditwesens wird das Interesse der Politik an einem funktionierenden kapitalistischen Stoffwechsel zwischen dem Finanzwesen und dem Rest der Gesellschaft durch das private finanzkapitalistische Wachstumsinteresse des Gewerbes – seine notorische „Gier“ – in gemeinschaftsdienlicher Weise mit erledigt. Dafür hat, vom Standpunkt des Staates aus gesehen, dieser Berufsstand seine Lizenz erhalten und die Geschäftsbedingungen, innerhalb derer er seinen geschäftlichen Erfindungsreichtum, seine Freiheit zur privaten Bereicherung und zur Ausdehnung seiner Finanzmacht im Dienste der kapitalistischen Allgemeinheit ausleben soll.
Im Krisenfall, wenn der Geschäftsverkehr der Banken untereinander nur mehr eingeschränkt stattfindet und derjenige mit anderen Unternehmungen, die mit Hilfe ihres Kredits an der Verwertung ihrer Kapitalvorschüsse arbeiten, ebenfalls in maßgeblichem Umfang storniert wird, sieht sich die Politik in ihrer Verantwortung für das Große & Ganze zum Handeln aufgerufen: Sie kann dem Wegfall des Dienstes am System, den sie ihren materiell interessierten Finanzdienstleistern überantwortet hat, nicht tatenlos zusehen. Ohne diesen Dienst kann das kapitalistische Wirtschaftssystem der Gesellschaft, von dem die politische Gewalt lebt, nicht auskommen.
Deswegen wird unter Ausschöpfung aller staatlichen Finanzierungsquellen die Wiederherstellung der privaten Finanzmacht der Banken in Angriff genommen, denn mit dem politischen Insistieren auf den volkswirtschaftlich nützlichen Funktionen der „Kreditwirtschaft“ und der sonstigen „Finanzindustrie“ für das nationale Wachstum ist es in der Krise ersichtlich nicht getan. Zu der fortgeltenden Ermächtigung des Geldgewerbes, diese Funktionen zu seinem Vorteil auszuüben, muss die Wiederherstellung seiner Befähigung kommen. An der fehlt es jetzt, da allzu viele „Produkte“ der Finanzindustrie sich von begehrten Gewinnversprechen in uneinlösbare Zahlungsverpflichtungen verwandelt haben und die Prüfung produktiver Firmen, die um neues Leihkapital nachsuchen, ergibt, dass sie es nicht verdienen, weil sie ohnehin schon zu groß sind für ihre Märkte, resp. diese Märkte zu klein für den vielen Kredit, den sie schon anwenden. Mit den „Milliardenabschreibungen“ der Finanzinstitute sind ihre Geschäftsmittel geschrumpft und ist die laufende Kapitalversorgung der Gesellschaft in Mitleidenschaft gezogen. Der Staat, der die Entwicklung der Banken zu den machtvollen Zentralorganen des gesellschaftlichen Geld- und Kapitalflusses befördert hat, belässt es also nicht dabei, die Branche zur Wiederaufnahme des darnieder liegenden Geschäfts zu ermuntern.
c) Mit der Feststellung, die Geldwirtschaft sei infolge einer Kette misslungener Geschäfte in bedrohlichem Umfang „illiquide“ geworden, steht der staatliche Handlungsbedarf zur Rettung des Kapitalismus auf den Hauptschauplätzen der Krise fest: Es muss wieder „Liquidität“ ins System, aus dem sie so dramatisch geschwunden ist, und nur die öffentliche Hand verfügt in der gegebenen Lage über die Macht, sie zu schaffen.
Die Politik nutzt also ihre Verfügungsmacht über die Verschuldungsfähigkeit der Nation, um mit verfügbaren Haushaltmitteln, neuen Schulden und mit Mitteln der staatlichen Finanzinstitute einschließlich der Zentralbanken gewaltige Kontobewegungen in Gang zu bringen, mit denen das geschwundene Kapital von Banken und Versicherungen zumindest bis zur Wiederherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit aufgefüllt wird. Wo nötig, übernimmt der Staat bankrotte Institute, gibt milliardenschwere Bestandsgarantien für andere, tritt notfalls als Garant für entwertete „Assets“ ein, ändert im Eiltempo Bilanzierungsregeln für „unterkapitalisierte“ Geldhäuser, um dem gescheiterten Liquiditätsmanagement auch auf dem Rechtsweg wieder auf die Beine zu helfen, und scheut auch vor der Androhung von Enteignungen an die Adresse unkooperativer Aktionäre nicht zurück. Die politisch geschaffenen Finanzmittel werden zu niedrigsten Zinsen oder gleich zum Nulltarif, teils auch im Tausch gegen zweifelhafte Vermögenswerte, die man für „diskontfähig“ erklärt hat, ins Bankensystem eingespeist; und die damit verbundene Botschaft der staatlichen Stifter, die Wert auf die Feststellung legen, dass sie den Zusammenbruch „systemrelevanter Marktteilnehmer“ keinesfalls zulassen werden, ist eindeutig: Mit den von ihnen zur Verfügung gestellten Geldern und Garantien wären eigentlich die finanzkapitalistischen Bedingungen allgemeinen wirtschaftlichen Wachstums wieder hergestellt und die Aktivisten des Geldkapitals wieder imstande, ihr unverzichtbares Geschäftsinteresse im Dienste der Kapitalversorgung der Gesellschaft neu zu betätigen.
Der hoffnungsvolle Aufruf und der Verweis auf die staatlichen Rettungsaktionen macht allerdings für die Geschäftsführer der Geldwirtschaft, die auf der Grundlage gescheiterter Spekulationen und verlorener Geschäftsmittel ihre Bilanzen neu sortieren, den bereits eingetretenen Schaden nicht ungeschehen. Das politische Drängen auf Fortsetzung bzw. Wiederaufnahme des Geschäfts ignoriert die Verluste an Kapital und Vertrauen und die damit geschmälerte Geschäftsgrundlage des Finanzsektors. Es tut so, als seien mit dem staatlichen Einstehen für die Liquidität von Zahlungsunfähigkeit bedrohter Banken auch die Quellen ihrer Liquidität wiederhergestellt. Diese interessierte Vorstellung ist offenkundig sachfremd: Die jetzt so aufwändig Geretteten haben in Zeiten ihres gewöhnlichen business ihre allzeit gegenwärtige Zahlungsfähigkeit selbst organisiert. Sie haben sich dafür des branchentypischen Verfügungsrechtes über die Schulden der Gesellschaft bedient, die sie, variantenreich verbrieft und in Verkehr gebracht, als Wertpapiere aller Art mit Kursen und Renditen, zu ihrem Geschäftsmittel, zum Ursprung und Hebel ihrer wachsenden Finanzkraft, also zu ihrem Kapital gemacht haben. Diese so sonderbaren wie geläufigen Finanzprodukte und das im Handel mit ihnen bestätigte Vertrauen in ihre Kapitaleigenschaft sind der Ursprung der Liquidität der Banken, die in der Krise so arg gelitten haben. Wenn die hoffnungsfrohe Nachfrage nach renditeträchtigen Anlagen am Kapitalmarkt richtig abstürzt, gilt die nur auf diesen Handel gestützte Gleichung nicht mehr, dass eine mit einem Zahlungsversprechen „gedeckte“ Schuld so gut wie jedes andere Vermögen ein Stück Kapital sei. Wenn so etwas passiert, verwandeln sich vielversprechende Anlagen schlagartig zurück in ihren trüben Rohstoff, Schulden eben, um deren Bedienung die Gläubiger auch noch fürchten müssen. Staatliche Notmaßnahmen, mit denen der Zusammenbruch des Bankensystems verhindert werden soll, setzen aber kein „Schrottpapier“ wieder in Wert, bringen keine gestrichenen Milliardenfonds zurück und schon gleich nicht das „Vertrauen der Anleger“, zu deren größten die rettungsbedürftigen Banken selbst gehören. Vielmehr künden sie eben nur von der kapitalistischen Not, die sie erforderlich macht. Und wenn die staatlichen Rettungsmanöver manchen Geldhäusern das Eingeständnis ihrer Pleite ersparen und sie als Schuldner zahlungsfähig erhalten, dann setzt staatlich bereit gestellte Liquidität nicht die Gleichung zwischen Schulden und Kapital wieder in Kraft, sondern bestätigt eher die Ungleichung, dass dergestalt – und auch nur vorläufig – vor dem Scheitern bewahrte Verbindlichkeiten gewiss kein Kapital sind. Sie kommen vielmehr als „toxische Papiere“ in Verruf, die wegen des gewaltigen Wertverlustes, den sie erlitten haben, für die nächsten Jahre auf einer staatlich organisierten und finanzierten, finanzkapitalistischen Sondermülldeponie namens „Bad Bank“ weggesperrt werden, nicht ohne auf sie wieder neue Liquiditätshilfen an die Banken zu stützen, deren Geschäftsmittel zwar um diese schlechten Anlagen „bereinigt“, aber auch gekürzt sind.
Insgesamt ist festzustellen: Der Einsatz der staatlichen Rechtsmacht und bislang ungekannter öffentlicher Schulden in einem Umfang, der nach amerikanischen Vergleichen sogar die in Kriegsfällen bilanzierten Defizite übertrifft, behebt die Problemlage nicht. Das private Bereicherungsinteresse der Finanzkapitalisten kommt nicht oder nur zögerlich und nicht im gewünschten Umfang seinem öffentlichen Auftrag nach, und die staatlichen Stiftungsaktionen zugunsten des Geldgewerbes erweisen sich als der untaugliche Versuch, die Finanzmärkte zu einem Neustart zu animieren, als sei nichts geschehen.
Dass die Geschäftsmittel, mit denen die Banken sonst den Investitionsbedarf der Gesellschaft bereitwillig aus eigener, fortwährend gesteigerter Herstellung decken, jetzt überwiegend von staatlichen Konten stammen, ist stattdessen Stoff für bedenkliche Debatten über die Tauglichkeit und die Risiken der staatlichen Krisenbewältigung. Die fachmännischen Erwägungen, ob und wann die beispiellose Aufblähung der Staatsschulden zur Rettung des Finanzkapitals zu „Inflation“ wenn nicht „Hyperinflation“ führen müsse und ob die Verantwortlichen eine leider notwendige oder die ganz verkehrte Politik betrieben, sind ganz dem Standpunkt der parteilichen Sorge um den Erfolg der politischen Bemühungen verpflichtet und insofern als sachliche Beiträge von eher fraglichem Wert. Was sie aber – konsequenterweise – erkennen lassen, ist eine lebensnahe Auffassung über die Leistungen des Finanzkapitals und seiner Produkte: Wenn die sich vermehren, dann vermehrt sich der Reichtum der Nation, wenn auch nur bis zur nächsten Krise, so lange aber schon. Sie sind bei aller Luftigkeit ihrer verwegenen Konstruktionen, die ganz auf ein so flüchtiges Fundament wie das „Vertrauen der Märkte“ gründen, der solide – eben vertrauenswürdige – Ausweis des wirtschaftlichen Erfolges am Standort und in der Welt. Insofern sind die akkumulationstüchtigen Produkte der „Finanzindustrie“, weil sie Kapital sind, der gute Ersatz für staatliches Geld; zumal wenn dieses, wie in den heutigen Krisenzeiten, nur als Geld unterwegs ist, um das ramponierte Finanzwesen zu verpflastern, und im Dienst kapitalistischer Schadensbegrenzung.
Die massenhafte „Liquidität“, die derzeit von den führenden kapitalistischen Staaten in Umlauf gebracht wird, ohne dass die Erfolge der „Systemrettung“ schon gesichert wären, muss ihre „Fähigkeit“, als Kapital zu wirken, erst noch unter Beweis stellen. Die Debatten über entstehende „Inflationsgefahren“ und „Währungsschnitte“ drücken gewisse Zweifel der einschlägigen Kreise daran aus. Deren Glauben an die Tauglichkeit ihrer Gelder als kapitalistische Geschäftsmittel können die Staaten nicht erzwingen, weshalb sie sich auf das alte, in langen Jahren imperialistischer Reichtumsakkumulation eroberte Vertrauen in ihren Staatskredit und die ihm zugrunde liegende Macht berufen, auf die Wucht ihrer global zirkulierenden Schulden, die ihre Gelder in der Welt alternativlos macht, und darauf, dass sie sowieso vorhätten, demnächst und gleich nach der Krise ihre „Haushalte in Ordnung“ zu bringen. Bescheide in dieser Sache pflegen nach und nach auf den weltweiten Finanzmärkten zu ergehen: in Form von Währungskursen und der Zinsen, mit denen Staaten ihre Anleihen „ausstatten“ müssen, um sie loszuschlagen. In Zeiten, in denen sogar „Zweifel an der erstklassigen Bonität Amerikas“ (FAZ) aufkommen, wohnt man offenbar einem Experiment mit offenem Ausgang bei.
d) Die moralische Kritik daran, dass man ausgerechnet die wegen ihrer „Geldgier“, ihres „Versagens“ und ihrer „Verantwortungslosigkeit“ in Verruf geratenen Manager des Finanzkapitals mit so viel „Steuergeld“ umwirbt, bringt es einerseits angesichts der Dramatik der Notlage nicht weit über den Status eines in der Öffentlichkeit gepflegten begleitenden Volksgemurmels hinaus. Andererseits kennen aber auch Politiker ihre Pflicht zum guten Regieren im und nach dem Katastrophenfall: Die Restaurierung der schöpferischen Fähigkeiten des Bankkapitals soll nicht abgehen ohne ein neues staatliches Kontrollregime über die Institute und ihre unternehmungslustigen Wertpapier-Designer – „kein Markt und keine Anlage“ sollen künftig der staatlichen Aufsicht entgehen, und die Gehälter der Manager, deren Höhe zu einem der volkstümlichsten Krisengründe avanciert ist, sollten in Zukunft auch maßvoller ausfallen. Wobei sich, kaum sind solche Überlegungen in Umlauf, schnell grundsätzliche Schwierigkeiten einstellen: Kann die Spekulation auf den Wertpapiermärkten, schnell, frei und bedenkenlos, wie sie bekanntlich nun einmal sein muss, überhaupt ihre erwünschten Dienste tun, wenn sie allzu sehr durch staatliche Kontrollen eingeschränkt wird? Und darf man den Spitzen des Finanzkapitalismus durch politischen Ukas die Löhne kürzen oder sie wegen ihrer Bezüge schlecht machen? Weil man das nicht darf, schreiben sie Sammelbriefe an Kanzlerinnen und beschweren sich auch sonst bei ihren Regierungen unter Verweis auf ihre – immateriellen – Verdienste und darauf, dass sie für ihre schönen Hedgefonds zur Not auch andere schöne Plätze wüssten.
Sowieso und immer für die Freiheit sind radikale Marktwirtschaftler mit ihrer Kritik an „politischer Einmischung“ überhaupt und den staatlichen Rettungsaktionen im Speziellen, die, wenn sie schon nicht zum Sozialismus führten, jedenfalls das System und seine berühmten Selbstheilungskräfte beschädigten. Derlei gilt in liberalen Kreisen als Ausdruck von Prinzipienfestigkeit und einer gewissen „Wirtschaftskompetenz“: Diese Kritiker, die nicht wissen wollen, dass ihre ganze „freie Wirtschaft“ einschließlich des zugehörigen Finanzwesens auch im Erfolgsfall alles andere als eine „staatsferne“ Veranstaltung ist, können es nicht leiden, wenn „nur“ wegen der zyklisch fälligen Bereinigung einer „Finanzblase“ und einer „Marktsättigung“ auf den Warenmärkten der Staat mit seinen Mitteln einen an sich „gesunden“ Prozess behindert, aus dem zweifellos die Besten gestärkt hervorgehen würden. So etwas halten sie für einen großen Vorzug dieses Systems, der sie auch kaltblütig die Vernichtung von Millionen proletarischer Existenzen ertragen lässt. Was sie dagegen gar nicht aushalten können, ist, wenn der Staat so tut, als wäre er nicht nur der „bessere Banker“, sondern dann, wenn er sich auch noch mit der Rettung wichtiger produzierender Firmen befasst, auch der „bessere Unternehmer“.
Die mit der Systemrettung befassten Politiker weisen das zurück: Sie tun tatsächlich gar nicht so, wenn sie noch bei verstaatlichten Banken an den Verfahrensweisen des privatwirtschaftlichen Finanzwesens festhalten, weil sie möglichst bald wieder das Privatinteresse seriöser Spekulanten in Aktion für den Standort erleben wollen. Ansonsten halten sie den „marktradikalen“ liberalen Kritikern die vielen „Arbeitsplätze“ entgegen, die sie vermittels der fälligen Sanierung des Geldwesens retten wollen, und meinen damit schon wieder ihren Standort, weil neben der Rettung der Banken die Erhaltung und Schaffung konkurrenztüchtiger, rentabler Arbeitsplätze für das Überleben der „realen“ Reichtumsquellen und ihre Konkurrenzfähigkeit nach der Krise entscheidend ist. An ihnen wird es liegen, ob „wir stärker aus der Krise herauskommen“ als wir in sie hineingegangen sind.
II.
Als wären die Widersprüche, die sich im Rettungsprogramm auftun und in Güterabwägungen der grundsätzlichsten wie kleinlichsten Art niederschlagen, nicht Prüfung genug für die Regierenden, leisten die sich mitten in der Katastrophe eine Runde Globalisierung. Sie befrachten die Bewältigung ihrer nationalen Not mit der Tugend, ihren Standort für die internationale Konkurrenz zu rüsten. Die Kosten, Risiken und Wirkungen ihrer Maßnahmen unterwerfen sie dem zusätzlichen Gesichtspunkt, was sie für den Weltmarkt taugen. Außenpolitische Begegnungen – ob turnusgemäß oder extra veranstaltet – stehen unter dem Motto „gemeinsame Bewältigung der Krise“, worüber dann eine offene Auseinandersetzung stattfindet. Die Einheit Europas erfährt eine weitere Absage, jedoch nicht ohne die Perspektive, dass sich mit den sortierenden Wirkungen der Krise auf die Nationen die Einsicht in die Notwendigkeit einheitlicher Regie durchsetzt.
a) Am Zustand und der vergleichsweisen Leistungsfähigkeit der Kapitalstandorte hängt der Reichtum der Nationen, deshalb auch ihre globalisierten Interessen, die Rechte, die sie aus diesen Interessen herleiten, und die Macht- und Finanzmittel, die sie zu deren Durchsetzung aufbieten können. Das ist ein weites Feld, auf dem sich die vertretenen Staatswesen nach eben diesen Merkmalen schon vor der „größten Wirtschaftskrise seit 80 Jahren“ deutlich unterschieden haben: In den führenden Ländern des Weltkapitalismus mit ihren Börsenplätzen und Firmensitzen für globale Kapitalgesellschaften hat sich das dort beheimatete, aber international orientierte Finanzkapital einen Status erobert, der ganze Klassen von weniger avancierten Nationen um seinen Zuspruch konkurrieren lässt und jedes finanzkapitalistische Privatinteresse alternativlos darauf verpflichtet, den Erfolg seiner Investments dort zu suchen, wo die globalisierte Spekulation die Trends des Geschäftes setzt und die größten Gewinnchancen verspricht: Die in den USA, aber auch in London, Frankfurt oder Tokio aufgehäufte Verfügungsmasse an fiktivem Kapital gibt die wichtigsten Anlaufadressen für den internationalen Bedarf an Kredit- und Spekulationskapital vor und unterwirft staatliche und geschäftliche Projekte weltweit den Gewinnkalkulationen des Bankkapitals. Das entscheidet nach seinen Kriterien, ob sich der An- und Verkauf südamerikanischen Trinkwassers, sudanesischen Ackerlandes oder württembergischer Kläranlagen finanzieren und zur Grundlage neuer Wertpapiere machen lässt, die dem Markt neuen Zufluss an spekulativem Stoff verschaffen. So kommt der mehr oder weniger zahlungsfähige Durst von Indios unter die Fuchtel der Wallstreet und die Haushalte schwäbischer Gemeinden schreiben schwarze Zahlen, bis sie zusammen mit den amerikanischen Bürgen ihres schönen „Cross-Border-Leasing“ wieder in Schieflage geraten. Auf diese Weise wird deutlich, dass die Geldwirtschaft auch im Weltmaßstab einen beachtlichen öffentlichen Dienst leistet. Sie muss dabei immer nur ihrem privaten Geschäftszweck folgen und die Welt als Praxisfeld ihrer fiktiven Akkumulation behandeln, um am Ende die imperialistische Weltordnung um ein globales Netz finanzkapitalistischer Abhängigkeit und Unterordnung zu ergänzen.
b) Wenn Krise ist, dann leidet dieser lukrative und ordnungsstiftende Zusammenhang zwischen den Aktivisten der weltweiten Spekulation und ihren Objekten verschiedener Kategorien, die sich, je nachdem, ihr staatliches oder privates Leben als Derivate der erfolgreichen Spekulation im Weltmaßstab eingerichtet haben. Aufgekündigt wird er von den Organisatoren und Nutznießern des weltweiten Anlagewesens in den führenden Länder des Weltkapitalismus, die den Einbruch des Wertpapiergeschäftes zuerst und quantitativ am meisten zu spüren bekommen. Sie haben es, wie man hört, hinsichtlich ihrer von Entwertung bedrohten Anlagen zu „Risikopositionen“ gebracht, die das Bruttoinlandsprodukt aller UN-Mitglieder übersteigen, haben also viel zu verlieren. Das passiert dann auch. Der rapide Wertverlust ihrer Anlagen und dessen Wirkungen auf ihre „Kapitalbasis“ veranlasst die Betroffenen einmal mehr zum Vergleich ihrer weitgespannten Geschäftsinteressen im In- und Ausland, diesmal aber unter dem Gesichtspunkt des „Überlebens“ in der „schlimmsten Krise seit Jahrzehnten“. Ob der öfter zum Nachteil der „Engagements“ an der Peripherie der kapitalistischen Zentren ausfällt, kann dahingestellt bleiben, ebenso wie die Frage, ob etwa Osteuropa-Investmentfonds sich entwerten, weil die Anleger nicht mehr an die Bedienung der darin enthaltenen Firmen- und Staatsanleihen glauben, oder ob die dafür nötigen Anschlussfinanzierungen entfallen, weil deren Verbriefungen unverkäuflich sind. Offensichtlich ist jedenfalls, dass die internationalen Banken, die bis vor kurzem ein schwunghaftes Geschäft mit den öffentlichen und privaten Schulden „wachstumsstarker“ Nationen in Osteuropa und anderswo getrieben haben, harmlose Nordmeerinseln in finanzkapitalistische Marktplätze und andere in „keltische Tiger“ verwandelt haben, sich von den Schauplätzen ihrer jetzt gescheiterten Spekulation zurückziehen. Sie stellen die Kreditierung von Staaten und Firmen ebenso ein wie die ihrer privaten Darlehenskundschaft, die zusammen gestern noch Komplimente für die fabelhaften Wachstumsraten ihrer „jungen Börsenplätze“ einstecken konnten und heute erfahren müssen, dass sie „über ihre Verhältnisse gelebt“ haben. Die einen lassen sie mit Schulden zurück, die diese im besten Fall mit neuen Schulden bedienen können, wenn Kreditgeber, die noch über Liquidität verfügen, ihren Bankrott aus dem Gesichtspunkt der „Systemrettung“ verhindern wollen; die anderen in ihrer privaten Armut, der die Gläubiger abpressen, was sie noch hergibt.
Die Beschneidung ihrer Finanzmacht auch noch über die entlegensten Dependancen ihres globalen Marktes nehmen die Protagonisten des Schuldenhandels nicht aus freien Stücken hin, sondern der Not gehorchend, die ihre in der Krise verringerten Geschäftsmittel zur Folge haben. Sie reagieren auf die Angebote und Anweisungen ihrer kapitalistischen Heimatländer, die sich wegen der Lage an den „Märkten“ alarmiert zeigen und auf die politische Zuordnung ihres Finanzwesens pochen. Nach Jahren der ideologischen Feier und praktischen Ausnützung des schrankenlosen, weltweiten Kapitalmarktes, in denen dessen Organisatoren als gleichsam supranationale Agenten der universalen Gesamtspekulation friedlich die Welt erobert und sich auch die Heimatstaaten des Finanzkapitals an dessen erfolgreichem Internationalismus bereichert und gestärkt haben, führt die Krise dazu, dass sich die großen Geldhäuser der Welt und ihre nationalen Standorte gegenseitig wieder als wichtig entdecken: die einen, weil der Kredit des Staates wenn schon nicht die einzig verbliebene sichere Bank, so doch die einzige Quelle für neuen Kredit ist, ohne den für viele der Bankrott anstünde; die anderen, weil sie die Folgen eben dieser Bankrotte für ihre materiellen Existenzbedingungen und ihre politische Aktionsfreiheit in der Konkurrenz der Nationen fürchten.
c) Die umfangreiche Entwertung von Finanzkapital, die sich vom Standpunkt des Bankensektors als Verringerung seiner Zugriffsmittel auf den Reichtum der Welt darstellt, ist für die Welt, auf die da solange zugegriffen wurde, in vielen Fällen auch kein Spaß: Schließlich ist sie seit einiger Zeit so eingerichtet, dass mit dem Wegfall dieser Zugriffsmittel auch die Lebensmittel der Abhängigkeit gestrichen werden, in der sich die Objekte der kapitalistischen Benützung befinden. Beim Kampf um die Verteilung der Krisenschäden haben viele von ihnen schlechte Karten:
- Haben Unternehmen für die Vermehrung ihres Kapitals den Weg gewählt, dieses teilweise zu den Wohnorten der billigsten Arbeitskraft zu exportieren, um sie vor Ort nach den Regeln der Kunst in der Produktion auszubeuten, schließen sie jetzt angesichts der eingebrochenen Nachfrage nach ihren Waren ihre „verlängerten Werkbänke“ auswärts. Ihre Führer begeben sich, obgleich ebenfalls vorurteilsfreie Weltbürger von Beruf, unter die „Schutzschirme“ der heimischen Obrigkeit, die als Bedingung für ihre Kredite und Bürgschaften fordert, dass die rentablen Arbeitsplätze im „Stammland“ zuletzt geschlossen werden. Wo das Kapital, branchenbedingt ortsverbunden wie im Bauwesen, der Landwirtschaft oder dem großen „Dienstleistungsgewerbe“, eher den legalen und illegalen Import von Arbeitskraft bevorzugt, werden deren nicht mehr benötigte Verkäufer nach Hause geschickt, wo sie ohnehin nie gebraucht wurden. Der Wegfall ihres heimgesandten Lohns, etwa aus den USA nach Mexiko oder aus den Golfstaaten nach Pakistan, lässt dort einen wichtigen Teil des „Volkseinkommens“ entfallen und vermehrt die Armut, die der Anlass für die Emigration war.
- Allen, die ihren Kredit in produktive Branchen investieren, ist gemeinsam, dass sie weltweit weniger Rohstoffe und Energie für ihre heruntergefahrene Produktion brauchen und damit von Südamerika bis Russland, vom persischen Golf bis Zentralasien ganze Staaten in Schieflage oder zumindest zur Neubewertung ihrer Einkünfte bringen. Das betrifft alle die Nationen, die davon leben, die Erträge ihrer Öl- und Gasquellen und Bergwerke gegen Gebühr für den Vermehrungsprozess kapitalistischen Eigentums anzuliefern.
- Die düsterste Prognose wird von den Kennern der Verhältnisse für die „ärmsten Länder“ gestellt. Obwohl dort kein „heimischer privater Kapitalmarkt“, sondern allenfalls der gut beleumundete, aber finanzmarkttechnisch unbedeutende „Mikrokredit“ haust, entgehen sie den Folgen der Krise nicht: Soweit die Völker überhaupt an den Einkünften der Nation aus dem Verkauf ihrer Rohstoffe oder Naturprodukte partizipieren, sind sie mit ihrem Lebensunterhalt ebenfalls vom Rückgang der Nachfrage auf den kapitalistischen Märkten, dem entsprechenden Preisverfall und der zunehmenden Abschottung ihrer Absatzmärkte betroffen. Soweit sie ohnehin nur noch durch ausländische Hilfsgelder oder direkte Nahrungsmittelhilfe überleben, wird trotz gegenteiliger Versprechungen ein Rückgang der dafür verfügbaren Mittel aus „Entwicklungshilfe“ und international finanzierter Nothilfe wegen entsprechender „Haushaltsrestriktionen“ in den kapitalistischen „Spenderstaaten“ notiert, die gerade Billionen für ihr Kreditsystem spenden. So macht, nach Auskunft einer deutschen Stiftung für Wissenschaft und Politik, „die Finanzkrise aus der Ernährungskrise eine Hungerkrise“ und sorgt Mitteilungen des IWF und der Weltbank zufolge für „bis zu 90 Millionen zusätzliche extrem Arme“, die zusammen mit denen, die schon vor der Krise unterernährt waren, sich in der aktualisierten Elendsbuchhaltung des Weltkapitalismus zu einer Masse von mehr als einer Milliarde Hungernden aufaddieren.
Der teilweise Zusammenbruch der Finanzmacht in den kapitalistischen Führungsstaaten der Welt und das damit verbundene Zerstörungswerk am kapitalistischen Reichtum der Nationen macht die Zu- und Unterordnungsverhältnisse hinsichtlich des bislang geführten Restes der Welt fragiler. So stiftet die Krise neben einem gewaltigen Schub an Verarmung weltweit und staatlicher „Unordnung“ in mittellos gewordenen Staaten auch eine gewisse Frechheit, selbstbewusste Unternehmungslust und allerlei Emanzipationsbestrebungen bei Indern, Chinesen und den üblichen Lateinamerikanern, die die Krisenlage als politische Gelegenheit betrachten.
d) Bei allem Elend, das die Krise zusätzlich über die Welt bringt und bei allem Potential zur Störung der Weltordnung, das ihr innewohnt: Die Hauptleidtragenden der weltweiten Wertberichtigung, die in ihrem Akkumulationsdrang zurückgeworfenen Eigentümer und die mit ihnen betroffenen politischen Heimatländer des großen Eigentums wollen von Resignation nichts wissen und auch nichts von einer Blamage ihres Wirtschaftsystems, das manchmal so große Opfer fordert. In ihrer kämpferischen Art sind sie nicht bereit, sich die Folgen der Krise gefallen zu lassen. Vielmehr wollen sie aus den Ereignissen etwas machen und sind der offensiven Auffassung, dass man sich gerade jetzt zukunftsweisendes Handeln leisten können muss. Worauf das bei allen Beteiligten zielt, ist unschwer erkennbar, wird aber auch ausdrücklich öffentlich zum Zweck der Stiftung von Zuversicht und öffentlicher Aufmunterung vorgetragen: Die für die Rettung des internationalen Wertpapier- und Kreditwesens nötigen Rettungsmaßnahmen sollen keinesfalls zu einer Zurückstufung des eigenen Standorts, sondern, wenn irgend möglich, zu einer Verbesserung der eigenen Konkurrenzstellung führen. So durchaus aggressiv besichtigen die Regierungen ihre Potenzen und beleben ihre Krisenkonkurrenz um die Reparatur und neue Ausgestaltung der internationalen Geschäftsbedingungen. Bei den fälligen internationalen Treffen zur Rettung der Lage plädieren sie für „gemeinsame Maßnahmen“ gegen die „Finanz- und Wirtschaftskrise“, warnen sich gegenseitig vor den „Fehlern“, die ihre Amtsvorgänger 1929 begangen hätten – Zu wenig internationale Abstimmung! Zuviel nationalstaatlicher Eigennutz! –, und versuchen, sich beim Streit um diese Maßnahmen gegenseitig auszumanövrieren. Überall, wo die Rettung der Weltwirtschaft zum Gegenstand internationaler Politik wird, geht es um die wüste Berechnung, die Verluste des eigenen Standorts möglichst gering zu halten, dessen Krise besser zu überstehen als all die anderen, die zugleich der Weltmarkt sind, den man für den eigenen Erfolg braucht und nutzen will.
- Das führt nicht nur zu Diskussionen über die korrekte Art der Krisenbekämpfung vor allem zwischen den Europäern und den USA, welch letztere es für unkorrekt halten würden, wären sie mit ihrer tollkühn ausgeweiteten Verschuldung die „einzige Konjunkturlokomotive“ für die ganze Welt. Sie fordern mehr Geldeinsatz auch von Europa und anderen. Die wollen sich nicht die Maßstäbe ihrer Verschuldung von den USA vorschreiben lassen, gehorchen aber, weil sie einen Erfolg der amerikanischen Aktionen nicht abwarten können, den Notlagen des heimischen Standorts: So kreieren sie selbst – was sonst – nie da gewesene Schulden, um die Lücken des ausfallenden Privatgeschäfts auf ihren Kapitalmärkten zu überbrücken. Dies- und jenseits des Atlantiks wird das alles von Perspektiven der Haushaltskonsolidierung und gesetzlichen „Schuldenbremsen“ flankiert, die dem regierungsamtlichen Abenteurertum den Anstrich der Seriosität geben sollen
- Dem US-amerikanischen Antrag auf eine noch aggressivere Gangart der Europäer bei der schuldenfinanzierten Geschäftsbelebung halten diese das Ziel einer künftig besseren „Regulierung der Finanzmärkte“ zur „Vermeidung künftiger Krisen“ entgegen. Das ist einerseits ein gemeinsames Ziel aller politischen Krisenmanager, getragen von der durch die Krise bekräftigten Auffassung, etwas mehr staatliche Aufsicht über das Privatinteresse, dem man die finanzkapitalistische Schlüsselstellung im weltweiten Geschäftsleben eingeräumt hat, wäre der Bedeutung des Gewerbes durchaus angemessen. Andererseits ist unverkennbar: Die europäischen, chinesischen, russischen etc. Anträge zielen mittels einer Internationalisierung der Aufsicht über das Finanzkapital auf den Erwerb neuer Einmischungs- und Mitbestimmungsrechte in bisher exklusiv US-amerikanischer und britischer Hoheit unterstehende Finanz- und Börsenplätze. Deren nationale Finanzbehörden haben bisher der ganzen Welt das Kleingedruckte für den Welthandel mit Kredit diktiert, die Zulassung von Aktiengesellschaften aus allen Ländern zu ihren weltweit liquidesten Börsen verwaltet und von der Unterwerfung unter ihre Vorschriften abhängig gemacht; und haben sich so alle die Vorteile gesichert, die daraus erwachsen, wenn man den Marktplatz für das weltgrößte Angebot an Kapital auf dem eigenen Territorium unter nationaler Rechtshoheit beherbergt. Den Nationen, die mit zweit- und drittrangigen Finanzplätzen den „Zugang zu Kapital“ organisieren, scheint es erstrebenswert, den bisherigen Beherrschern dieser Konkurrenz ihre Monopolrechte wenigstens teilweise zu entwinden. Die, gegen die das geht, verkennen die Absicht der Antragsteller nicht und achten darauf, bei allen Versprechen eines Neuanfangs in Sachen korrekter Aufsicht, dass sie die rechtmäßigen Herren ihrer erfolgreichen Finanzplätze bleiben, auch wenn deren Erfolg gerade zu so unguten Ergebnissen geführt hat.
- Große Einigkeit zwischen den wichtigen Akteuren auf dem Feld der Krisenbekämpfung gibt es in der Frage des „freien Welthandels“: Er gilt – die WTO hat die Parole ausgegeben – als „das beste Rezept, um aus der Krise wieder herauszukommen“. Protektionismus muss unter allen Umständen vermieden werden! Er war einer der Hauptfehler von 1929! Und doch müssen, kaum sind die diesbezüglichen Bekenntnisse der G-20-Politiker in London abgeheftet, „führende Welthandelsexperten“ feststellen, zusammen mit aufrechten Wirtschaftsblättern, die die Fahne der freien Märkte hochhalten, dass schon 17 von den G-20 und nicht nur sie, der Krise wegen „handelsbeschränkende Maßnahmen ergriffen“ haben. Diejenigen, die sich dieser verpönten und dem freihändlerischen Geist des WTO-Abkommens widersprechenden Art der Vorteilssuche bedienen, wollen in den Zeiten des globalisierten Kapitalismus, wenn Internationalität Geschäftsbedingung ist und Protektionismus deswegen anders praktiziert wird als im Jahr 1929, ihr Benehmen keinesfalls als Verstoß gegen das Dogma des freien Welthandels verstanden wissen: Die „Industriestaaten“ verstärken zwar wieder die Subventionierung ihrer Schlüsselindustrien, dürfen das aber so lange straflos, wie ihnen nicht eine „Verzerrung des Handels“ zweifelsfrei in einem langwierigen, dafür vorgesehenen Verfahren „nachgewiesen“ wurde. Manche „Schwellenländer“ verdoppeln ihre Zölle und verstoßen damit keineswegs gegen die WTO-Regeln, weil sie in Zeiten guter Geschäfte die Zölle weit unter das erlaubte Niveau gesenkt haben. Importe werden behindert, weil nicht die heimische Industrie, sondern, erlaubtermaßen, die heimischen „Konsumenten“ vor „gesundheitsgefährdenden Produkten“ geschützt werden müssen. Den Vorwurf des Protektionismus lässt sich also kein Land ohne weiteres gefallen: Schließlich werden neuerdings sogar Putin und seine Milliardäre, chinesische Firmen oder arabische Staatsfonds zur Kapitalbeteiligung an ehrwürdigen, aber ein wenig konkursbedrohten europäischen oder amerikanischen Firmen eingeladen. Manchmal aber ist Protektionismus richtig „populär“: In Deutschland oder Frankreich zum Beispiel, wenn Arbeitsplätze nicht bei Opel in Deutschland oder bei Renault in Frankreich, sondern in Belgien oder Rumänien entfallen sollen, wenn Fiat an allzu italienischen Investitionen in Deutschland gehindert werden muss und gesunde deutsche Fabriken vor maroden amerikanischen Müttern geschützt werden; immer dann also, wenn die Politik den Bestand rentabler Produktion am Standort verteidigt und um ihren Lebensunterhalt fürchtende Arbeiter in dem willkommenen Missverständnis unterstützt, diese Protektion gelte ihnen.
Eine ähnlich gute Presse – mit Ausnahme bei der großen Minderheit der Steuerhinterzieher – haben Bemühungen der amerikanischen und deutschen Regierung, die ebenfalls gar nichts mit Protektionismus zu tun haben sollen, nach der weitgehenden Erledigung des Falles Liechtenstein bei Gelegenheit der Krise auch dem ärgerlichen Finanzplatz Schweiz ein paar wuchtige Schläge mit den Waffen des Rechts zu versetzen: Die weltgrößten „Vermögensverwalter“ als welche schweizerische Banken bislang große Teile des Marktes beherrschten und dafür internationale Steuerhinterzieher als ihre helvetisch-rechtmäßige Geschäftsgrundlage betrachteten, werden nunmehr mit dem Anspruch konfrontiert, endlich als Exekutivorgane der amerikanischen (und deutschen) Finanzämter zu fungieren oder – im Falle der Weigerung – die Zulassung zum amerikanischen Bankenmarkt zu verlieren. Die Schönheit der Alternativen liegt in der sicheren Zerstörung der hauptsächlich betroffenen UBS als internationale Bank im Fall ihres Ausschlusses vom US-Markt und ihrer zumindest teilweisen Zerstörung als ein Marktführer im Geschäft mit den reichen Leuten, wenn sie sich auf das „Angebot“ der Amis einlässt. Das markiert einen Übergang im Kampf um die Verteilung der krisenbedingten Verluste auf dem Bankensektor, eine neue Härte dabei, die vor der politischen Zerlegung eines ganzen traditionellen Bankenplatzes nicht Halt macht und bislang erfolgreiche kapitalistische Konkurrenzverhältnisse rückabwickelt.
e) So arbeiten die Verantwortlichen von heute an ihrem ganz eigenen, zeitgenössischen „1929“ und wollen mit den damaligen Verhältnissen nicht viel gemein haben, allein schon wegen ihrer hochmodernen politischen Krisenbekämpfungstechniken. Zu denen gehört heute – wie gesagt – fraglos der unbeschränkte Einsatz von Staatsgeld zur Stützung von „systemisch“ unverzichtbaren Finanzinstituten, Firmen und Sozialkassen. Die Tauglichkeit des politisch geschaffenen Geldes für diesen Zweck hängt allerdings sehr ab von seinem Schöpfer. Auch da sind die Unterschiede groß, und die laufenden Krisenszenarien bebildern diesen allgemein bekannten Umstand eindrucksvoll: Stellt Island seinen bankrotten Banken druckfrische eigene Währung zur Verfügung, oder bürgt die Ukraine mit selbst fabrizierten Hryvna für die Schulden eines ukrainischen Unternehmens, dann macht das die Schuldner, denen da geholfen werden soll, nicht solider. Die Hüter solcher Währungen sind aus eigenen Mitteln offenkundig nicht in der Lage, Kredit in dem Sinn zu stiften, und sind es solange nicht, wie ihnen nicht Zahlungsfähigkeit in „gutem Geld“ einer weltweit akzeptierten Sorte – davon gibt es bekanntlich nicht sehr viele – aus Kreisen zugeteilt wird, die über es verfügen.
Staaten, die mit dem Verkauf von Rohstoffen oder den Produkten der inländischen Ausbeutung Weltgeld verdient und gebunkert haben, also Gemeinwesen der hoffnungsvollen Kategorie „Schwellenland“, pflegen bislang den größten Teil ihres Bedarfs auf den Weltmärkten ebenfalls nicht mit Real, Yuan oder Rupien zu decken. Ebenso wenig kann man mit Rubel für eine gefährdete russische Bank gegenüber dem misstrauischen internationalen Kapitalmarkt bürgen. Auch dafür sind Dollars oder Euro, wenigstens aber Pfund oder Yen gefragt, die solche Staaten als „Währungsreserve“ verfügbar haben oder im Tausch gegen ihre handelbaren Güter beschaffen können. Weil sie verdient werden müssen, werden sie sorgsam bewirtschaftet.
Den souveränen Herren solcher „Reservewährungen“ steht da in der Krise ein anderes Verfahren zur Verfügung: Sie „schöpfen“ selbst die Geldmengen, die sie zur Rettung ihres Finanzwesens oder ihrer Schlüsselindustrien für unverzichtbar halten und plädieren hinsichtlich der damit verbundenen Risiken entschieden auf Vertagung. Dass die beispiellose Vermehrung von Staatsgeld, etwa in den USA, das Zeug zum außerordentlichen Schadensfall hat, ist der pluralistischen Debatte zu entnehmen zwischen denen, die sich „Sorgen um die Kreditwürdigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt“ machen, und denen, die nach wie vor dafürhalten, dass die USA „den Dollar und die anderen das Problem“ hätten.
Die Frage, ob und in welchem Umfang die im Zuge des internationalen Krisenmanagements in die Welt gekommenen Weltgeld-Billionen sich irgendwann als Stoff für amerikanisches oder europäisches Kapitalwachstum bewähren werden, wird erst in der Zukunft beantwortet; ebenso wie die nach den Wirkungen einer ernsthaften Entwertung dieser Gelder auf die internationale Staatenwelt, die ihre Staatsschätze überwiegend in Form von Devisenreserven in Dollars, Euro, Pfund und Yen hält und davon unmittelbar bedroht wäre.
Wegen solcher Risiken gründen die, die sich dazu in der Lage sehen, vor allem mit Blick auf die amerikanische „Leitwährung“ allerlei Initiativen, die auf eine längerfristige Verdrängung des US- Dollars aus ihren weltweiten Geschäften und eine Ablösung der Sonderstellung zielen, die sich der Dollar als die Währung der Weltmacht erobert hat. Sie bilden Währungszonen in Yuan und Rubel, schließen bilaterale Handelsabkommen, in denen die nationalen Währungen unter Ausschluss des Dollar zur Saldierung festgeschrieben werden, und versuchen sich an lateinamerikanischen Kopien von EWG und IWF für eine Bewegung „los vom Dollar!“. Sie planen, langfristig, in eine Währungskonkurrenz mit dem amerikanischen Weltgeld einzutreten und sich selbst die Vorteile eines global gültigen Weltgeldes zu erobern. So wollen sie heute die Finanzmacht ihrer Dollar-Reserven für sich nutzen und den künftigen Folgen der rücksichtslosen Vermehrung der US-amerikanischen Valuta nicht nur entgehen, sondern als Finanz- und Weltmächte der Zukunft ihr und damit den USA die imperialistische Sonderstellung bestreiten.
Die einzige Währung, für die die Konkurrenz mit dem Dollar schon gegenwärtige Praxis ist, ist das Geld der Europäischen Union. Die Teilnehmer an der Währungsunion haben ihre innereuropäische Währungskonkurrenz eingestellt, um sie mit einem gemeinschaftlichen Geld, aber ohne einheitliches Staatswesen, auf Weltniveau mit dem Dollar aufzunehmen. Das ausgetüftelte Verpflichtungs- und Erpressungssystem des Maastricht-Vertrages sollte die einzelstaatliche Vermehrung von Euro-Schulden an ein nachweislich erfolgreiches Verhältnis dieser Schulden zum jeweiligen nationalen Kapitalwachstum binden. Dieser Erfolg sollte mittels sanktionsbewehrter Defizit-Höchstgrenzen fortlaufend kontrolliert, beglaubigt, wo nötig durch Strafmaßnahmen erzwungen werden und so unfehlbar für Wachstum am europäischen Standort bei „Stabilität“ des neuen Geldes sorgen. Die Einstellung der innereuropäischen Währungskonkurrenz war aber – selbstverständlich – keineswegs mit der Einstellung der sonstigen Konkurrenz der Standorte im Währungsraum verbunden. Ausgehend von ohnehin großen Unterschieden in der kapitalistischen Entwicklung der europäischen Nationen zur Zeit der Begründung des Euro-Regimes hat sich die „Wettbewerbsfähigkeit“ der Euro-Staaten in den letzten Jahren nach einhelliger Auffassung aller Beobachter „stark auseinander entwickelt“. Dies mit der Folge, dass die schon politisch und kapitalstärksten Staaten sich mit der neuen Währung weitere Vorteile erwirtschaftet haben, während sich anderswo Defizit-Verfahren, kapitalistische Stagnation und „Immobilienblasen“ akkumuliert haben.
Die Krise und der Gebrauch der Gemeinschaftswährung für die Rettung des europäischen Kapitalismus unter der konkurrierenden Regie der Euro-Staaten, ihrer Europäischen Zentralbank und der EU-Zentralorgane macht den Widerspruch des gemeinsames Staatsgeldes ohne gemeinsame Staatsgewalt akut und bringt das Maastricht-Regime an seine Grenzen:
Konfrontiert mit dem Zusammenbruch ihres Finanzwesens und drohendem Staatsbankrott, scheren sich die Euro-Staaten immer weniger um die Vertragsklauseln der Währungsunion, die nicht einmal mehr die kapitalistischen Schwergewichte der Euro-Zone einhalten können. Sie verschulden sich bei jedem Investor, der ihnen für Extra-Zinsen Euro-Bonds abkauft, ohne Aussicht auf Rückkehr zu einer Einhaltung der Euro-Regeln und schon gleich ohne Aussicht, die fälligen Sanktionen wegen Verstoßes gegen sie zahlen zu können. Der Maastricht-Vertrag wird einerseits aufgeweicht, Defizit-Verfahren werden verschoben bis „nach der Krise“; andererseits werden faktisch bankrotte Staaten, denen die Finanzierung an den Anleihemärkten nicht mehr gelingt, an den IWF verwiesen, mit Berufung auf das vertragliche Verbot der Euro-Staaten, wechselseitig für die nationalen Schulden anderer zu haften. Zugleich prüft die EZB selbst die Auflage von „Gemeinschaftsanleihen“, in denen sich die nicht mehr kreditwürdigen Staaten hinter den stärkeren verstecken könnten. Deutschland stellt, ausdrücklich gegen die „no-bail-out-Klausel“ des Euro-Vertrages, für zahlungsunfähig gewordene Euro-Staaten „im Notfall“ Hilfe in Aussicht. Während die Krisenpolitik der Euro-Staaten den Vertrag faktisch schon außer Kraft gesetzt hat und seine wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen ruiniert, bleibt „Maastricht“ als politischer Einmischungstitel im Streit der Euro-Staaten untereinander erhalten. Weil die Konkurrenzfähigkeit des EU-Kapitalismus und die Bewältigung seiner Krise eine politische Kontrollfrage ist, sind mit der stillen Kündigung der Maastricht-Kriterien die Debatten darum, wer wem Vorschriften machen kann, gar nicht beigelegt, sondern mit neuer Schärfe und offenem Ausgang eröffnet: mit dem absurden Inhalt, wer unter welchen Umständen in welchem Umfang und mit welchen Folgen die Regeln verletzen darf, die doch keiner der Euro-Staaten auf absehbare Zeit einhalten kann.
In einem aber sind sich alle Beteiligten einig: Gegenüber den Ländern, die Interesse am Beitritt zur Währungsunion bekunden, weil sie sich Vorteile beim Überstehen der Krise ausrechnen, ist strenges Insistieren auf der Beachtung der Vertragsregeln angebracht, um den Missbrauch der Gemeinschaftswährung in unbefugten Händen zu vermeiden! Die Einhaltung der Kriterien verunmöglicht allerdings den Beitritt von Ländern, die den Euro als Notanker gegen die Zahlungsunfähigkeit bräuchten, und beschleunigt mögliche Falliten, an denen andererseits den Staaten der Währungsunion ebenfalls nicht gelegen ist ...
Insgesamt aber ist festzustellen: Trübsal und Pessimismus ist die Sache auch der europäischen Staatenlenker nicht. Selbst die spanische Regierung, auf dem aktuellen Rekordstand der europäischen Arbeitslosenstatistik, bescheinigt der Krise in einer Debatte zur Lage der Nation den Charakter einer „großen Chance“ für neue Stärke, während die EU auch gemeinschaftlich vorwärts denkt und sich von der Krise nicht abhalten lässt, die Anrainer Russlands für eine auf sich hin orientierte neue „Nachbarschaft“ einzusammeln. Keine Regierung lässt davon ab, demonstrativ das Vertrauen ihrer Bürger und der ganzen Welt in die Potenzen ihrer Gewalt einzufordern. Ein Verlust ihrer Macht durch das Scheitern ihrer ökonomischen Basis darf keinesfalls eintreten. Um das zu vermeiden, darauf jedenfalls kann man sich verlassen, werden sie von ihr Gebrauch machen.