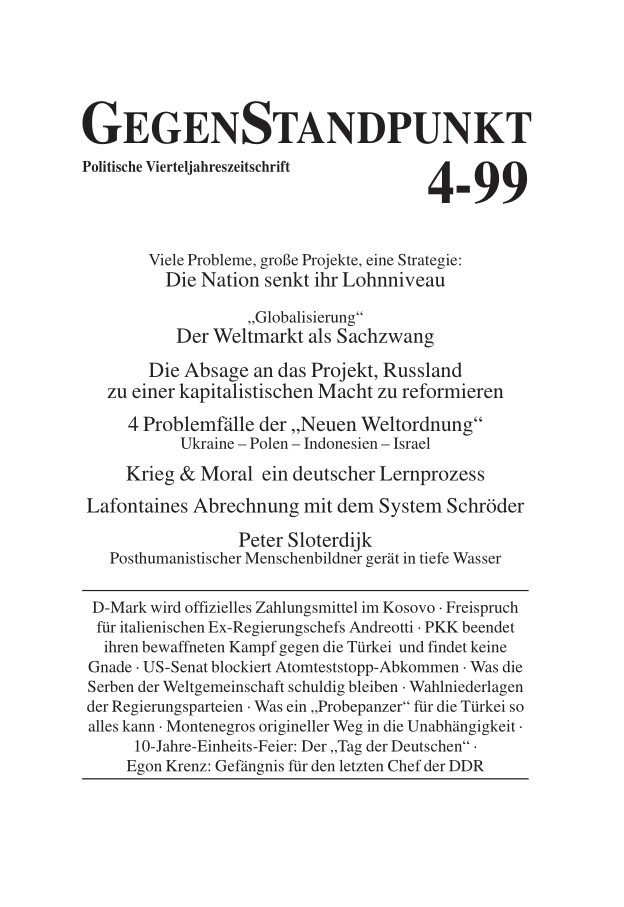Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Im Gefolge einer Reihe von Wahlniederlagen der Regierungsparteien:
Der demokratische Dialog zwischen Wählern und Gewählten kommt voran
Die Wahlniederlagen bei SPD und Grünen nehmen die Regierenden nicht als Ausdruck des verständlichen Ärgers der Regierten über die Zumutungen, sondern als Ausdruck der Dummheit des wählenden Volkes, das noch nicht verstanden hat, dass es zur durchgesetzten Politik keine Alternative gibt. Deshalb müsse man mehr Anstrengung unternehmen, um zu vermitteln, dass SPD / Grüne immer noch soziale Gefühle, besonders für die arbeitenden Menschen, hegen. Und dem Wähler unterstellt man am besten, er habe eigentlich nur die Uneinheitlichkeit der Partei kritisiert.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Im Gefolge einer Reihe von
Wahlniederlagen der Regierungsparteien:
Der demokratische
Dialog zwischen Wählern und Gewählten kommt voran
Ein Jahr nach ihrem „grandiosen Sieg“ haben SPD und Grüne beim Wahlvolk ihren Kredit verspielt. Den „Denkzetteln“ bei den Hessen- und Europawahlen im Frühjahr und Sommer folgt ein wahres „Herbstdesaster“. In einer Serie von Landtags-und Kommunalwahlen beziehen die Regierungsparteien eine „verheerende“ Niederlage nach der anderen. Im Saarland erobert die CDU die Macht; in NRW, der „linken Herzkammer“ der Sozialdemokratie, holt sie sich die traditionellen Hochburgen der Sozis; im Osten gibt es erdrutschartige Verluste für die SPD, die in Thüringen und Sachsen mit weniger als 20% bzw. gerade mal 10% nur noch „dritte Kraft“ ist – hinter der PDS; in Berlin schließlich kann sich die SPD nicht einmal auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren „behaupten“, auf den sie bereits bei den letzten Wahlen abgerutscht war; im Osten der Stadt gewinnt die PDS weiter hinzu. Und der grüne Juniorpartner in der Bundesregierung wird, wo man auch hinsieht, zur Splitterpartei degradiert.
In der SPD-Zentrale
gibt man sich gar nicht erst die Mühe,
landespolitische Aspekte
geltend zu machen, um die
Bedeutung des Wählervotums herunterzuspielen.
Selbstkritik sei wohl nötig
, lautet die Lehre, die
man aus der Wählerwanderung zur Opposition bzw. dem
stummen Protest der Nichtwähler zieht – und zwar eine,
die die Frage beantwortet, warum einem der Wähler die
Zustimmung verweigert, die einem ja wohl zusteht: Das
Wahlergebnis sei unsere eigene Schuld, wenn man nicht
vermitteln kann, was man tut
.
Ein Vermittlungsproblem
Bereitwillig übernehmen führende Sozialdemokraten die
Verantwortung für das Zerwürfnis, das zwischen dem Wähler
und ihrer Partei entstanden ist; und gehen dabei
selbstverständlich davon aus, dass es für dieses
Zerwürfnis in der Politik, die sie treiben, nie und
nimmer berechtigte, geschweige denn künftig irgendwie zu
berücksichtigende Gründe geben kann. Man gesteht vielmehr
das Versäumnis ein, das stimmberechtigte Volk rechtzeitig
und ausreichend in seiner Urteilsbildung angeleitet zu
haben, und quittiert auf diese Weise dessen Votum
postwendend mit der Auskunft, es dokumentiere mit ihm nur
sein mangelndes Verständnis dafür, wie richtig die
Regierung mit dem liegt, was sie tut. Erleichtert darf
der Wähler zur Kenntnis nehmen, dass ihm die mit
Regierungskompetenz ausgestatteten Sozis aus seiner wie
auch immer motivierten, sachlich jedenfalls völlig
ungerechtfertigten Entscheidung keinen Vorwurf machen,
und sie sich künftig bessern wollen: Wir müssen uns
mehr Zeit nehmen für die Bevölkerung.
Es geht daher nicht nur sowieso demokratisch voll und
ganz in Ordnung, wenn diejenigen, die der Wähler neulich
für die nächsten Jahre zur Ausübung der Staatsgewalt
ermächtigt hat, stur an ihrer Politik festhalten – Wir
werden den Kurs durchhalten
– und der Kanzler
persönlich erklärt, dass er die Führung der
Staatsgeschäfte ja wohl nicht vom launischen
Wahlverhalten der Bürger und unterschiedlichen
Befindlichkeiten in den diversen Bundesländern abhängig
machen kann:
„Alle 90 Tage sind in den nächsten drei Jahren irgendwelche Wahlen. Wenn die Bundespolitik darauf Rücksicht nehmen wollte, müsstest du als Kanzler deinen Hut nehmen. So kannst du nicht regieren.“
Ganz im Sinne der versprochenen Bereinigung des
eingestandenermaßen selbstverschuldeten
Verständigungsproblems sind derartige Mitteilungen
nämlich schon recht brauchbare Argumente zur Vermittlung
der beim Urnengang künftig zu beherzigenden Einsicht.
Schließlich geht es bei der zugesagten Unterstützung der
politischen Willensbildung mitnichten darum, dem Wähler
lang und breit auseinanderzusetzen, warum die Regierung
dies und jenes beschlossen hat und für die Zukunft
projektiert. Er soll die Notwendigkeiten, die sie ihm
serviert, akzeptieren, und dazu reicht es völlig, wenn er
einsieht, dass es nicht anders geht. Zur Vermittlung
dieses Lernziels gibt es in der Tat kein besseres
Argument, als ihm eben das dreimal täglich einzubleuen:
Es gibt zu unserem Sparkurs keine, aber auch gar keine
Alternative.
Dabei hat man ihm dann noch das
entsprechende Erscheinungsbild zu bieten: als einer
Partei, in der eben nicht alle durcheinanderreden
,
als gäbe es doch alternative Wege zu beschreiten, sondern
sich wie ein Mann um ihren Führer scharen – und das wär’s
dann mit der Vermittlung.
Doch was macht so eine Partei, wenn sie trotz allen
Hinredens an den Wähler eine Niederlage nach der anderen
einfährt und ihr im Osten der Republik eine Konkurrenz
erwächst, die auf ‚Soziale Gerechtigkeit‘ setzt; wenn es
wegen dieser Konkurrenzlage für ihre Führung immer
schwieriger wird, Geschlossenheit zu organisieren und in
den eigenen Reihen Zweifel an der Linie laut werden; wenn
dann auch noch die Öffentlichkeit darauf einsteigt mit
dem Befund, der SPD sei es nicht gelungen, Zeichen zu
setzen, die den Menschen den Glauben bewahren, dass es
bei ihrer Spar- und Steuerpolitik einigermaßen sozial
gerecht zugeht
? – Dann geht die Parteiführung auf den
Antrag auf mehr sozialdemokratische Heuchelei beim
Regieren ein und erfindet eine neue Spirale im
demokratischen Diskurs: Im Hinblick auf die Politik, die
man macht, besteht man ausdrücklich unvermindert
weiterhin auf der Parteidoktrin ‚keine Alternative‘, aber
was einen selber, so von Mensch zu Mensch betrifft, ist
man gerne bereit, mehr für den Schein zu tun, man wäre
eben doch anders als die anderen, irgendwie sozialer.
Die falschen Symbole waren es
Nachdem die Serie der Niederlagen nicht abreißen will und
in Ostdeutschland die PDS das Rennen vor der SPD macht,
meldet sich in der seit längerem wieder einmal die Basis
zu Wort, um ihrer tiefen Empörung über das Auftreten des
Kanzlers Ausdruck zu verleihen: Wie kann ein Kanzler
rigoroses Sparen fordern, der mit 60-Mark-Zigarren
posiert und alle Welt wissen läßt, wie teuer seine Anzüge
sind.
Bis dahin konnte er das jedenfalls. Und zwar
mit Zustimmung besagter Basis, die diesen Kanzler nach
dem Abtreten von Lafontaine zu ihrem Parteivorsitzenden
gewählt hatte. Bis neulich war man ja auch noch ziemlich
einverstanden damit, dass sich die Partei vom Maßstab des
Sozialen freimacht und den Standpunkt verbreitet, die
Position einer Arbeiterpartei, ‚von den Reichen nehmen,
um den Armen zu geben‘, könne nicht länger die Politik
unserer modernen Gesellschaft sein
. Man hatte einfach
nichts mehr dafür übrig, die eigene Politik ständig
schamhaft mit dem sozialdemokratisch-notorischen Zusatz
‚leider notwendig‘ zu verkaufen, und wollte ein neues
Bild von sich in die Welt setzen: als einer modernen
Partei, die selbstbewusst herausstellt, dass es keine
Schande ist, die Staatsnotwendigkeiten einer
kapitalistischen Nation durchzusetzen und die dafür
nötigen Opfer zu verordnen. Genau richtig war da ein
Kanzler an der Spitze, der keine Gelegenheit ausließ, um
zu demonstrieren, dass er es mit den wirklich wichtigen
Leuten in der Nation kann, den Wirtschaftsbossen…
Und jetzt? Jetzt leuchtet plötzlich nicht nur der Parteibasis ein, dass man so nicht mehr auftreten kann:
„Um seiner über den demonstrativen Luxus-Kanzler erbosten Basis ein Zeichen zu geben, verzichtet er – zumindest öffentlich – vergangene Woche auf seinen Rauchgenuss… Für Schröders Berater ist dieser symbolische Rückzug das bisher ernsthafteste Signal ihres Chefs, auf seine Kritiker einzugehen: ‚Der arbeitet wirklich an sich.‘“
Da die ‚Kritiker‘ alles andere als ein Abrücken vom
Sparkurs der Regierung gefordert haben, vielmehr beim
Verordnen der aus staatshaushälterischen Gründen fälligen
schmerzhaften Einschnitte
auf der Ebene der
Zeichen und Symbole mehr demonstratives
Einfühlungsvermögen in die Seele der sozial Gedeckelten
und vor allem: mehr wirkliches Einfühlungsvermögen in die
Konkurrenzlage der Partei verlangt haben, sind sie mit
der denkbar albernsten Demonstration von Ich habe
verstanden
bestens bedient. Dazu noch ein zackiger
Leitantrag für den nächsten Parteitag mit dem Inhalt:
Unsere Grundwerte haben Bestand
, und die Partei
steht wieder wie ein Mann hinter ihrem Führer. Gott sei
Dank konnte die Gefahr eines schier undenkbaren Verrats
an den sozialdemokratischen Werten gerade noch einmal zum
tausendsten Mal in der 100-jährigen Geschichte der
Sozialdemokratie gebannt werden!
Doch reicht so eine öffentlich, also für die Öffentlichkeit inszenierte Versöhnung zwischen Basis und Führung im Geiste der wahren Werte fürs Volk, das zunehmend den falschen Sozialdemokraten auf den Leim zu gehen droht?
„Das ist ja das Dramatische, dass die PDS der SPD das Thema soziale Gerechtigkeit und die Emotionen, die sich mit diesem Thema verbinden, weggenommen hat.“
Besser, man setzt noch eins drauf und erinnert es erstens pausenlos daran, dass es niemand anders als die sozialdemokratisch geführte Regierung war, die – beim Kindergeld, bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bei der Steuerentlastung kleiner Einkommen – gleich zum Einstieg ihrer Regentschaft 3 soziale Großtaten vollbracht hat, die aber auch ein für allemal genug zu sein haben für den Beweis ihres sozialen Charakters; und zweitens sagen wir ihm am laufenden Band etwa folgendes:
„Wenn man als Sozialdemokrat aus bitter notwendigen Gründen Sparpolitik macht, die auch den eigenen Anhängern einiges zumutet, dann geht das nur, wenn man zugleich zeigt: Ich habe soziales Gefühl, ich habe Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit. Solche Signale müssen wir aussenden.“
Das geht ja vielleicht ans Herz. Da wird nicht nur
regiert, dass die Schwarte kracht, sondern diejenigen,
die das tun, zeigen
denen, die das trifft, dass
sie – ja was eigentlich? Sich aufs Heucheln verstehen?
Aber sagt man dann, dass man zwecks Herstellung eigener
Glaubwürdigkeit an den Adressaten die passenden
Signale aussenden
muß? Offenbar schon, und richtig
verstanden ist dergleichen ja auch sowas wie der Beweis
eines fürsorglichen Standpunkts, hat doch der Wähler, der
seiner Regierung einen Denkzettel verpasst, anschließend
ein Recht auf eine vereinnahmende Ansprache von oben. Ein
Versuch lohnt sich jedenfalls, schließlich ist ein
Kanzler nicht irgendwer:
„Schröder sprach wiederholt von einer Grundorientierung auf arbeitende Menschen, auf diejenigen hin, die in Fabrikhallen und Werkhallen ihre Arbeit verrichteten.“
Auch bei den Grünen
hat man aus den ersten Wahlniederlagen im Westen der Republik erst einmal die Konsequenz gezogen, dass man den wählenden Zeitgenossen endlich und endgültig den Irrtum austreiben muss, Wahlen wären so etwas wie Gelegenheiten für sie, Anträge auf eine andere Politik zu stellen:
„Der größte Fehler wäre, jetzt da zu korrigieren. Es liegt nicht an den Inhalten, die Substanz unserer Politik ist alternativlos. Fehler seien aber bei der Vermittlung und in der Kommunikation gemacht worden.“
Eingedenk dessen, dass man als Partei groß geworden ist,
die für sich immer mit dem Markenschild ‚alternative
Politik‘ geworben und sich viel auf ihre
basisdemokratische Streitkultur zugutegehalten hat, nimmt
man sich bei den Grünen die handwerklichen Fehler
,
die man bei der Vermittlung begangen haben will, freilich
ganz besonders zu Herzen.
Ein Schulungsproblem
Entnervt gibt ihr Chef zu Protokoll, dass er es mit
seiner Partei einfach nicht mehr aushält: Da ist man nun
endlich an der Macht, darf mit der Wirtschaft über die
Modalitäten des Fortbetriebs von Atomkraftwerken
verhandeln, Gesetze zur Deckelung der Volksgesundheit
ausarbeiten und in der NATO Bomben auf Belgrad
mitbeschließen, und anstatt durch ein geschlossenes
Auftreten nach außen glaubwürdig rüberzubringen, dass es
zu dieser Politik keine Alternative gibt, ist die Partei
im Kopf immer noch in der Opposition
. Was er
nämlich schon lange begriffen hat, haben einige Leute in
seiner Partei immer noch nicht begriffen: dass Opposition
nichts mit einem abweichenden Standpunkt zur Politik zu
tun hat, sondern eine Rolle ist, die man annimmt, um an
die Macht zu kommen, und ablegt, sobald man die ausübt.
Diesen Leuten empfiehlt er dringend eine Schulung
– vermutlich zum Thema ‚Wie stelle ich mich geschlossen
hinter meine Führung?‘.
Doch will er gar nicht nur sie erreichen. Sein Lamento über sie ist unüberhörbar für die Ohren der Öffentlichkeit und damit des wahlberechtigten Publikums bestimmt. Ohne sich von dessen für seine Partei ziemlich vernichtenden Votum beirren zu lassen, spricht er den Wähler unvermittelt an als einen, dem ja wohl auch an Wahlerfolgen der grünen Partei gelegen sein müsste, um sich auf dieser Basis mit ihm über den Inhalt der erteilten Denkzettel zu einigen: Dass seine Partei im ersten Jahr ihrer Regierungszeit wirklich ein unmögliches Erscheinungsbild abgeliefert hat, gibt er gerne zu. Sich darauf zu verständigen, hat für ihn und seinesgleichen nämlich den Vorteil, dass man sich mit dem Wahlvolk dann über die Regierung und den grünen Beitrag zu ihr ohne jegliche Bezugnahme auf die Politik, die man ins Werk setzt, nur noch in den Kategorien einer zu perfektionierenden Wählervereinnahmung zu unterhalten braucht.
Wie ernsthaft man auf diesem Feld an sich arbeiten will,
wird dem Wahlbürger, der eben das honorieren soll, von
der grünen Parteiführung denn auch gerne und absolut
glaubhaft demonstriert. Sie führt ihn regelrecht ein in
ihr schäbiges Handwerk. Was vergibt sich eine
Regierungspartei eigentlich, wenn die Politik, die sie
macht, zum Gegenstand interner Auseinandersetzungen wird,
und sie darüber gelegentlich ein uneinheitliches
Bild
darbietet? Antwort aus berufenem Munde:
Dieser doch sehr dissonante Chor, den man bei allem
und jedem hat, habe die Wähler verunsichert und
Begehrlichkeiten geweckt.
Um die Herstellung der
Sicherheit beim Wähler geht es also, dass
Begehrlichkeiten welcher Art auch immer von seiner Seite
jedenfalls fehl am Platze sind. Diese Sicherheit wird
verspielt, wenn eine Führung es zulässt, dass ihre
Beschlussfassungen in Auseinandersetzungen hineingezogen
werden, und der Wähler darüber den Eindruck gewinnt, die
Regierungsgeschäfte ließen sich womöglich doch irgendwie
sozialer, ökologischer, sonstwie menschenfreundlicher
oder auch nur besser abwickeln – ein unverzeihlicher
Fehler, auf dem dann bekanntlich die Opposition ihr
Süppchen kocht…
Dass sie diesen Fehler eingesehen, also gelernt haben,
dass das überzeugendste Argument für die
Alternativlosigkeit der Regierungspolitik immer noch in
einer Führung besteht, die sie praktisch herstellt, indem
sie sich mit ihren Beschlüssen entschlossen durchsetzt,
wollen die Grünen offenbar demnächst vom Wähler honoriert
bekommen. Jedenfalls gibt sich ihre Führung alle Mühe,
ihn davon zu überzeugen, dass sie nun weiß, wie man ihm
nach allen Regeln demokratischer Überzeugungsarbeit
wahrhaft professionell kommt: Die Politik der
Regierung sei richtig, nur hätten alle zu ihr stehen
müssen.
Und damit das künftig auch klappt, fasst man
Maßnahmen ins Auge, um Geschlossenheit in die Partei
hineinzuorganisieren: Wer die unseligen
Strömungsdebatten beenden will, muss die Doppelspitze
abschaffen, damit wir zu einer einheitlichen Führung
kommen.
Um Debatten in der Partei zu beenden, die es
ja nun auch nicht wegen der Doppelspitze gibt, führt man
nun also eine Debatte wegen der Doppelspitze. Schade wäre
es für den Wähler nur, würde eine der debattierenden
Doppelspitzen aus Sorge um das geschlossene Auftreten der
Partei ernstmachen mit ihrer – selbstverständlich
ebenfalls via Pressekonferenz verbreiteten – Androhung,
dass sie über die Verfahren zur Herstellung von
Geschlossenheit künftig nur mehr unter Ausschluss der
Öffentlichkeit weiterdebattiert: Radcke zeigte sich
unglücklich darüber, dass der Streit öffentlich
ausgetragen wird.
Doch auch an den Grünen gehen die weiteren Niederlagen,
die man im Osten des Landes kassiert, nicht spurlos
vorüber. Man sieht sich auf den Status einer bloßen
Westpartei festgelegt und ist zudem auch noch im
westlichsten Bundesland aus dem Parlament gewählt worden;
höchste Zeit, sich neu aufzustellen. Auch für die Grünen
heißt das zuallererst: Keine Korrekturen an der Politik,
Kurs halten – aber entschlossen nach einer neuen,
Attraktivität versprechenden Identität
suchen, mit
der man sich in der Parteienkonkurrenz besser behaupten
kann.
Ein Profilierungsproblem
Wo sich Zweck und Mittel in dieser Weise sortieren, sind Überlegungen der folgenden Art angesagt:
„Wenn wir darum konkurrieren, die bessere linke Partei zu sein, werden wir die Auseinandersetzung verlieren. Das kann die PDS besser, populistischer, demagogischer.“
Das sind halt so Einfälle: Auf diesem Feld gelingt uns
die Demagogie nicht so gut, also wählen wir ein anderes.
Vielleicht folgendes: Die Grünen müssen sich als
linksliberale Partei inmitten der Gesellschaft
verstehen.
Was immer man sich unter ‚linksliberal‘
vorstellen soll: Darf man denn nachfragen, ob diejenigen,
die sich da offensichtlich restlos dem Sachzwang ihres
eigenen Parteierfolgsstrebens ausgeliefert wähnen,
überhaupt linksliberal sein wollen? Oder gar sind? Grüne
stellen sich solche Fragen jedenfalls nicht. Andere
dagegen schon. Z.B. die, was für ihre Partei
herausspringen könnte, wenn sie sich linksliberal
präsentieren würde. Und unter diesem Gesichtspunkt
erscheint ihnen die Kombination der zwei Begriffe
,
die obendrein schon andere besetzt
haben, doch
keine allzu gute Idee zu sein: Das ist ein schmales
Segment.
Vielleicht ist es ja doch günstiger, den
alten Begriff
aufzumöbeln, der den Vorteil hat,
dass man ihn selber schon besetzt
hat: Das
Gremium soll das Profil schärfen. Dazu wolle man Themen
wählen, die grüne Identität ausdrücken.
Doch dabei Vorsicht, keine Rückfälle in alte Zeiten!
Deswegen noch einmal langsam und zum Mitschreiben, worauf
es ankommt, wenn die Grünen eingedenk ihrer
Konkurrenzlage heute mehr grüne Identität
fordern:
„Man muß zwei Schritte unterscheiden: Da ist zum einen die klare Position der Partei, die gegebenenfalls auch radikal formuliert werden muß. Das andere ist aber, was davon umsetzbar ist. Schritt eins ist die klare Position. Schritt zwei das, was im Kompromiß mit dem Partner daraus wird. Im Regierungsalltag haben wir bisher nicht klar rübergebracht, dass sich unsere Position nicht auf das reduzieren läßt, was die Regierung macht.“
Die Ideale der Partei darf deren Gefolgschaft und soll der Rest der Menschheit nie mehr verwechseln mit einem Anspruch an die Politik, die man treibt. Letztere ist strikt zu trennen von den Titeln, unter denen sie gemacht wird. Weil da nichts durcheinander gebracht werden darf – und zum Beweis, dass man selbst da nichts mehr durcheinander bringt –, gehört heute zu einer erfolgversprechenden Selbstdarstellung die ausdrückliche Klarstellung, dass es bei der nur um die schönfärberischen Lügen der Partei geht, die als solche freilich ganz und gar unverzichtbar sind. Hinlänglich klargestellt haben die Grünen mittlerweile, dass die höheren Werte, auf die sie sich berufen, nicht dazu gedacht sind, mit ihnen der Politik ins Handwerk zu pfuschen. Und auf dieser Grundlage entwickeln sie analog zur SPD – nicht zuletzt zwecks Abgrenzung von ihrem Koalitionspartner – umso dringlicher das Bedürfnis der Pflege dieser Werte.
*
Nachtrag 1: Die Öffentlichkeit sekundiert
Einer Regierungsmannschaft dadurch das Vertrauen zu entziehen, dass man es vorbehaltlos der nächstbesten politischen Konkurrenz schenkt oder demonstrativ daheim bleibt, wenn Urnengang angesagt ist – für solche politischen Willensbekundungen demokratischer Untertanen, die mit Kritik kaum zu verwechseln sind, hat die Öffentlichkeit grundsätzlich allemal Verständnis. Zumal dann, wenn sie dieses Verständnis aus eigenen Gesichtspunkten heraus aufbringen und als Inhalt des ansonsten ziemlich wortkargen Wählerurteils darlegen kann. Politische Vernunft bescheinigt sie dem Wahlvolk dann für die bescheuertsten Verstandesleistungen; z.B die Geduld zu verlieren, wenn sich von der Regierung angekündigte Gesetzesvorhaben – welchen Inhalts auch immer – hinziehen oder Streitereien in der Koalition – über was auch immer – nicht prompt durch ein Machtwort des Kanzlers beendet werden.
Im vorliegenden Fall allerdings wird die Öffentlichkeit
in ihrer sprichwörtlichen Pressevielfalt den Verdacht
nicht los, dass solche sturzvernünftigen
Entscheidungsgründe zur Erklärung
der erteilten
Denkzettel nicht mehr ausreichen
. Denn inzwischen
ist sie der Auffassung, dass die Regierung für ihre
Arbeit allenthalben gute Noten verdient. Eichels
Sparprogramm – wer hätte gedacht, dass die Koalition nach
ihrem dilettantischen Fehlstart
mit Lafontaine so
etwas Solides noch hinkriegt? Und der Spaßkanzler der
ersten 100 Tage, er ist keineswegs mehr der Moderator
eines rot-grünen Chaos
, sondern an seiner
Verantwortung – vor allem in den Tagen des Krieges! –
gewachsen. Ja, wenn man es vom Ergebnis her betrachtet
und aus der Optik des durch ihn letztlich ins Recht
gesetzten Zeitgeistes, hat Schröder eine geradezu
historische Leistung
vollbracht: Er hat den
Trug einer rot-grünen Reformperspektive zertrampelt
(FAZ) – indem er konsequent
auf all denen herumgetrampelt ist, denen eine Regierung
immer erst im beschönigenden Lichte einer rot-grünen
Reformperspektive als überzeugendes Angebot an die
wählende Menschheit erscheinen wollte. Irgendwie von
gestern der Wähler, der es nicht honoriert, wenn er von
seinem Modernität und neue Ehrlichkeit verströmenden
Kanzler nichts als eine kompetente Führung versprochen
kriegt.
Jedenfalls hat die Öffentlichkeit, wo die Dinge so liegen, überhaupt kein Verständnis dafür, wenn der Wähler die erstbesten Gelegenheiten ergreift, um wieder zurück zur Union zu wechseln:
„Sehr rational ist dies nicht, denn abgesehen von einigen anbiedernden Tönen aus der zweiten Reihe, haben die führenden Unions-Politiker keinen Zweifel daran gelassen, dass sie den angeprangerten Regierungskurs in den Grundzügen der Wirtschafts- und Sozialpolitik fortsetzen würden, falls man sie dazu ermächtigte.“ (SZ)
Das Problem, der Wähler könnte eine politisch nicht
opportune Mannschaft ermächtigen, hat die Öffentlichkeit
dabei also nicht. Hämisch notiert sie, dass der Wähler
keine Wahl hat: Hart für Wähler und Nichtwähler
zugleich. Wie man’s auch macht, der Effekt bleibt
derselbe.
(FR) Wohin
immer der Wähler also sein Kreuzchen künftig auch setzt –
es wird ihm nichts helfen.
(SZ) Sorgen macht ihr vielmehr, was
eigentlich in den Köpfen von Stimmbürgern vor sich geht,
die durch ihr Wahlverhalten zum Ausdruck bringen, dass
sie einfach nicht kapieren wollen, dass sie keine Wahl
haben. Liegt da nicht der Verdacht nahe, dass diese
Mannschaft eine völlig verantwortungslose Einstellung
hat; dass sie nur darauf aus ist, jede sich ihr bietende
Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen, um sich etwas von
den ihr von der Regierung auferlegten Opfern zu ersparen?
Wie dem auch sei: Dieser Einstellung muss schon im Ansatz
ein Riegel vorgeschoben werden; so weit muss der
demokratische Konsens zwischen Regierung und Opposition
reichen! Keinerlei Verständnis hat die Öffentlichkeit
daher, wenn man in der Opposition der Versuchung nicht
widerstehen kann, die Anfälligkeit des Volks für Leute,
die mit sozialen Versprechungen locken, aus
durchsichtigen parteipolitischen Berechnungen für sich
auszunutzen. Und auch wenn diese Gefahr bei der CDU nun
wirklich nicht besteht: Warnen kann man angesichts
gewisser anbiedernder Töne aus der zweiten Reihe
gar nicht früh genug davor, die Unions-Christen könnten
sich zu einer Opposition von links
entschließen
und den Anwalt der enttäuschten Hoffnungen
der
daheim gebliebenen SPD-Kundschaft spielen. Sie würden
damit sich selbst keinen Gefallen tun:
„… die CDU als Heimat des Sozialen. Da tut sich nicht nur eine Glaubwürdigkeitslücke auf… Auch das Ergebnis könnte fatal sein: Die Union läge am Ende in den Ketten, aus denen sich die SPD gerade mühsam und qualvoll befreit.“ (SZ)
Sie haben das auch gar nicht nötig:
„Insgeheim ist man froh, dass die Sozialdemokraten sich die blutigen Köpfe holen bei einem Politikwechsel, den man selbst für nötig hält.“ (FAZ)
Und vor allem: Sie würden sich damit aus der nationalen
Verantwortung stehlen, in der demokratische Parteien
stehen. Die haben in ihrer Konkurrenz um die Macht
gemeinsam Sorge dafür zu tragen, dass nicht am Ende –
bloß weil Demokratie ist! – der falsche Eindruck
entsteht, die wirtschaftspolitischen und
imperialistischen Programmpunkte, die die Regierung unter
dem Titel von lauter Sachnotwendigkeiten exekutiert und
die Opposition genauso exekutieren würde, falls man
sie ermächtigte
, wären für das Volk mit einem Kreuz
bei der Wahl doch irgendwie abweisbar.
Das bewegt schreibende Demokraten ziemlich, und sie machen sich so ihre freien Gedanken, wie man der darin enthaltenen Problemlage auf elegante Weise Herr werden könnte:
„Die paradoxe deutsche Gemütslage – Ja zu den Reformen, Nein zu den Maßnahmen – kann offenbar nur durch eine große Koalition überwunden werden: Dann entfällt für den Wähler die Fluchtmöglichkeit, sein Glück einfach bei der jeweils anderen Volkspartei zu suchen.“ (Spiegel)
Das Problem besteht offenbar darin, dass das Volk in der
Demokratie eine – zugegebenermaßen trostlose –
Möglichkeit vorfindet, ein Nein zu den Maßnahmen
,
die die Regierung zur Durchsetzung der nationalen
Interessenlage beschließt, zum Ausdruck zu bringen. Und
was tut es? Es ergreift sie glatt. Obwohl man ihm längst
erfolgreich eingehämmert hat, dass Reformen sein müssen.
Diese Möglichkeit müsste man ihm auch noch verbauen,
damit es endgültig nicht mehr um die Einsicht herumkommt,
dass für es kein Weg vorbeiführt an einem
uneingeschränkten Ja zu allem, was ihm seine
Staatsführung einbrockt.
Das sind so Wunschträume, wie Demokraten sie haben.
*
Nachtrag 2: Eine gar nicht vorgesehene Wahlmöglichkeit bietet sich als solche an
Solche Zeichen der Zeit weiß eine kleine Partei am Rande des Parteienspektrums als Gelegenheit für sich zu interpretieren:
„Die Schröder-SPD behauptet, es gebe keine Alternative zu ihrer Politik. Dann können wir Wahlen gleich abschaffen. Denn im Klartext hieße das ja: Kohl müsste es so machen, wie es von Schröder gemacht wird. Gysi müsste es so machen. Diese Einstellung halte ich für gefährlich.“
Dem stets enorm pfiffigen Fraktions-Chef der PDS ist
damit so etwas wie die ultimative Ableitung der
Daseinsberechtigung seiner Partei gelungen. Vom
Sozialkundeunterricht her weiß er, dass Wahlen ohne
Wahlmöglichkeit keine sind. Also braucht es ja wohl seine
Partei als die radikale Alternative, ohne die sich das
ganze Kreuzchen-Malen nicht recht lohnen würde… Und das
ist sie dann auch schon, die Alternative, auf die es der
PDS in ihrer Selbstwerbung ankommt: dem
regierungsamtlichen Getöse von der Alternativlosigkeit
der eigenen Politik das machtvolle Postulat
entgegenzuschleudern, es müsse eine geben… Welche? Das
ist auf diesem hohen Niveau politischer
Auseinandersetzung erstens gar nicht weiter von Belang;
und zweitens ergibt es sich von selbst: Wo die SPD ihr
herkömmliches „soziales Gewissen“ gegen den
Totalitiarismus alternativlosen Regierens eintauscht, da
adoptiert die linke Konkurrenzpartei die herrenlos
gewordenen Inhalte
; denn da eröffnet sich ein
Platz
in der Parteienlandschaft
, auf dem
man sich zur Eroberung von möglichst großen Anteilen der
Gesamtwählerschaft positionieren
kann. Die
Sozialdemokraten entsozialdemokratisieren
sich
gerade, also nichts wie hin auf den links frei
werdenden Platz
. Mit einer Sozialdemokratisierung
der PDS
rechnet man sich einige Chancen aus, die SPD
um Teile ihrer Klientel beerben zu können, um dann
vielleicht einmal – Visionen braucht das Land! – zusammen
mit der CDU für eine sozialere Politik eintreten
zu können, in der es ja inzwischen mehr
sozialdemokratische Traditionen als in der SPD
geben
soll…
Ungefähr dieselbe Bedeutung hat es, wenn die PDS laut
darüber nachdenkt, ihre strikte Ablehnung von
UN-Militärmissionen aufzugeben
. Nämlich die: Die
empfohlene Kurskorrektur ist Teil der Strategie, die PDS
gesamtdeutsch zu positionieren.
Schließlich will sich
die PDS nicht mit der Rolle einer ostdeutschen
Klientel-Partei abfinden; da sind alle Überzeugung
verzichtbar, die zum herkömmlichen gesamtdeutschen
Polit-Konsens nicht passen.
Man kann dieser Partei also alle möglichen Vorwürfe
machen; z.B. den, dass sie neben allen sonstigen
Argumenten, die ihr dafür mittlerweile offenbar
einleuchten, neuerdings auch noch ihren eigenen
unbedingten Willen, zur regierungsfähigen Partei
aufzusteigen, als guten Grund für den Einsatz deutscher
Waffen und Soldaten ins Feld führt. Nur den Vorwurf, sie
würde aus taktischen Gründen ihre Identität
verändern
, sollte man ihr ersparen. Sie hat nämlich
keine andere Identität als die einer demokratischen
Partei, die um die Macht konkurriert.