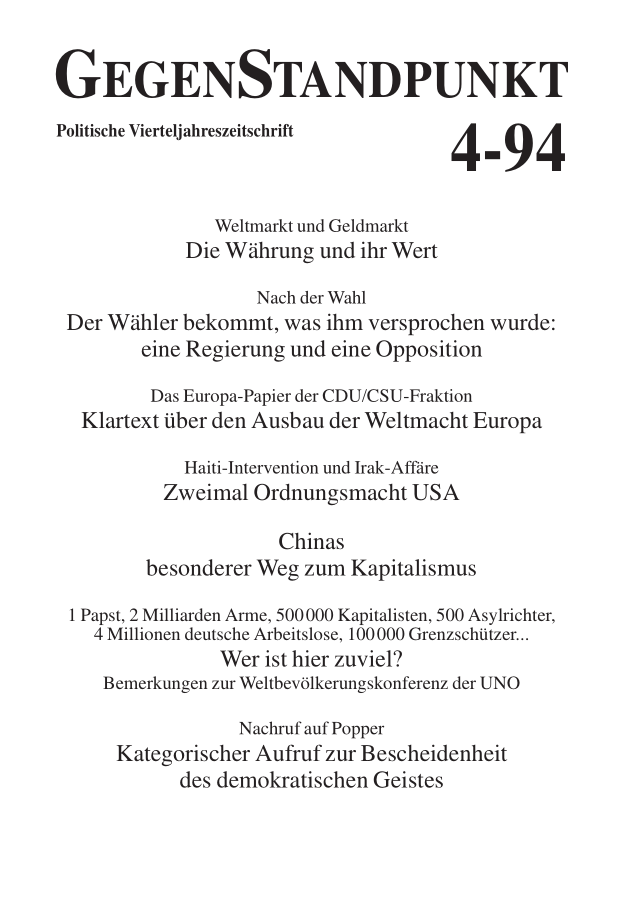Weltmarkt und Geldmarkt
Die Währung und ihr Wert
Nationale Gelder erfahren als konvertible Währungen ihre internationale Anerkennung (Maßverhältnis, Staatsschatz). Die ruinösen Konsequenzen der beabsichtigten Bereicherung müssen gemeinsam betreut werden (Verschuldung, Weltbank, IWF). Der Währungsvergleich wird durch die Weltfinanzmärkte vorgenommen (Banken, Devisenhändler, Spekulation). Die Staaten reagieren auf den Währungsvergleich (Währungs- und Standortpolitik). Die Maßnahmen der Weltwirtschaftsnationen, die sich in der aktuellen Krise auf die Unanfechtbarkeit eines der drei Weltgelder richten, untergraben das Weltwirtschaftssystem, weil nicht nur die unterlegene Nation betroffen ist. Vor dem IWF wird inzwischen um kollektive Kreditgarantien für eigene Klientel gestritten.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- Von der Konkurrenz der Nationen um den Reichtum der Welt
- Der Grund des Währungsvergleichs oder: Was der Wechselkurs alles ins Verhältnis setzt
- Der Verlauf des Währungsvergleichs oder: Wie Wechselkurse gemacht werden
- Geldpolitik oder: Wie der Staat auf den Währungsvergleich reagiert
- Zum aktuellen Stand der internationalen Konkurrenz ums Geld der Welt
- a) „Die Märkte“ lassen den Dollar fallen
- b) Die USA profitieren nicht von ihren Versuchen, den Konkurrenzvergleich gewaltsam zu korrigieren
- c) Die Konkurrenten werden mit dem Fall des Dollar nicht glücklich
- d) Die Deutschen lassen Rücksichten fallen
- e) IWF-Tagung in Madrid – Die Weltwirtschaftsmächte demontieren ihre supranationale Kreditbetreuungsagentur
- f) Kleines Zwischenfazit
Weltmarkt und Geldmarkt
Die Währung und ihr Wert
Von der Konkurrenz der Nationen um den Reichtum der Welt
Daß dem Wechselkurs von Währungen eine enorme Bedeutung zukommt, sieht man schon daran, daß er täglich ermittelt und bekanntgemacht wird. Die Art, wie dieses ökonomische Datum zur Kenntnis genommen wird, bewegt sich zwischen gelassener Beobachtung, heftiger Diskussion von Vor- und Nachteilen der jüngsten Veränderungen und aufgeregten Stellungnahmen, die Ursachen und Wirkungen, Schuldige und Opfer, verheißungsvolle Tendenzen und enorme Gefahren ausmachen. Die Kompetenz der einschlägigen Kommentare ist eine Frage des Interesses, das sich zu Wort meldet. Wer den Export von Waren im Auge hat, beurteilt den Verfall einer Währung anders als jemand, der als Importeur seine Betroffenheit heraushängen läßt. Für Banken, die am Devisenhandel beteiligt sind, zählt ein Kurswechsel in ganz anderer Hinsicht; je nachdem, ob die von ihnen favorisierte Valuta Schaden nimmt oder eine von ihnen zuvor bereits abgestoßene Geldsorte den weise erahnten Einbruch verzeichnet, werden die „Märkte“ gerügt oder mit Komplimenten ob ihrer wohltuenden „Kräfte“ bedacht. Die Krone kundigen Problematisierens allerdings erringen alle, die im Namen der Nation Partei ergreifen; dazu brauchen sie gar nicht Chef des Kabinetts oder der Notenbank zu sein – es genügt, die nationale Währung zum Sorgeobjekt zu küren und deren Austauschverhältnis zu fremden Geldern unter dem Gesichtspunkt der Staatsbilanzen zu betrachten. Diese Bewertung des Auf und Ab von Wechselkursen hat schon deswegen viel für sich, weil sie die nationalen Zahlungsmittel nicht als bloße Bedingung für private Geschäftsinteressen begutachtet, sondern aus der Warte des Hüters und Garanten des Geldes dessen Tauglichkeit prüft und zu erhalten wünscht. Darüber hinaus bezieht der Regierungsstandpunkt durchaus die Anliegen der Geschäftswelt in seine Berechnungen ein – er würdigt die Erfolge des auswärtigen Handels wie die des Kreditgewerbes als maßgebliche Faktoren seiner Bilanzen. Und er betrachtet sein Haushaltsgebaren umgekehrt als Faktor, von dem sowohl der Wechselkurs als auch das Wachstum beeinflußt werden. Was umgekehrt Geldhändler wie Industrielle, die mit dem Wechselkurs als Faktor ihrer Kalkulationen zu tun haben, zum Anlaß nehmen, den Umgang von Finanzministern und Nationalbanken mit Geld für ihre Schwierigkeiten haftbar zu machen…
*
Zur Klärung dessen, was ein Wechselkurs ist, tragen die im Wirtschaftsteil der Zeitung veröffentlichten Erläuterungen herzlich wenig bei. Was da als Verständnis bezüglich der aktuellen Zahlenkolonnen angeboten wird, ist eine Liste von zitierten Interessen, von Vor- und Nachteilsrechnungen, die verschiedene im Außenhandel engagierte Instanzen anstellen. Für diese ist das jeweilige Austauschverhältnis ein mehr oder minder brauchbares Instrument ihrer Kalkulationen, wobei es die Wirtschaftsjournalisten nicht im geringsten stört, wenn sich in ihren Besinnungsaufsätzen die Ansprüche ein bißchen in die Quere kommen. Die Fachleute präsentieren sich gleichzeitig als Anwälte von industriellen Branchen, von Wertpapierbesitzern, aber auch von Konsumenten und der Notenbank, um vom Wechselkurs zu verlangen, den konkurrierenden Geschäftsbedürfnissen zu genügen. Das führt nicht selten dahin, daß sich der gerade gültige Kurs einer Währung den Vorwurf einhandelt, er sei gar nicht der richtige. Solcher Idealismus beruft sich unverhohlen auf die Nation, deren Recht auf jede Menge Gewinn aus dem auswärtigen Handel für Wirtschaftsexperten fraglos feststeht. Und wenn sie bemerken, daß sie mit ihren „Analysen“ des ach so friedlichen Handels schlicht imperialistischen Umtrieben das Wort reden, ergänzen sie ihre Parteilichkeit um die überparteiliche Heuchelei einer Sorge um die „Weltwirtschaft“ insgesamt, deren gedeihlicher Fortgang im Interesse aller natürlich passende Wechselkurse benötigt…
Immerhin wird der Leser der diversen Handelsblätter von den Kennern der Szene, in der es um Dollar, Mark, Pfund und Yen geht, damit vertraut gemacht, daß er es bei den Währungswetterberichten mit den höchsten Fragen der inter-nationalen Konkurrenz zu tun hat. Von den Gründen, die den Wechselkurs und seine Schwankungen zu einer so bestimmenden Größe der freien Wirtschaft machen; zu einem Datum, an dem sich das Wohl großer Konzerne und das Wehe ganzer Nationen samt ihren Arbeitsplätzen entscheidet, erfährt er nichts. Die Auskünfte, die in diese Richtung zielen, lesen sich wie Bekenntnisse zum unergründlichen Irrationalismus des kapitalistischen Systems: Veränderungen im Austauschverhältnis zwischen Währungen werden erstens von den Märkten
herbeigeführt; und die gewichten zweitens ihre beiden Kräfte, Angebot und Nachfrage, nach dem strengen Kriterium des Vertrauens, das sie hegen.
*
Die jüngste „Talfahrt“ des Dollar bot reichlich Anlaß für die Nutzanwendung dieser Lehre. Es mußte sich schließlich ein Reim gemacht werden auf das praktische Problem, das alle haben, die Dollars haben – und das sind nicht wenige. Von Privatleuten über große Konzerne bis zu Staatskassen verfügen massenhaft Statisten und Macher der Weltwirtschaft über Reichtum in Form von Dollars; der ist nun weniger geworden; wer sich auf dem Weltmarkt damit etwas kaufen will, muß beträchtlich mehr hinlegen als vor einem halben Jahr. Also hat die Wirtschaft, Abteilung Sachverstand, beschlossen, eine zurückgehende Nachfrage nach dem US-Geld auszumachen, die vom mangelnden Vertrauen auf die Güte dieses Stoffs zeugt. Jetzt ist der Dollar gesunken und gibt damit denen recht, die nichts mehr auf ihn gaben.
Der leicht zirkuläre Charakter solcher Befunde verschwindet auch nicht, wenn das Mißtrauen in das amerikanische Geld gerechtfertigt wird: Das Schwanken der US-Politik – in Zinsfragen, aber auch überhaupt –, die Attraktivität anderer Geldsorten, die schon länger konstatierte „Überbewertung“ des Dollar – all diese Zusätze machen die Begründung nicht plausibler. Und noch merkwürdiger nimmt sich die ausgiebige Erwähnung des Faktors aus, der vertrauensstiftend hätte wirken müssen, es aber nicht getan hat: „Gute Konjunkturdaten“ wurden aus den USA gemeldet, was sich für die Akteure des Geldmarkts gewöhnlich so übersetzt, daß die „fundamentals“ stimmen und für den Dollar sprechen. Deswegen vermelden die Kreise, die sich an ihre eigenen Kriterien nicht gehalten haben, jetzt noch eine gewisse Besorgnis über die „Volatilität“ der Märkte, die über sie gekommen sei. Und gehen weiterhin munter „aus dem Dollar“, nicht ohne anzumerken, daß sie dem Vertrauen, das sie gegenüber anderen Geldern praktizieren, durchaus nicht so recht trauen…
*
Nicht zu überhören ist im Sommer und Herbst 94, daß die Akteure des weltweiten Geldhandels weniger an der Vernunft ihrer Argumente als an dem Gelingen der Veranstaltung zweifeln, an der sie von Berufs wegen teilnehmen. Der prekäre Zustand, die Unberechenbarkeit, in die sie mit ihren seltsamen Berechnungen den internationalen Geldmarkt manövriert haben, ist ihre Sorge. Darauf abonniert, aus der kundigen Voraussicht von Tendenzen des internationalen Geldhandels Kapital zu schlagen, werden sie an der Verläßlichkeit ihrer Entscheidungskriterien irre. Nur noch eine Entscheidung hielten sie im letzten Halbjahr bei allem business as usual für geboten: die gegen den Dollar. Der US-Währung haben sie 1994 das Vertrauen entzogen, das sie ihr zuvor gewährt hatten. Als hätten sie gemerkt, daß dem Geschäft mit dem Dollar eine entscheidende Grundlage abhanden gekommen ist, verlegen sie sich in ansehnlichem Umfang auf andere Anlageformen ihres Geldes – und vollstrecken am Geld der Weltmacht Nr.1 bis auf weiteres ihr Urteil.
Daß die Teilnehmer am weltweiten Geldgeschäft dessen Zustand für kritisch halten, ist kein Wunder. Eher schon ist es erstaunlich, daß sich niemand findet, der Abstand nimmt von der täglich verbreiteten Sorge um die „Entwicklung“ auf den Geldmärkten und den Zirkus kritisiert, der sich da in kunstvollem Kontrast zu Arbeitslosigkeit und verhungernden Negern abspielt. Zumal dieser Zirkus vom Gegensatz zwischen den Nationen lebt, in denen die freie Marktwirtschaft tobt, und diesen Gegensatz zu neuer Reife bringt.
Der Grund des Währungsvergleichs oder: Was der Wechselkurs alles ins Verhältnis setzt
a)
Die Währung – das ist das Geld, in dem eine Nation rechnet. Was in diesem nationalen Maß nachgezählt wird, ist so verschieden wie die Klassen und Stände der staatlich organisierten und abgegrenzten Gesellschaft. Viele Leute widmen sich dem Gelderwerb durch Arbeit, die ihnen von anderen mehr oder weniger gelohnt wird, und geben das Verdiente zum Kauf des Notwendigen gleich wieder aus. Eine Minderheit gibt ihr Geld gar nicht eigentlich aus, sondern legt es an, um es zu vermehren. Die öffentlichen Hände ziehen sich von den Geldeinkommen ihrer Bürger etwas ab, um damit einen großen starken Staat zu machen. Armut, Reichtum, Macht – die gegensätzlichsten Dinge haben im Geld ihr Maß. Aber das Geldmaß eint Kapitalisten und Lohnarbeiter, Bankiers und Politiker: Es ist unverwechselbar national.
Ein anderer Staat – und es wird anders gerechnet. Dabei sind die Rechnungsarten, die Verwendungsweisen des Geldes gar nicht verschieden; auch anderswo ist Geld der Zweck aller wirtschaftlichen Tätigkeit und wird verdient und ausgegeben je nach dem, wieviel davon einer schon hat. Nach Beseitigung der letzten systemwidrigen Ausnahmen kann ein jeder hinter jeder Grenze die ihm vertrauten Funktionen des Geldes wiederentdecken. Allerdings in anderer Maßeinheit; wo die nationale Hoheit endet, da hört die Verwendbarkeit des nationalen Geldes auf und fängt die Zuständigkeit eines anderen Kauf- und Zahlungsmittels an.
So schließt der Mensch Bekanntschaft mit einer Tatsache, der er sonst kaum Beachtung schenkt: daß das Geld eine allerhöchste Gewaltfrage ist. An diesen Scheinen, auf denen Schilling, D-Mark oder Lire steht, hängt private Verfügungsmacht, weil ein Staat mit seiner souveränen Hoheit dafür geradesteht. Einen eigenen Gebrauchswert haben sie ansonsten nicht; aber weil die Staatsmacht es so verfügt, hängt überhaupt jeder Gebrauchswert, hängt alles Benutzen und Verbrauchen von Erwerb, Besitz und Hergabe dieser Zettel ab. Sie sind nicht bloß eine beliebige Recheneinheit für materiellen Reichtum, der ansonsten nach seinen nützlichen Eigenschaften bestimmt wäre – als Träger jeglichen Verfügungsrechts sind sie der materielle Reichtum der Nationen, die kapitalistisch wirtschaften, also aller.
Freilich erst einmal nur, soweit die nationale Staatsmacht reicht; das bringt die Tatsache, daß es sich bei dieser eigentümlichen Sorte Reichtum eben um ein gesellschaftliches Gewaltverhältnis handelt, so mit sich. Aber so ist es gar nicht gemeint, daß sich nur im Innern einer Nation alles ums Geld dreht, zwischen ihnen dagegen eine andere Definition von Reichtum gelten sollte. Wenn schon der Reichtum der Nation in ihrem Geld existiert, dann liegt auch und gerade nach außen alle ökonomische Potenz der Nation und ihrer wirtschaftenden Bürger in dem Geld, das dort verdient wird. Die private Verfügungsmacht über die Warenwelt, die am Geld hängt, ist vom Staat, der sie garantiert, als ausschließlich gültiger „Begriff“ von Reichtum und durchaus absolut gemeint, nicht bloß als Regel in einem nationalen Gesellschaftsspiel.[1] Die Zuständigkeit der nationalen Währung mag zwar an der nationalen Grenze aufhören – der Reichtum, so wie ihn die nationale Währung beziffert, besteht fort; Geld ist mehr als seine national beschränkte Formel: So will es jeder Staat, der seiner Nation den Gelderwerb als Wirtschaftszweck vorschreibt.
Und darüber werden die Staaten sich einig, wenn sie ihre Währungen für austauschbar – „konvertibel“ – erklären: Im Wechsel der Währungen anerkennen sie die absolute Gültigkeit des Geldes, das alle Währungen sein wollen.
Zu Zeiten der Edelmetallzirkulation war dieser Zusammenhang übrigens ein wenig anschaulicher: Die Materie des Geldes[2] war für alle handeltreibenden Nationen dieselbe; mit der staatlichen Prägung wurden Gediegenheit und wahres Gewicht des zirkulierenden Edelmetalls beglaubigt. Und weil mit dem Recht auf Prägung die Macht zur Fälschung der Münzen gegeben war, bekam das geprägte Metall zum Zwecke des Dementis den Namen Währung.
b)
Die Funktionen, die im Ausland dessen Währung verrichtet, sind dieselben wie die des heimischen Geldes im Inland: Kaufen, Zahlen. Deswegen sieht sich auch ein jeder beim Gebrauch fremden Geldes herausgefordert, zur Identität die Differenz zu ermitteln: zu vergleichen, ob das fremde Geld in seinen vertrauten Funktionen auch genausoviel leistet wie das heimische, das man dagegen eingewechselt hat. Das versteht sich nämlich gar nicht von selbst; um so weniger, als bei dieser Prüfung dann doch wieder nicht bloß die Nationalität eine Rolle spielt, sondern wer zu welchem Zweck den Währungsvergleich anstellt. Wer die Reste seines Jahreseinkommens für ausländische Speisen und Getränke auf den Kopf haut, rechnet anders mit der „Kaufkraft“ seines Geldes als „die Wirtschaft“, der es um alle Leistungen geht, die einheimisches und fremdes Geld bzw. eines im Verhältnis zum andern in Sachen seiner Vermehrung zu bieten hat. Das schließt den Kauf von Waren im Ausland ein, erschöpft sich aber darin überhaupt nicht; die Rentabilität einer Investition beruht auch auf dem Verkaufserlös; und am täglich bekanntgemachten Stand von Zinsen und anderen Renditen kann Normalverbraucher ersehen, daß es bei den Leistungen nationaler Gelder mehr zu vergleichen gibt als die Kosten für ein Strandbier und Benzin.
Entscheidend ist jedenfalls nicht, ob das Maß der Beschränkung aller Lebensbedürfnisse, das die Lohnsumme definiert, überall haarscharf dasselbe ist. Von Bedeutung ist, ob der kapitalistisch angewandte Reichtum seinen Wert behält und seine Vermehrung mindestens genausogut vonstatten geht, wenn er die Währung wechselt. In der Hinsicht nehmen die nationalen Gelder im Wechselkurs aneinander Maß, unterwirft der Austausch sie einem Vergleichstest.
Und das Ergebnis ist regelmäßig alles andere als Gleich-gültigkeit. Davon gehen die Staaten, die ihrer Gesellschaft das Kapital als Lebensmittel verordnet haben, selber aus, wenn sie, um das Wachstum des Kapitals zu befördern, übereinkommen, die lokale Beschränkung der Verwendbarkeit ihrer Währungen per Austausch aufzuheben. Mit der Eröffnung des auswärtigen Handels durch die Festsetzung eines Wechselkurses ist es da nämlich nicht getan. Die Souveräne verlangen einander eine ökonomische Garantie für die internationale Gültigkeit ihres Geldes ab. Die Austauschbarkeit der Einkünfte und Überschüsse, die Geschäftsleute aus aller Herren Ländern in einer Währung erworben haben, muß von deren Hüter gewährleistet sein, sooft die Besitzer dieser Gelder sie nicht wieder dort anlegen wollen, wo sie sie erworben haben. Der Souverän bedarf daher eines Staatsschatzes, mit dem er seinen ausländischen „Partnern“ gegenüber für die allseitige Verwendbarkeit und ungeschmälerte Leistungsfähigkeit des von ihm in Umlauf gebrachten, von ausländischen Unternehmern verdienten Geldes geradesteht. Auch daran hat sich seit den Tagen der Edelmetallzirkulation einiges geändert; moderne Nationen erfüllen ihre Pflicht zur Begleichung auswärtiger Forderungen nur noch in letzter Instanz mit einem Goldschatz, erst einmal mit Devisenreserven, die sich ansammeln, solange Unternehmen von ihrem Boden aus ausländisches Geld verdienen. Gefordert ist aber auf alle Fälle, daß der Souverän nachweislich in einem anderen Geld als demjenigen zahlungsfähig ist, für das er selber mit seiner bloßen Gewalt die Gewähr übernimmt: Er muß ein Geld vorweisen, das dem jeweiligen Gläubiger – dem Besitzer seines Geldes bzw. von Forderungen gegen ihn – dort den Zugriff sichert, wo ein aussichtsreiches Geschäft ihn hinverschlägt; ein Geld also, das es gestattet, die lokale Beschränktheit der fälligen Zahlung abzustreifen; ein Geld, über das der in die Pflicht genommene Staat allein aufgrund erfolgreicher ökonomischer Aktivitäten seiner Gesellschaft verfügt und nicht bloß, weil er es sich „geprägt“ hat – insoweit also echtes Weltgeld.
Diese Forderung ist aufschlußreich: Sie gibt Aufschluß darüber, worauf es beim Umwechseln von Währungen ankommt.
c)
Wenn der internationale Handel von Dauer sein soll, dann müssen nicht bloß alle technischen Vorkehrungen dafür getroffen sein, daß über die Währungsschranke hinweg ge- und verkauft, Kapital angelegt und Profit abgeholt werden kann. Der Herr des Geldes, der Staat, muß dafür geradestehen, daß wirklicher, kapitalistisch verwendbarer – also Geld- – Reichtum abfließen kann aus der Nation. Und das nicht bloß zeitweilig, und um alsbald wieder zurück-verdient zu werden. Er muß von vornherein für einen Fall Vorsorge treffen, der sich als Konsequenz dauerhaft negativer Handelsbilanzen einstellt: für den Effekt, daß die Außenhandelspartner nicht mehr bereit sind, das Verdiente in Landeswährung davonzutragen, um es daheim als wertvollen Devisenschatz aufzustapeln, sondern andere Valuta sehen wollen. Die Befriedigung dieses Anspruchs muß die Nation mit ihrem Bestand an Gold und Devisen sicherstellen – also einen Transfer von Reichtum, der auch dann weitergeht, wenn die konvertible Währung des Landes – dessen autonomer Geldreichtum – nicht mehr gefragt ist. Das ist unerläßliche Bedingung, um am internationalen Geschäft teilzunehmen. Und wenn das die Bedingung ist, dann wird das freie Ex- und Importieren auch mit einer gewissen Folgerichtigkeit und Zielstrebigkeit darauf hinauslaufen, daß eine Nation einseitig an der anderen verdient, Reichtum in Geldform übertragen wird.
Dieser Endzweck des gesamten Unternehmens, das mit ein bißchen Ex- und Import so unschuldig anfängt, ist dem einzelnen Außenhandelsgeschäft nicht anzusehen: Da kauft und verkauft ein Kapitalist, um mit überlegener Rentabilität für seine Produkte Kaufkraft auf sein Unternehmen zu ziehen, Konkurrenten auszubooten und Profit zu machen. Wenn er damit Konkurrenten im eigenen Land ruiniert, dann hat er dort ein neues Preis- und Profitniveau durchgesetzt; und auf der Basis geht die Konkurrenz ums rentabelste Produzieren weiter. Mit dem Wachstum des Kapitals wächst der Reichtum der Nation. Anders im auswärtigen Handel. Da bringt der Konkurrenzerfolg eines ausländischen Unternehmers Produktion von einheimischem Reichtum zum Erliegen oder läßt sie erst gar nicht entstehen – was erst einmal nicht schade sein muß. Doch was als Einbeziehung ausländischer Lieferanten und Käufer in das Geschäft eines Kapitalisten los- und mit einem grenzüberschreitenden Konkurrenzkampf zwischen kapitalistischen Firmen weitergeht, das wächst sich mit zunehmendem Außenhandel und der Entstehung eines Weltmarkts zu einer Konkurrenz aus, der sich alle Unternehmen stellen müssen, die also die Nation mit den bei ihr üblichen Preisen und Profitraten betrifft. Wenn das national Übliche international nichts taugt, wenn Niederlagen in der Konkurrenz nicht durch Erfolge aufgewogen, sondern infolge insgesamt und durchschnittlich mangelhafter Kapitalproduktivität zum Trend werden, dann zeigen die nationalen Bilanzen zunehmend eindeutige Vorzeichen, und das grenzüberschreitende Geldverdienen – von dem auch im unterlegenen Land durchaus etliche Kapitalisten noch profitieren mögen – gerät national zum Verlustgeschäft. Da nutzt es überhaupt nichts, daß fürs Geld ja immer Waren geliefert, insoweit also Äquivalente zwischen den Nationen ausgetauscht worden sind: Ganz praktisch zeigt sich, daß im Kapitalismus erst der abstrakte, als Geld vorliegende Reichtum fertiger, wirklicher Reichtum ist. Der wandert, dem Strom der rentabler produzierten Waren entgegen, über die Grenze. Die Nation, die von den Produkten auswärtiger Produzenten lebt, hat es nicht etwa bequem, sondern wird ärmer.
Von der Art sind die Befunde, wenn Nationen vergleichen, was ihr eigenes Geld im Vergleich zu fremdem leistet. Geld ist Geld; aber wenn die Nation sich auf den Welthandel und damit auf den internationalen Vergleich einläßt und dann die nationale Produktion sich als im Durchschnitt weniger rentabel erweist als anderswo, dann nährt die heimische „Kaufkraft“ das Wachstum bei der Konkurrenz – und verschlechtert die eigene Konkurrenzposition noch immer weiter.[3] Umgekehrt umgekehrt. Der Geldumtausch erledigt zivil, wirksam und dauerhaft, wozu in grauer Vorzeit Kriege nötig waren: Indem erfolgreiche Kapitalisten Märkte in aller Welt okkupieren, „erobern“ sich deren Heimatländer das Geld anderer Nationen – und werfen angesichts ihrer eigenen Erfolge auch noch die Frage auf, welchen Reichtum und wieviel produzierten Wert das Geld einer Nation eigentlich noch zählt, deren Bilanz dauerhaft im Minus ist. So anspruchsvoll werden Staaten, deren Kapitalisten weltweit gut verdienen und dadurch ihrem Standort wachsenden Reichtum heranschaffen: Weil sie sich am Ausland bereichern, verlangen sie von ihren unterlegenen Partnern einen Staatsschatz als Sicherheit dafür, daß die Bereicherung auch klappt.
Diese Versicherung ist allerdings noch aus einem anderen Grund sehr nötig.
d)
Mit der Festlegung eines Austauschverhältnisses zwischen ihren Währungen erkennen die Staaten diese als Geld schlechthin an, eben in festgelegter Proportion zum jeweils eigenen; aber dabei bleibt es nicht. In der Verpflichtung ihrer Bürger auf den Erwerb der nationalen Zahlungsmittel genehmigen sich die Nationen die einer souveränen Führung zustehende Freiheit der Verschuldung. Auf der einen Seite autorisieren die Staaten die Kreditschöpfung ihrer Bankinstitute, indem sie den daraus erwachsenden Bedarf an allgemein anerkannten Zahlungsmitteln durch ihre Notenbank nach festen Regeln befriedigen; so emanzipiert sich grundsätzlich die Masse des Geldes, das Kapitalisten ehrlich verdienen können, von der Summe der Warenwerte, die sie produzieren. Für beträchtliche aus dem Nichts geschaffene Geldsummen, die dem kapitalistischen Erwerbstrieb lohnende Ziele setzen, sorgen wiederum die Staaten mit ihrem – den Kapitalisten abgeschauten und frei variierten – Brauch, sich bei ihrer Gesellschaft zu verschulden, sprich: auf dem Wege des Kreditpapiers Zahlungsfähigkeit an sich zu ziehen, deren Schöpfung sie in ihrer Eigenschaft als Notenbank mit der Emission von Geldscheinen alimentieren. Dies war überhaupt die systemkonforme Methode, mit der die modernen Nationen ihr Geld vollständig von der Last befreit haben, selber Wert zu haben oder wenigstens eine Art Anweisung auf ein Quantum gediegenen Edelmetalls zu sein. Seither zirkulieren in den Nationen, die alles vom Geld abhängig machen, statt Geld jede Menge Kreditzeichen, die durch nichts „gedeckt“ sind als durch staatlichen Zwang.
Dies tun, wie gesagt, alle Staaten; aber sie tun es in unterschiedlichem Umfang und Verhältnis zu dem in Geld gemessenen Reichtum, den ihre Gesellschaften produzieren. So schaffen zwar alle Staaten jede Menge Freiraum für die banale Kunst der Unternehmer, mit ihrem Angebot alle zahlungsfähige Nachfrage auszunutzen, also zu nehmen, was sie kriegen können. Im Endeffekt steigern sie die ortsüblichen Preise so flächendeckend, daß die Währungshüter diesen Effekt besorgt als Inflation beäugen: als – wörtlich – Aufblähung von Kredit und Geld ohne entsprechendes Wachstum des Werts, auf das der Kredit bezogen ist und den das Geld doch gültig – und zwar allein- und endgültig! – darstellt. Dieser Trend fällt logischerweise um so krasser aus, je weiter eine Staatsmacht sich mit ihrer Schöpfung von eigener Zahlungsfähigkeit über das Maß des wirklich produzierten nationalen Reichtums hinwegsetzt. Daß sie das allemal nur tut, weil ihr dieses Maß nicht reicht; daß sie das nicht zuletzt in der Absicht tut, durch „Geldspritzen“ das kapitalistische Wirtschaftswachstum in Schwung zu bringen – Not und frommer Wunsch also helfen nichts: Die staatliche Verschuldung macht das Maß des nationalen Reichtums selbst veränderlich.
Die Folgen fürs internationale Geschäft und den Währungsvergleich bleiben nicht aus. Das Eine sind die absehbaren Wirkungen auf die Konkurrenz der Kapitalisten der verschiedenen Länder: Das Preisniveau, auf dem die einen – mit ihrer höheren Inflation – konkurrieren müssen, mit dem die anderen – mit ihrer geringeren Geldentwertungsrate – konkurrieren können, begünstigt diejenigen mit dem stabileren Geld; am Land mit der höheren Teuerungsrate wird leichter und einseitiger verdient.[4] So geraten die Freiheiten, die die Nationen sich intern mit ihrem Kreditgeld herausnehmen, in Gegensatz zu den internationalen Bilanzen, auf die sie Wert legen. Auf der anderen Seite stellt sich bei auffällig hoher Inflationsrate eines Landes für dessen Geschäftspartner dann doch praktisch und dringlich die Frage, was das dort verdiente Geld noch wert ist. Es hilft ja nichts, daß man es leichter und mehr davon verdienen kann, wenn es im Verhältnis zur stärkeren Währung immer weniger leistet – nicht bloß als Kaufmittel, sondern vor allem als Vorschuß für lohnende Investitionen. Es kommt hinzu, daß diese Schwäche nicht bloß die Summen betrifft, die der eine oder andere Geschäftsmann aktuell verdient. Auch was früher verdient worden ist und nun in anderen Nationen als deren Devisenschatz herumliegt, wird untauglich(er) für den Zweck, zu dem diese Nationen solche Summen überhaupt aufbewahren, nämlich als Sicherheit für ihren Außenhandel. Schon wieder zeigt sich, daß der Zufluß von Reichtum in Form konvertibler Landeswährung des Handelspartners noch gar nicht genügt: Es gilt erst noch eigens sicherzustellen, daß es wirklich Wert ist und bleibt, was da an fremder Valuta hereingekommen ist, und nicht bloß immer nutzlosere Kreditzeichen.
Doppelt weise also, gerade bei einem schwächeren Handelspartner auf die Devisenreserven zu achten. Wenn man – nämlich eine nationale Geschäftswelt mitsamt ihrem Staat, der für die Sicherheit ihres Erfolgs einsteht – an ihm verdienen will, muß man ihn nicht nur fürs Geldverdienen überhaupt, sondern auch noch dafür in Anspruch nehmen, daß man das Verdiente in stabilerem Geld als seiner Landeswährung ausgezahlt bekommt. Freilich ist so die Erschöpfung seiner Devisenreserven nur allzu absehbar und damit der Offenbarungseid, daß das selbstgeschaffene Geld der betroffenen Nation gar kein Geld mehr darstellt – zumindest nicht soviel Reichtum wie im Wechselkurs versprochen. Denn so ein Offenbarungseid wird nicht irgendwann, wenn alles zu spät ist, definitiv und abschließend geleistet, sondern häppchenweise in Form von Abwertungen. Die verkleinern den gesamten Reichtum der Nation, indem sie sein verbindliches Maß im Verhältnis zum Geld der andern neu, nämlich kleiner einstellen. Jeder gegebene Wechselkurs ist der praktische kritische Test darauf, ob die Leistungsfähigkeit einer Währung, Erhaltung und Vermehrung des kapitalistischen Reichtums der Nation betreffend, den Vergleich mit anderen Geldern aushält; jede Revision des Wechselkurses bescheinigt der abgewerteten Valuta, um wieviel Prozent ihre vergleichsweise Geldqualität wieder einmal zu wünschen übriggelassen hat.
Auf diese Weise bilanziert der Währungsvergleich fortwährend, wie weit es mit dem Ruin eines nationalen Geldes durch Abfluß des nationalen Reichtums jeweils gekommen ist – und umgekehrt: in welchem Maß das erfolgreichere Land sich mit dem Reichtum vollsaugt, den seine Kapitalisten auswärts verdienen. Und so scheiden sich über Konvertibilität und Tausch der Währungen unaufhörlich Gewinner und Verlierer des Welthandels.
e)
Damit der Außenhandel nicht ausgerechnet dann zum Erliegen kommt, wenn er für die Gewinner am schönsten ist, nämlich wegen mangelnder Zahlungsfähigkeit der schwächeren Partner, sind die modernen Nationen dazu übergegangen, ihre Forderungen und Verbindlichkeiten gegeneinander nicht mehr unbedingt durch Zugriff auf den fremden – bzw. Rückgriff auf den eigenen – Staatsschatz auszugleichen, sondern die einseitigen Geschäfte weitergehen zu lassen und sich die Schulden zu merken, auf ihrer Bedienung mit Zinsen zu bestehen und sie zu verwenden, als wären sie Geld.
Angefangen hat diese Unsitte mit der Gründung eines gemeinsamen Fonds, einer Art internationaler Staatsschatz, gespeist von Einzahlungen der beteiligten Staaten in Gold sowie in eigener Währung, die damit weltoffiziell als nationaler Ausdruck für den von allen Nationen gemeinten absoluten Geldreichtum anerkannt war. Auf den durften Staaten in Zahlungsnöten nach festen Regeln zurückgreifen und ihre Defizite durch ihr genau quantifiziertes „Recht“ ausgleichen, wegen ihrer „Sonder“lage aus dem gemeinsamen Topf anerkanntes Geld herauszu„ziehen“ – die „Sonderziehungsrechte“. Die Idee war die, daß Nationen schon mal „Liquiditätsprobleme“ haben könnten, über die man ihnen aber hinweghelfen müsse, damit sie nicht noch schlimmer würden, sondern alsbald – unter kundiger Beratung durch Fachleute aus erfolgreicheren Nationen – wieder überwunden. Ein wenig verlogen war diese Gründungsidee des „Internationalen Währungsfonds“ allerdings schon immer: Was da zum bloßen „Zahlungsengpaß“ herunterdefiniert wird, ist die vorab ins Auge gefaßte Konsequenz, daß Staaten infolge ihrer Teilnahme am internationalen Geschäftsleben offenbaren müssen, kein Geld mehr zu besitzen. Mit der Einrichtung des IWF ist deswegen tatsächlich auch mehr in die Wege geleitet worden als ein System von Überbrückungshilfen.
Die Weltwirtschaftsmächte sind übereingekommen, eigentlich fällige Offenbarungseide zu suspendieren und dadurch zu verhindern, daß „Partner“, die allen Grund dazu hätten, aus dem freien Welthandel aussteigen. Den zwischenstaatlichen Bilanzausgleich durch Zahlung des abstrakten Reichtums, den alle Staten mit ihrer konvertiblen Währung gleichermaßen meinen, aber so unterschiedlich realisieren, haben sie damit nicht bloß vertagt, sondern durch den Beschluß ersetzt, auch untereinander Zahlungsversprechen anzuerkennen und Kreditpapiere wie Geld gelten zu lassen. Was sie sich innerhalb ihres Hoheitsbereichs und kraft ihrer Geldhoheit herausnehmen – nämlich: ihren ungedeckten Geldbedarf mit Schuldscheinen zu befriedigen, die als zirkulationsfähiger Geldersatz die nationale Zahlungsfähigkeit aufblähen –, das übertragen die Staaten auf ihr Verhältnis untereinander und gestatten es sich wechselseitig. So setzen sie per Konvention das Ergebnis des Dauertests außer Kraft, dem der Währungsvergleich und -austausch die Reichtumsproduktion der Nationen und die hervorgebrachten nationalen Gelder unterwirft. Dieses großzügige Entgegenkommen den Schwächeren gegenüber verfolgt das Ziel und zeitigt daher auch das Ergebnis, daß der Transfer von Reichtum aus den unterlegenen Ländern hin zu den Nationen, die einseitig an ihnen verdienen, nicht abreißt. Um der Kontinuität ihres Zugriffs willen sind die Gewinner der internationalen Konkurrenz eben sogar zu der Absurdität bereit, sich die Defizite ihrer ruinierten Partner als echte Guthaben in die Bilanzen zu schreiben und unerschütterlich auf deren Geldqualität zu bestehen. Dafür geradestehen müssen natürlich die Schuldner: Die haben den Beweis für die Geldqualität ihres Minus durch pünktliche Zinszahlungen zu erbringen – auch wenn die dann selber wieder, nie ohne langwierige Verhandlungen, gestundet und gemeinsam mit der Hauptsumme mit Zinspflichten belegt werden…
f)
Mit diesem Kunstgriff sind gewisse Neuerungen in den Alltag des Währungsvergleichs eingezogen.
So gibt es Staaten – nicht bloß sog. Entwicklungsländer, sondern respektable Nationen –, die Jahr für Jahr mit chronischen Außenhandelsdefiziten weiterwirtschaften. Deren Zahlungsfähigkeit wird mit nationenübergreifenden Betreuungsaktionen aufrechterhalten; sogar für die internationale Verwendbarkeit ihrer Valuta wird Sorge getragen – weil sonst arg viel Reichtum annulliert werden müßte, den andere an diesen Ländern verdient haben, und der Fortgang des Geschäfts Schaden nehmen würde. Freilich bringt dieses Verfahren neuartige Gesichtspunkte für den Währungsvergleich auf: Wenn die Geldqualität nationaler Gelder darauf beruht, daß die Gemeinschaft der Konkurrenten übereinkommt, den ans Ende ihrer Zahlungsfähigkeit gelangten Staaten Kredit einzuräumen, dann notiert der Wechselkurs dieser Währung nicht mehr einfach deren – schwindende – kapitalistische Leistungskraft; dann ist er vielmehr ein Urteil über die Kreditwürdigkeit der betroffenen Nation, über ihre relative Zuverlässigkeit als Schuldner und Zinsenzahler – alles auf Basis des supranationalen Beschlusses, die auf geborgtes Geld gegründete Währung nicht fallenzulassen. Unter allen Leistungen des Geldes, die der Wechselkurs über Währungsgrenzen hinweg vergleichbar macht, wird die nationale Qualität der Finanzanlagen entscheidend, die sich damit kaufen lassen: die Wertbeständigkeit, die dem Kreditpapier einer Nation zugetraut wird, und die Rendite, die dafür versprochen ist. So verzwickt kommen die kapitalistischen Nationen, die untereinander großzügig aufs Saldieren in Geld verzichten, auf die elementare Wahrheit ihres ökonomischen Systems zurück, daß zwischen ihnen letztlich doch nichts anderes zählt als der absolute abstrakte Reichtum – um den konkurrieren sie schließlich und nicht um wertlose Zettel.
Die „Agentur“, die diesen Währungsvergleich vornimmt, ist ein Geschöpf der Welthandelsstaaten, durch sie autorisiert, von ihnen abhängig, aber doch nicht unter ihrer Kontrolle – die Rede ist von den Weltfinanzmärkten, auch kurz „die Märkte“ genannt. Dem Geschäftssinn der Finanzkapitalisten werden die wertlosen, nicht durch eine übergeordnete souveräne Gewalt, sondern durch den kollektiven Beschluß der verschiedenen höchsten Gewalten gültig gemachten Kreditzettel der Nationen zu weiterer Behandlung nach den Gesichtspunkten kapitalistischer Verwertung anvertraut. Dieses Vertrauen der Staaten ins Geldkapital ist nur folgerichtig. Denn schon innerhalb ihres Hoheitsbereichs arrangieren und garantieren die bürgerlichen Souveräne ein Kreditwesen, das Schulden wie Zahlung verwendet und dieser fragwürdigen Gleichung dadurch das Fiktive nimmt, daß sie erfolgreich damit operiert – solange den damit eröffneten Geschäften der Erfolg treu bleibt. Da wird also schon dauernd so verfahren, als ob die Ausnutzung von Schulden als Geldkapital, das Rendite abwirft, die Solidität, nämlich Geldqualität der Schulden beweisen würde. Aus Erträgen eine fiktive Hauptsumme herausrechnen, die diese Erträge als Zins abwerfen würde; diese Summe als vorhandenen Reichtum ansetzen; sie sogar verkaufen oder beleihen – all das ist gefestigter Brauch im modernen Kapitalismus. Nichts liegt daher näher, wenn schon das Abrechnen zwischen den Nationen durch Anschreiben ersetzt werden soll, als diesen Brauch auch in die Handhabung der internationalen Schulden einzuführen. Dort kann das Geldkapital dann wieder seine Fähigkeit beweisen, Schulden und endgültiges Geld, wenn beides schon ein für allemal nicht dasselbe ist, ganz locker und ziemlich endgültig gleichzusetzen und unterschiedslos zu benutzen – oder sogar den Kredit, den akzeptierten Schuldschein, noch besser als bare Münze. Natürlich ist damit das Risiko verbunden, daß das bekanntermaßen mitleidlose Finanzgeschäft manchen Papieren ihre – relative – Wertlosigkeit nachweist, so wie das im Innern kapitalistischer Nationalökonomien ja auch laufend vorkommt. Um so mehr verlassen sich die Staaten darauf, daß über die kapitalistische Substanz ihrer grenzüberschreitenden Schuldverschreibungen ganz objektiv und sachgesetzlich befunden wird, wenn sie diese den Geldkapitalisten als zusätzlichen Stoff für deren Geschäfte offerieren. Sie sind sich sicher, mit ihrer neuen Methode, ihre Konkurrenz um den Reichtum der Welt über das Ende der Zahlungsfähigkeit ganzer Nationen hinaus fortzutreiben, der Logik der Ökonomie, die sie unbedingt haben wollen, bestens zu entsprechen, wenn eine Welt neuartiger Finanzgeschäfte daraus entsteht. Als müßten die Kreditpapiere der Staaten tatsächlich Wert sein, wenn sie nicht bloß von ihnen per Konvention dazu erklärt, sondern – ausgerechnet! – von freien Geldhändlern dafür genommen werden; und als wäre der ökonomische Erfolg der Nationen garantiert, wenn die herrschende Klasse auch noch aus dem Vergleich der nationalen Schulden ihr Geschäft macht.
Tatsächlich lösen die Welthandelsnationen damit ihr kapitalistisch Allerheiligstes: Geld als die endgültige Materie des Reichtums der ganzen Welt, in den Funktionalismus des Kreditgewerbes auf. Aber sie sehen es umgekehrt und wollen es so: das Kreditgewerbe als die praktische Garantie für die prinzipielle Geldgleichheit und zugleich als die systemgemäße Entscheidungsinstanz über die relative Geldgleichheit ihrer Schulden.
„Die Märkte“ haben diesen Auftrag übernommen. Wo so ein gigantisches Geschäft winkt, entziehen sie sich nicht ihrer imperialistischen Verantwortung.
Der Verlauf des Währungsvergleichs oder: Wie Wechselkurse gemacht werden
Noch vor wenigen Jahrfünften waren Wechselkurse und ihre Veränderung Staatsaffären von höchstem Rang, über die Regierungen stürzen konnten.[5] Heute sind sie das Alltagsgeschäft der Börsen – ein bemerkenswertes Beispiel für die erfolgreiche Privatisierung eines öffentlichen Dienstes. Denn daß die wichtigsten Nationen der kapitalistischen Welt schlecht damit gefahren wären, daß sie den Währungsvergleich „freigegeben“, nämlich den professionellen Devisenhändlern überantwortet haben, kann man ja wirklich nicht behaupten. Um so interessanter die Frage, wie diese Mannschaft das eigentlich hinkriegt, immer die richtigen Kursverhältnisse zu treffen – oder sind es am Ende doch die falschen?
a)
Ausländisches Geld wird von Exportkaufleuten verdient, von Importkaufleuten nachgefragt. Dieser Teil der Geschäftswelt rechnet – so ähnlich wie der Tourist – mit gegebenen Wechselkursen; er kalkuliert – ein wenig anders als der Tourist – mit doppelten Preisen; er stellt Vergleiche zwischen Geschäftschancen daheim und auswärts an; aber er stellt sie nicht her. Produzenten und Kaufleute, die grenzüberschreitend Geld verdienen wollen, finden sich im Wechselkurs einem vorgegebenen Vergleich des Geldes, das in ihrem angestammten Standort gilt, mit demjenigen, das sie andernorts verdienen oder gewinnträchtig ausgeben wollen, subsumiert.
Die Beschaffung der Devisen, die sie brauchen, ebenso wie die Verwahrung, Verwaltung und Weiterverwendung derjenigen, die sie verdient haben, ist Sache ihrer Bank. Dieser Erwerbszweig hat ohnehin den Geldreichtum der Gesellschaft bei sich konzentriert, um ihn und jede anfallende Transaktion im nationalen Geschäftsverkehr zum Mittel seines Kreditgeschäfts zu machen. Mit Geld ausländischer Denomination macht er da keine Ausnahme; freilich mit dem Zusatz, daß man sich den Akt des Umtauschens extra bezahlen läßt: Devisen werden mit Abschlag entgegengenommen, mit Aufschlag verkauft.
Welchen Dienst die Banken sich auf diese unkomplizierte Weise vergüten lassen, das hängt davon ab. Davon nämlich, was ihre außenhandelnde Kundschaft ihnen hereinreicht und von ihnen braucht. Denn für die Bank, die das alles sammelt und das Aggregat aller verdienten und gewünschten Währungen im Blick hat, ist keineswegs eine fremde Valuta so ausländisch wie die andere. Für sie zeigen die angebotenen und verlangten Devisen und dementsprechend sogar das eigene Geld spezielle Eigenschaften, von denen ihr Kunde mit seinen besonderen und beschränkten Geschäftsinteressen gar nichts mitbekommt. Da gibt es Währungen, die in großer Menge hereinkommen und wieder hinausgehen. Mit denen ist gut handeln: Reichlicher Zu- und Abfluß gibt nach beiden Seiten schöne Gewinne her. Bestände zu horten, ist gerade so gut wie eine Einlage in einheimischem Geld: sichere Grundlage für Kreditgeschäfte in jeder beliebigen Währung; denn im Bedarfsfall ist eine so flüssige Valuta schnell und leicht in jedes gewünschte Zahlungsmittel verwandelt. Es handelt sich also einwandfrei um gutes Geld. Gutes Geld sind, ebenso offensichtlich, Devisen, die massenhaft benötigt werden, aber nur spärlich hereinfließen. Allerdings muß man hier für die Beschaffung mehr berechnen; das Verlangte kann ja nicht aus dem Durchfluß durch die Devisenkassen der Banken geschöpft, sondern muß erst von ausländischen Partnern ausgeliehen oder gekauft werden. Eine Notwendigkeit, die aufs eigene Geld kein gutes Licht wirft: Offenbar ist das zu wenig gefragt. Die Gegenprobe bietet das umgekehrte Geschäft, die Nachfrage auswärtiger Branchenkollegen nach inländischem Geld: Je stärker und einseitiger die ausfällt, um so größer der Spielraum, die heimische Währung teuer abzugeben. Das spricht, rein bankmäßig, für deren Qualität. Umgekehrt umgekehrt. Schließlich finden sich unter den Geldern, die den Banken hereingereicht werden, sei es von der außenhandelnden Kundschaft, sei es von ausländischen Devisenhändlern, immer wieder welche, mit denen sich außer beim Ankauf überhaupt kein Geschäft machen läßt: Sie sind nicht gefragt, also auch nicht leicht in gängige Währung umzuwandeln, als Sicherheit und Grundlage für Kreditschöpfung daher auch nicht geeignet. Das Tauschgeschäft ist hier im Grunde erst fertig, wenn diese Valuta, schlimmstenfalls bei der ausländischen Notenbank, die sie herausgegeben und zu verantworten hat, in brauchbares Geld umgewandelt worden ist. Eine Umständlichkeit, die der einreichende Kunde selbstverständlich mit Sonderabschlägen vom amtlichen Kurs bezahlen muß. Damit sind alle Zweifel beseitigt: Solches Geld ist schlecht.[6] Die Geschäftspraxis liefert das zusammenfassende Urteil.
Das Bankgewerbe bedient also seine im Außenhandel engagierte Kundschaft; aber das ist nur der Auftakt. Es faßt die Erträge und Bedürfnisse der Außenhändler im nationalen Maßstab zusammen; das bedeutet: Es transferiert mit seinen Austauschdiensten per Saldo Reichtum aus einer Nation in die andere; es bilanziert praktisch das Gesamtergebnis des Geldzu- und -abflusses, für die eigene Nation und für deren Handelspartner gleich mit. Und mit diesem Vergleich der Gesamtbilanzen: mit dem, was im Endergebnis des Zu- und Abflusses von Reichtum die Gelder der Nationen im Verhältnis zueinander wert sind und wie flott oder schwer sie sich deswegen austauschen lassen, machen die Devisenhändler ihr Geschäft. Dieses Geschäft bewerkstelligt einen Leistungsvergleich der Nationen und lebt davon, eben indem es mit seinen Auf- und Abschlägen in Rechnung stellt, welche Nationen im Welthandel, soweit er die eigene Nation berührt, bloß oder überwiegend mit Geldabfluß abschneiden, welche hingegen sich bereichern und wie einseitig. Im Mittelpunkt des Geschäfts steht dabei immer das Geld der eigenen Nation[7]: Je nach dem nämlich, zu welcher Sorte es gehört, läuft das Devisengeschäft grundsätzlich ab. Dessen Mittel besteht in dem, was die Währung der Nation als solche wert ist – und nicht, was sich mit dieser oder jener Summe hier oder dort kapitalistisch anfangen läßt; das ist die Sache der Außenhandelskaufleute.
Denen gegenüber repräsentieren die Banken den Standpunkt der nationalen Gesamtbilanz und geben damit die entscheidende Bedingung vor, unter die deren Geschäfte subsumiert sind: Am Wechselkurs, an dem die Geldhändler verdienen, können die Außenhändler bemerken, wie sehr sie bloße Bestandteile eines nationalen Gesamt-Wirtschaftslebens sind und mit ihrem grenzüberschreitenden Geschäft schon wieder zum bloßen Element eines anderen Standorts werden. Das, worunter alle realen Außenhandelsoperationen eingeordnet sind: der Leistungsvergleich von Nation zu Nation, angestellt im Währungstausch, und im Wechselkurs zur unumstößlichen Geschäftsbedingung geworden – das ist es, womit die Bank beim Devisengeschäft operiert und woran sie verdient. Zuerst angetreten als bloßer Dienstleister für die Abwicklung der Geldseite von Ex- und Import, tritt das Bankgewerbe den produzierenden und handeltreibenden Kapitalisten nun in der Rolle des reellen nationalen Gesamtkapitalisten entgegen, der im Preis der Devisen den gültigen Bescheid erteilt, wie es um den Reichtum der Nation im Weltvergleich steht. Um die besonderen Einzelinteressen seiner Kundschaft kümmert es sich dabei überhaupt nicht.
Nach den Interessen des ideellen Gesamtkapitalisten, der das Geld stiftet, das sie geschäftstüchtig umtauschen, richten sich die Banken mit ihrer unbestechlichen Gesamtbilanz genausowenig. Für sie ist zwar die Währung der Nation die entscheidende Rechengröße, aber auch nur das: nicht mehr und nicht weniger als der Stoff, mit und an dem sie verdienen wollen. Gewiß haben auch sie – wie ihr Staat – ein elementares Interesse daran, über gutes Geld zu verfügen; und daß das vom kapitalistischen Leistungsstand ihrer Nation abhängt, weiß niemand besser als sie. Ihr Interesse hat aber nichts mit einer Sorge um die Herbeiführung guter Bilanzen zu schaffen, wie sie Regierungen beschäftigt. Als Finanzkapitalisten haben die Praktiker des gesamtnationalen Geldgeschäfts genug damit zu tun, auch schlechte Währung, so gut es eben geht – also auf Kosten des Staates und der ex- und importierenden Firmen –, auszunutzen und an guter Währung um so leichter zu verdienen.
Sie tun das nach Gesichtspunkten und in Geschäften, die die Sphären des gesunden Menschenverstandes Zug um Zug verlassen, ohne dadurch an imperialistischer Zweckmäßigkeit einzubüßen.
b)
Schon im gewöhnlichen Devisenhandel, durch den die Banken den Bedarf des auswärtigen Warenhandels an fremder Währung decken und verdiente Devisen in heimisches Geld umtauschen, emanzipiert sich der Standpunkt der Geldvermehrung durch Geldhandel von der Auftragslage. Diese geht stets von realisierten oder kalkulierten Gewinnen beim Kauf und Verkauf von Waren aus; darüber kommen Nachfragen und Angebote an die Adresse der Banken zusammen. Deren Devisenhändler hingegen eröffnen ihren speziellen Markt von vornherein mit dem Interesse, Differenzen auszunutzen, die das jeweilige nationale Geld als solches im Umtausch gegen ein anderes hergibt. Jede Schwankung im Geschäftsgang ist für sie eine Chance. Wann und wie groß, mit wieviel eigenem Vorschuß in der einen oder anderen Währung sie ins Geschehen einsteigen, um marginal niedrigere Einkaufs- oder höhere Verkaufspreise auszunutzen, das entscheiden sie nicht nach den aktuellen Kundenwünschen, sondern nach den Margen, die sie sich ausrechnen – ein Geldmengenproblem in dem Sinn, daß sie für lohnende Geschäfte gerade nichts erübrigen könnten, haben sie als Agenten der nationalen Kreditschöpfung ohnehin nicht. Nach Zeitpunkt und Umfang werden die Devisentransaktionen, die das Geldgewerbe tätigt, durch nichts als die Chance bestimmt, später mit der umgekehrten Transaktion Gewinn zu machen. So rufen zukünftige Geschäfte gegenwärtige ins Leben; im Verhältnis dazu werden An- und Verkaufsorders der kommerziellen Bankkundschaft zur ziemlich untergeordneten, jedenfalls externen Größe. Das Angebot und die Nachfrage, die den Devisenmarkt beherrschen, machen die Devisenhändler selber mit ihrer Spekulation.
Diese Sorte Geschäft hat schon funktioniert, als die Welthandelsnationen ihre Wechselkurse noch streng unter staatlicher Kontrolle gehalten haben – ausnutzbare Margen gab es da immer. Selbstverständlich hat es aber einen enormen Aufschwung genommen, seit alle wichtigen Wirtschaftsmächte die Auftragslage für ihre jeweilige nationale Kreditindustrie dahingehend erweitert haben, wie im Innern mit dem Zins, so auch nach außen mit dem Wechselkurs den gerechten und richtigen Preis fürs nationale Geld zu ermitteln. Seither konfrontieren die Geldhändler einander mit ihren kühnen, durch keinerlei Behördenwillkür beschränkten Kalkulationen, die sie aus ihren Feststellungen über die Güte oder Schlechtigkeit einer Devise ableiten. Frei und verbissen feilschen sie um Hundertstel-Pfennig-Beträge, bis sie sich über einen Austauschkurs einig werden, zu dem ihre Spekulation aufgeht – oder auch nicht. So wird der Wechselkurs selber vom Ausgangspunkt zum Objekt, Mittel und – fortwährend revidierten – Resultat eines Handelsgeschäfts, das auf Änderungen setzt, die es selbst herbeiführt.
Dieser Fortschritt hat Folgen. Vom Gang der spekulativen Devisengeschäfte hängen jetzt nämlich nicht mehr bloß die Konditionen ab, zu denen die Außenhändler ihre Devisen umgetauscht kriegen. Wenn die Wechselkurse selbst zum Spekulationsobjekt und -ergebnis werden, dann machen die Diener des Währungstauschs erstens die Außenhandelserträge in ungekanntem Ausmaß flexibel – und zweitens nicht bloß die, sondern den gesamten Geldreichtum aller Nationen, den privaten wie den der öffentlichen Hände. Es gibt kein von der Staatsmacht abgeschirmtes, in seinem administrativ festgelegten Wert geschütztes Geld mehr: Genau so wollten die Welthandelsmächte es ja haben, um sich den Reichtum aller Nationen zugänglich zu machen und ihre Konkurrenz über seine Verteilung entscheiden zu lassen. Sämtliche Finanzanlagen, die sichersten Kreditpapiere aller Nationen, kommerzielle wie Staatsschulden werden in den Währungsvergleich hineingezogen und in ihrem Wert unsicher.[8] Alle, die die schwere Last eines Geldvermögens zu tragen haben, müssen sich nun nicht bloß um dessen Rendite, sondern auch noch eigens darum kümmern, daß es nicht bloß durch den dummen Zufall, in der einen statt in der anderen Währung zu existieren, an Wert verliert, stattdessen alle fälligen relativen Wertsteigerungen mitnimmt.
Selbstredend können sie sich auch hier wieder auf ihre Bank verlassen. Das Geldgewerbe selbst macht nämlich sämtliche Finanzanlagen zum Material seines Spekulierens; oder genauer: Es macht die Finanzspekulation, die es in jeder Nation treibt, unter Einbeziehung des „Faktors“ Wechselkurs international. Damit vervielfältigen sich die Möglichkeiten und Risiken – Zinsen lassen sich gegen erwartete Wertveränderungen, Kursstürze beim Währungsvergleich gegen vermutete Zinssprünge ins Feld führen…; mögliche neue Konstellationen in der Zukunft geben wirkliche neue Optionen her, die sich ihrerseits wie eine Geldware verkaufen lassen. Der letzte leitende Gesichtspunkt ist dabei denkbar primitiv: Weil sie alles unsicher machen und jedes Wertpapier veränderlich, jagen die Spekulanten dem Ideal des Schatzbildners: der Stabilität des Werts nach; im Ideal der unverwüstlichen Geldanlage bekennen sie sich praktisch zu der millionenfach dementierten Wahrheit, daß es im Kapitalismus auf echtes Geld und sonst gar nichts ankommt. Ihre unermüdliche Suche nach der beständigsten Währung ist umgekehrt der Motor der Verunsicherung, die sie in ihre eigene Welt der zinstragenden Wertpapiere hineintragen. – Und selbstredend lassen die Banken ihre Kunden gerne an allen ihren finanziellen Abenteuern teilhaben und noch lieber mit ihren Einlagen dafür haften.
Über diesen Zirkus entscheidet sich nun die weltweite Verteilung des Kredits, mit dem produzierende und handeltreibende Kapitalisten der verschiedenen Nationen wirtschaften und ihre Staaten Wirtschaftspolitik treiben können. Und auf diese vertrackte Weise wird der Fluß des Reichtums zwischen den Nationen gelenkt, die Konkurrenz der Nationen entschieden und vorangetrieben. Indem sie das Kreditgeld der Nationen von ihrer Spekulation abhängig machen, schwingen sich „die Märkte“ mit ihren Finanzpapieren erster bis x-ter Ordnung zu der Funktion eines reellen internationalen Gesamtkapitalisten auf, der das Geld der ganzen Welt zur Grundlage eines von ihm gehandhabten Weltkreditüberbaus macht – das kommt davon, daß die maßgeblichen Nationen der kapitalistischen Welt ihre Finanzunternehmer zu jeder Sorte grenzüberschreitendem Kreditgeschäft ermächtigt haben.
Am Ende schaut sogar Tag für Tag ein neuer Wechselkurs heraus. Wie sie den fortlaufend zustandebringen, wissen die Dolmetscher „der Märkte“ selber nicht so genau – aber keiner wird irre an dem Irrsinn, den er inszenieren hilft.
c)
Die Wechselkurse, so wie die Spekulanten sie in freier Wahrnehmung eines (supra)staatlichen Auftrags und einer (inter)nationalen Mission herstellen, sind jedenfalls nicht der „Gleichgewichtspreis“, zu dem irgendwelche „soliden“ Anfragen und Angebote einander treffen. Sie werden selbst zum Argument für und Element in Anlageentscheidungen verselbständigt und durch diese bestimmt. Doch wie werden diese Entscheidungen getroffen?
Um hier sachgerecht zu verfahren, müssen die Devisenhändler über alles Bescheid wissen; nur zu begreifen brauchen sie nichts, weder die Grundlagen ihres Gewerbes noch die Gründe für nationale Konkurrenzerfolge und Währungskrisen; auch nicht, was sie eigentlich alles ins Verhältnis setzen, praktisch vergleichen und am Ende sogar entscheiden – ein Bewußtsein davon wäre nur hinderlich. Was sie brauchen für ihr Geschäft, das sind „Informationen“ darüber, nämlich Indizien dafür, „wohin der Trend geht“. Und zwar ihr eigener, die „Bewegung an den Börsen“; denn davon hängt für sie alles ab: Setzen sie eher als andere auf die Kursbewegung, die sich durchsetzt, dann machen die Tage und Stunden, die sie ihren Kollegen voraus sind, und die Cent oder Pfennige, die sie denen abnehmen können, ihren Gewinn aus – vorausgesetzt natürlich, der Rest der Mannschaft schließt sich an und bestätigt die Tendenz; sonst gewinnt nämlich der, der entgegengesetzt spekuliert hat. Es gilt also, vor „den Märkten“ die Indizien zu bemerken, denen „die Märkte“ folgen. Und wenn sie nur folgen, weil einer irgendetwas bemerkt hat, dann geht das völlig in Ordnung: Am richtigsten ist die Spekulation, von der die wirksamsten Signale ausgehen.
Natürlich ist das hoffnungslos zirkulär; und das ist den an den Börsen dieser Welt versammelten „Bullen“ und „Bären“ auch kein Geheimnis. Durchaus selbstbewußt bekennen sie sich zur Irrationalität ihres Geschäfts; wissen zwar auf Anfrage zu jeder Kursbewegung einen Grund zu nennen, wissen aber auch, daß schon eine Stunde später dieselbe Bewegung aus einem ganz anderen Grund weitergehen oder aus dem gleichen Grund ein ganz anderer Trend folgen kann; schütteln gelegentlich über sich und ihresgleichen die Köpfe – und sind damit schon wieder dabei, einen neuen Trend zu setzen. Am Ende halten sie sich selber in ihrer Verrücktheit noch für risikofreudig und wagemutig – und täuschen sich damit noch einmal ganz grundsätzlich.
Denn auch wenn in der Frage der Anhaltspunkte für erfolgreiches Spekulieren alles Mögliche eine Bedeutung bekommt – ökonomische „fundamentals“ und politische „Daten“ kunterbunt durcheinander, Kreditbeschlüsse hier, Konkurse dort, eine gescheiterte Gesetzesinitiative in einem wichtigen Land, ein Streik, am Ende der Husten des Präsidenten: Völlig eindeutig ist der Gesichtspunkt, unter dem Spekulanten die Welt nach Indizien durchsuchen, manches wichtig und anderes gar nicht zur Kenntnis nehmen. Ihr Augenmerk gilt allem, was auch nur entfernt mit gelungenem Geschäft und erfolgreicher Gewalt zu tun hat: mit der politischen Durchsetzungsfähigkeit des kapitalistischen Reichtums, über den eine Nation gebietet, und mit den ökonomischen Mitteln einer Staatsmacht, die sich in der Weltpolitik als Zentrum aufspielt. Von wegen „Risiko“ und „anything goes“: Gerade die umtriebigsten Spekulanten sind die ängstlichsten und zugleich hartgesottensten Opportunisten der Macht – genau deswegen treibt es sie ja unaufhörlich um, von einem Trend zum nächsten, damit sie nur ja nicht den Anschluß an die neuesten politisch-ökonomischen Kräfteverschiebungen verpassen, die sie selber dadurch mit herbeiführen helfen.
*
Was leisten die Devisenhändler also für ihr Geld?
Um mit dem Negativen anzufangen: Zum Reichtum dieser Welt tragen sie nichts bei. Mit all ihrer Geschäftigkeit und Wichtigkeit ändern sie nichts an der banalen Wahrheit, daß der kapitalistische Reichtum der Nationen genau so groß ist, wie Ware mit Gewinn verkauft wird, und daß Kreditzeichen diesen Reichtum um kein Stück vergrößern. Die Welt wäre nicht ärmer – an Gebrauchswerten schon gleich nicht, aber auch nicht an wirklichem abstraktem Reichtum –, gäbe es die Welt der Währungsspekulation nicht.
Nur gäbe es – um endlich auf das Positive zu kommen – den gesamten internationalen Kapitalismus nicht ohne diesen Überbau. Die Währungsspekulanten vermitteln den Geschäftsverkehr zwischen den Nationen. Sie setzen den Beschluß der Staaten, sich mit ihrer gesamten nationalen Ökonomie der internationalen Konkurrenz zu stellen, in die Tat um. Sie behandeln die Gelder der souveränen Staaten als Währungen, die echten Wert versprechen, und unterwerfen sie in ihrem Tauschhandel praktisch dem Test, wie gut sie, vergleichsweise, dieses Versprechen einhalten. Auf diese Weise vergleichen sie Nationen nach ihrem kapitalistischen Gesamterfolg in der Welt, bewerkstelligen also die Verschiebung von der weltweiten Konkurrenz der Kapitalisten hin zur Konkurrenz der nationalen Kapitalstandorte. Diese Konkurrenz gestalten sie um zu einem Vergleich der nationalen Kreditpapiere, an die sie den Maßstab der Solidität anlegen. Sie schaffen internationalen Kredit und schaffen ihn dorthin, wo sie darauf setzen, daß der Gang der Dinge ihren „Wagemut“ am ehesten rechtfertigt. So machen sie die absurde Gleichung „Kredit = Vertrauen“ wahr – und verschieben dadurch den Reichtum der Nationen in seiner höchsten, windigsten und zugleich verbindlichsten Form, nämlich in Form der Spekulation auf Schulden, rund um den Globus genau dorthin, wo er nach dem imperialistischen Kräfteverhältnis hingehört. Gerade die abenteuerlichen Techniken ihres Gewerbes tun ihren imperialistischen Dienst.
Eben deswegen ist das Spiel damit auch noch nicht aus. Denn kein souveräner Staat, auch wenn er die Freisetzung dieses Unwesens mit beschlossen hat, unterwirft sich dessen Entscheidungen so ohne weiteres. Nicht einmal die Gewinner mögen dem Urteil privater Geldgeier unterworfen sein. Die Spekulation fordert also die Staatsgewalten heraus, auf sie zu reagieren. Das tut sie nicht einmal bloß objektiv und im Ergebnis, sondern durchaus absichtlich – in spekulativer Absicht, versteht sich: Die Geldmanager provozieren ihre Genossen von der Politik zu machtvollen Taten, auf die sie setzen können. Denn von den politischen Mächten, die mit ihren Übereinkünften das gesamte nationale und internationale Geldwesen stiften, wissen die freischaffenden Geldhändler sich und ihr Gewerbe ihrerseits abhängig.
Und sie bekommen ihre Reaktion. Eine ungemein passende, bislang. Denn sonst wären sie selber gar nicht so groß, so wagemutig und so entscheidend geworden.
Geldpolitik oder: Wie der Staat auf den Währungsvergleich reagiert
a)
Mit ihrer Konvention über internationale Schulden und frei ermittelte Wechselkurse haben die Welthandelsnationen einen globalen Geld- und Kreditmarkt geschaffen. Den akzeptieren sie grundsätzlich als Bedingung ihrer Konkurrenz um kapitalistischen Reichtum und bemühen sich, ihn als Mittel dafür zu nutzen. In der Weise nämlich, daß sie sich an diesem Markt die Mittel ihres nationalen Fortkommens beschaffen. Die prinzipielle Schranke zwischen innerer Kreditschöpfung und Geldforderungen vom und ans Ausland heben sie damit auf: Ihre inneren Schulden sollen international Kredit genießen und als Geldanlage gewürdigt werden; Auslandsschulden sollen der normale Weg sein, sich den Geldreichtum der ganzen Welt – und den heimischen Geldkapitalisten die ganze Welt als Anlagesphäre – zu erschließen. Sie verzichten damit auf die elementare Leistung staatlicher Souveränität, der eigenen Gesellschaft intern ein bedingungslos gültiges Geld zu garantieren. Stattdessen konkurrieren sie mit ihrem Kredit am Weltfinanzmarkt um ihren Anteil am Geld der Welt. Dies – und nicht mehr das einfache Einsammeln fremder Gelder im nationalen Devisenschatz – ist die moderne Methode, mit der Staaten versuchen, sich am Weltmarkt zu bereichern.
Die erste Wirkung dieses eigentümlichen Konkurrenzverfahrens ist die gigantische Aufblähung der internationalen Kreditzirkulation: Eine wachsende Masse von Staatsschulden versorgt das Geschäft der Spekulanten mit Material. Die zweite Wirkung ist eine durchgreifende Sortierung der Nationen. Denn wo die innere Verschuldung der Staaten gleich ein Beitrag zum Weltfinanzmarkt ist, wird der Währungsvergleich zur um so schärferen Kritik an der Freiheit, die die Staaten sich mit ihrer Kreditschöpfung herausnehmen.
Nicht bloß, daß viele Staaten sich eine ehrenrührige Begutachtung ihrer Kreditwürdigkeit und eine Einordnung als Risiko gefallen lassen müssen. Noch viel einschneidender ist der Bescheid, den die Finanzmärkte gewissen Staaten erteilen, wenn diese ihre nationalen Kreditpapiere als zirkulationsfähiges Spekulationsmaterial, ihr Kreditgeld als geschäftsfähige Valuta anerkannt haben wollen. Längst ist es soweit gekommen, daß die Kredithändler praktizieren, was die Welthandelsmächte mit der Einrichtung eines Weltmarkts der konvertiblen Währungen eigentlich ausschließen wollten: Den meisten Währungen erkennen „die Märkte“ jede Eignung zum Weltgeld ab, entziehen ihnen de facto die Anerkennung als Gelder, die – bei richtigem Tauschverhältnis – als Äquivalent für jedes andere Geld in Frage kämen. Sie tun das schlicht dadurch, daß sie mit diesen Geldern nicht handeln und erst gar keinen Kurs dafür aushandeln. Kredit haben die betroffenen Nationen noch – dem Risiko entsprechend teuer, also gegen hohe Zinsen –, allerdings nur im Geld anderer Nationen; also mit der Auflage, mit Deviseneinnahmen für die Schuldenbedienung einzustehen. Für solche Staaten ist der Konkurrenzkampf um Anteile am Reichtum der kapitalistischen Welt gründlich verloren; was sie noch zustandebringen, verschafft ihnen gar keine Geldmittel, sondern erfüllt bloß noch die Funktion, den Gläubigern die Geldqualität ihrer Forderungen zu beweisen. Aus dem Konkurrenzkampf entlassen sind sie damit aber keineswegs. Sogar für ihre Rolle als Opfer des Weltschuldenwesens müssen sie um Positionen an Exportmärkten kämpfen, ihr Volk nach IWF-Ratschlägen auf Nulldiät setzen und ansonsten um möglichst günstige Bedingungen für die notwendigen Umschuldungen nachsuchen.
Die erfolgreicheren Nationen haben keineswegs weniger Schulden als solche „Schuldnerstaaten“, sondern ein Vielfaches davon; aber eben: in eigenem Geld. Mit ihren staatlich verbürgten Schuldscheinen setzen sie anerkannten, von den Finanzmärkten als brauchbares und sicheres Spekulationsobjekt gewürdigten Kredit in die Welt. Das Geld, das sie stiften, ist dasjenige, in dem die internationalen Finanzmärkte selber national „zu Hause“ sind; in ihm sammelt sich an, was die Kapitalisten der ganzen Welt an Wert zustandebringen. Das verschafft diesen Nationen eine Reichtumsbilanz von ungeahnter Qualität: Ihr Kreditgeld ist nicht bloß so gut wie – es ist Weltgeld; der Kredit, den sie sich nehmen, ist geradewegs international gültiger abstrakter Reichtum.[9]
Den „Schuldnerländern“ gegenüber sind diese Staaten daher tatsächlich, bei aller eigenen Verschuldung, Gläubiger; sie machen aus deren Defiziten eigene Guthaben – und zugleich politische Macht: Sie entscheiden über die weltwirtschaftlichen Leistungen, die andere Nationen zu erbringen haben, und über die Bedingungen, unter denen sie diese zustandebringen müssen. Die Gewährung von Krediten – sei es über den IWF, sei es von Regierung zu Regierung, sei es per Wink ans Kreditgewerbe, die Absicherung eines bestimmten Länderrisikos betreffend – lassen sie sich mit politischer Unterwürfigkeit bezahlen. Und Hemmungen, in ärmere Länder hineinzuregieren – selbstverständlich ohne für irgendeine der verheerenden Konsequenzen ihres Hineinwirkens geradezustehen –, kennen sie sowieso nicht: Reichtum schafft Rechte in der zivilisierten Welt.
Und im übrigen haben die wichtigen Staaten sowieso wichtigere Sorgen als die Armut der armen.
b)
Der Weltschuldenmarkt verschafft den führenden kapitalistischen Nationen ihre eigentümliche Überlegenheit, indem er ihre Währungen zum Weltkreditgeld erhebt, dem der Reichtum der ganzen Staatenwelt zur Grundlage dient – was freilich immer noch nicht dasselbe ist wie echtes Weltgeld, nämlich versilberter Warenwert. Deswegen läuft auch bei ihnen das internationale Kreditgeschäft auf den Test hinaus, wie gut die paar guten nationalen Währungen im Vergleich untereinander die anspruchsvolle Funktion des weltweit akzeptierten Kreditzeichens erfüllen. Daß die Spekulation in ihnen zu Hause ist, schließt nicht aus, sondern ein, daß auch gegen sie spekuliert wird. Nicht einmal dagegen gibt es in der Welt der freien Geldmärkte eine letzte Sicherheit, daß sich der circulus vitiosus des Erfolgs in einen Zirkel des sich selbst begründenden und verstärkenden Mißerfolgs umkehrt und eine angesehene Valuta außer Kurs zu setzen droht. Deswegen sehen sich gerade die Staaten, die viel zu verlieren haben, auch ganz besonders herausgefordert, für den dauerhaften und stabilen Erfolg ihres Kreditgelds ihre politische Macht einzusetzen.
So nimmt sich der moderne Staat das Recht, die Ergebnisse des Währungsvergleichs, den er bei „den Märkten“ in Auftrag gegeben hat, nach seinen Interessen zu beurteilen und auf Korrekturen hinzuwirken, wo Fazit und Defizite ihm nicht passen. Er macht deswegen nicht gleich den Auftrag selbst rückgängig, auf den die imperialistische Völkerfamilie sich geeinigt und den sie institutionalisiert hat; höchstens zeitweilig, zur Abwendung einer akuten Notlage, so wie es in den einschlägigen internationalen Vereinbarungen vorgesehen ist, storniert er den freien Geldumtausch und weist die Spekulation mit Dekreten in gewisse Schranken. Grundsätzlich bleibt er dabei, daß genau der in Kredit verwandelte Reichtum, den die internationalen Finanzmärkte zirkulieren lassen, das Lebensmittel seiner Gesellschaft und die Quelle seiner Macht sein soll. Dementsprechend greift er ein: Wo Resultate ihm nicht passen, tritt er den Beweis an, daß „die Märkte“ rein ökonomisch im Unrecht sind; die sollen ihre verkehrte Tendenz revidieren. Und damit es gar nicht erst zu falschen Ergebnissen kommt, wirken alle maßgeblichen kapitalistischen Staaten im Sinne des spekulativen Währungsvergleichs auf dessen Verlauf ein, machen ihm Angebote gemäß seinen Kriterien, um ihn sowohl sachgerecht als auch zu ihren Gunsten – was eben beides dasselbe sein soll – zu steuern: Sie machen Währungspolitik.
So nimmt der Staat mit Stützungskäufen, d.h. dem Aufkauf eigener Währung bzw. dem Rückkauf von auf eigene Währung ausgestellten Schuldtiteln mit Mitteln aus seinem Staatsschatz – für so etwas ist der jetzt gut! –, Einfluß auf die Menge des Materials, das die Spekulation für ihr Spiel mit Angebot und Nachfrage benutzt, um „die Märkte“ zu einer pfleglicheren Behandlung und stabileren Bewertung seines Kreditgelds zu veranlassen. Allerdings ist die Masse der Finanzmittel und -titel, die der Devisenhandel mobilisieren kann, längst viel zu groß, als daß eine nationale Notenbank durch Kauf und Verkauf die Geschäftsbedingungen grundlegend korrigieren könnte; statt die Spekulation auszukaufen, liefe sie eher Gefahr, den Trend zu ermutigen und ihre Reserven zu „verheizen“. Stützungskäufe zugunsten der eigenen Währung wirken daher mehr als Signal; und als solches wirken sie nur allzu leicht im verkehrten Sinn, nämlich als Zeichen der Schwäche, die das Leben an der Börse mit verschärfter Baisse-Spekulation bestraft. Ein besserer Eindruck ist der Geschäftswelt durch hohe Zinsen zu machen, diejenigen nämlich, die der Staat für seine Schulden zahlt und in seiner Eigenschaft als Zentralbank für Kredite in eigener Währung nimmt. Denn erstens sind Geldkapitalisten noch allemal am wirksamsten mit Geldgeschenken zu beeinflussen. Zweitens gelten hohe Preise fürs Geld als Ausweis der Sorge, die ein Staat der Wertbeständigkeit seiner Währung widmet. Finanzmanager beherrschen allerdings genausogut die umgekehrte Lesart: Ein Staat, der hohe Zinsen zahlt, belastet sein Budget und verschlechtert seine Schuldenbilanz; außerdem hat er es offenbar nötig, Geldgeber zu bestechen, was auch nicht für seine Schulden spricht; und wenn er seiner Wirtschaft für Kredite viel berechnet, dann besteht offenbar Grund zur Sorge um die Währungsstabilität. Weil die Finanzpolitiker diese Lesart kennen, versuchen sie daher bisweilen, und manchmal sogar mit Erfolg, mit Zinssenkungen ein Signal für nationales Selbstvertrauen zu setzen und außerdem für einen neuen Aufschwung, den – nach dem unverwüstlichen Aberglauben der Volkswirtschaftslehre – eine Verbilligung des Kredits unausweichlich nach sich zieht. Ebenso unabwendbar nehmen dann allerdings, nach demselben Katechismus, die Inflationsängste zu, die sich am besten durch eine Sparpolitik bekämpfen lassen. Darunter ist keine Sparsamkeit in dem Sinne zu verstehen, daß die Kreditaufnahme storniert und ein namhafter Posten alter Schulden beglichen würde. Vielmehr geht es um ein kunstvolles Ensemble wirklicher und angeblicher Einschnitte in „unproduktive“ Staatsausgaben – Gelder also, von denen bloß Leute leben –, das die Zunahme staatlicher Verschuldung begleitet; dazu soll es nämlich die Versicherung beisteuern, daß der Kredit der Nation trotz aller Aufblähung verläßlich bleibt.[10] Ein Signal mit derselben Botschaft geht von dem organisatorischen Kunstgriff aus, die Staatsfunktion der Kreditgeldschöpfung von der der Kreditaufnahme institutionell zu trennen und autonome Währungshüter an die Spitze der Zentralbank zu setzen. Daß denen ihre Autonomie und professionelle Hingabe an das Ideal der Währungsstabilität geglaubt wird, ist auch schon das Wichtigste an ihrer Zins-, Geldmengen-, Wechselkurs- usw. -Politik, die für sich genommen allemal vieldeutig bleibt.
Mit ihren währungspolitischen Manipulationen präsentieren sich die Staaten einerseits betroffen von den Umtrieben auf den Finanzmärkten, die ihnen die Bilanz ihrer welthändlerischen Anstrengungen versauen. Im Stand ihrer Währungen registrieren sie, in welchem Maß sich die Internationalisierung des Geschäfts für sie gelohnt hat. Und sie versuchen auf die Entscheidungen der Märkte andererseits einzuwirken, weil sie den Wechselkurs als Instrument für die Fortsetzung ihres auswärtigen Handels betrachten und brauchbar erhalten wollen. Insofern stellen sich die Hüter des nationalen Kredits mit ihrer Kurspflege durchaus kritisch zu den Befunden des finanzkapitalistischen Gewerbes, allerdings ohne dessen Kompetenzen zu beschränken oder außer Kraft zu setzen. Sie wollen dessen berechnenden Umgang mit dem Kredit in allen Nationalfarben ausnutzen und in die ihnen genehme Richtung lenken, die ihnen erwachsenen Nachteile rückgängig machen – lassen –; und ihre Maßnahmen verletzen dabei, ob ausdrücklich darauf hin kalkuliert oder nicht, nur allzuoft die Interessen der übrigen Währungshüter.
Dennoch sind die währungspolitischen Praktiken der maßgeblichen Welthandelsmächte nicht in Konkurrenzveranstaltungen ausgeartet, die mit der Selbstbehauptung des einen Nationalkredits den Ruin eines anderen bezweckt hätten. Selbst in den zahlreichen Fällen, in denen die Bilanzen, die Entscheidungen der Geldmärkte und das Urteil der wenigen Gläubigernationen eindeutig auf „Zahlungsunfähigkeit“ lauteten, wurde dieses Urteil nicht vollstreckt. Vielmehr ist die Währungspolitik, die sich auf die Tauglichkeit des jeweils eigenen Kredits richtet, um die kooperative internationale Betreuung sämtlicher Bilanzen ergänzt worden. Das Regime des IWF, das die gedeihliche Fortführung des Welthandels mit Partnern organisiert, die sich eine chronische Geldnot eingehandelt haben, was sich in der ebenso chronischen Entwertung ihres Kreditgelds niederschlägt, wurde um ein ständiges Management der weltweiten Schuldenberge erweitert. Neue Institutionen wurden ins Leben gerufen, um durch gemeinsamen Beschluß alte wie neue Schulden als Guthaben zu erhalten und anzuerkennen, obwohl ihre Uneinlösbarkeit für alle Beteiligten feststeht. Die famosen „G7“ haben sich zuletzt Jahr um Jahr mit Übereinkünften betreffs „Weltschuldenkrise“ hervorgetan; und ein Europäisches Währungssystem befaßt sich seit geraumer Zeit nicht mehr mit stabilen Kursen zwischen den Ländern des Gemeinsamen Marktes, sondern mit der fragwürdigen Brauchbarkeit manchen Nationalkredits…
Die Leistungen dieser zwei komplementären Abteilungen von Währungspolitik sind allerdings nur zum Teil bekannt. Zur Kenntnis genommen wird nur allzu gern der enorme Aufschwung, den der Welthandel und das wirtschaftliche Wachstum in der ersten Welt erzielt haben. Und soviel ist daran auch richtig: Durch die Beschränkung der Währungspflege auf Zins- und andere „Signale“, die nicht nur die Funktion „der Märkte“ respektiert, sondern auch die unmittelbare Konfrontation mit anderen Währungshütern unterläßt – Devisenverkehrskontrollen, Zwangskurse u.ä. sollen ja schon vorgekommen sein im Bemühen um „Stabilität“ –, ist der internationale Handel entschränkt worden; die Geschäftsleute aller Herren Länder haben keine staatliche Behinderung zu gewärtigen und nur mit den Tücken des Wechselkurses zu kalkulieren. Und durch die supranationale Anerkennung von inter-nationalen Schulden anstelle von Zahlungen sind Handelsbeziehungen fortgesetzt und ausgebaut worden, die ohne die Beschlüsse zur Schaffung weltweiter „Liquidität“ gar nicht erst zustandegekommen wären.
Was weniger gewürdigt wird – obwohl es die Akteure des Weltmarkts ziemlich beschäftigt –, ist die Verfassung des „Weltwährungssystems“ und der Nationalkredite, die, als Währungen verglichen, nach wie vor den Reichtum der Nationen vorstellen.
- Die Staaten, die im Rückblick auf 50 Jahre Weltmarkt vom großen Rest der Welt als „Industrienationen“ und „Weltwirtschaftsmächte“ respektiert werden, verfügen über gutes Geld. Die Rede ist von den drei Weltwährungen, die an jeder Stelle des Globus jede Geldfunktion übernehmen können: Dollar, Yen und die europäische „Ankerwährung“ DM. Sie sind entweder unmittelbar austauschbar gegen alle Sorten stofflichen Reichtums, oder sie vermögen über die Verwandlung in minderes lokales Geld alles zu leisten, was das kapitalistische Herz begehrt. Sie taugen zu allen Formen der Kapitalanlage, von der Einrichtung einer Fabrik übers zinsträchtige Verleihen bis zum Erwerb von Sicherheiten, derer die Privatmacht des Geldes stets habhaft werden will.
- Seiner Substanz nach ist dieses gute Geld ein großer Haufen Kredit. Er setzt sich zusammen aus Schulden, die von den Herren Europas, Amerikas und Japans in Umlauf gebracht worden sind; weiterhin um Schulden, die diese Mächte im Verkehr untereinander als Zahlung und Kapital angenommen haben und den Ihren gleichstellen; und um Schulden, die anstelle von Zahlungen der übrigen Nationen in den Konten der Banken sowie im Staatshaushalt der Weltwirtschaftsmächte verbucht sind – und zwar als Guthaben.
- Der Gebrauch dieses guten Geldes ist Sache all derer, die es besitzen. Sie verlassen sich auf die Garantie der Staatsgewalten, nach denen das Geld bezeichnet ist. Die Staatsgewalten verlassen sich umgekehrt darauf, daß von ihrem Geld reger Gebrauch gemacht wird, daß es auf sämtlichen Märkten zum Einsatz kommt, seine Fähigkeit zur Vermehrung unter Beweis stellt und darüber die Geldgleichheit des nationalen Kredits bestätigt. Das gibt den Währungshütern die Freiheit, auch selbst von diesem Geld Gebrauch zu machen, ihre Schulden zu vermehren und darüber an Zahlungsfähigkeit zu gewinnen. In dem Maße, wie ihre Gelder als Geschäftsmittel und -objekt taugen, erkennen sie ihre Währungen untereinander an. Die Ermittlung des rechten Maßes überlassen sie „den Märkten“. Die Entscheidungen des international tätigen Finanzkapitals, der Zuspruch, den es auf die drei Weltwährungen verteilt, liefern nicht nur die Bestätigung, sondern auch die Masse der zum Weltgeld tauglichen Währungen. Das produktive Kapital erledigt den Rest der Bilanz; trotz ihres geringen zahlenmäßigen Gewichts im Vergleich zum fiktiven Kapital sind seine Dienste aber nicht zu unterschätzen. Es sorgt erstens, wie der Name schon sagt, für die Produktion, zweitens je nach dem Verlauf der Handelsströme für die Übertragung von Reichtum zwischen den Nationen; also nicht bloß für Kurskorrekturen, denen es entscheidende Impulse verleiht. Umgekehrt jedoch sind die Verdienste der einen Nation gegen die andere allemal eine Frage des Währungsvergleichs, der als Instrument des auswärtigen Handels ebenso fungiert wie als Maßstab des privaten und nationalen Geschäftserfolgs.
c)
Die Nationen, die maßgeblich den Weltmarkt hergestellt und das ihm entsprechende Währungssystem unter Anleitung der USA geschaffen haben, verdanken den Erfolg, den sie inzwischen als Wirtschaftsblöcke verzeichnen, natürlich nicht dem Kunstwerk, das ihnen da gelungen ist. Die Konkurrenz um Kredit, um den aparten Status ihrer Schulden als Geld, haben sie für sich entscheiden können, weil unter ihrer Regie, auf ihrem Boden und auf Grundlage ihres Geldes die größten Massen von Kapital tätig wurden; weil dieses Kapital die natürlichen und produzierten Reichtümer der andern Nationen rentabel benutzt hat; weil das Finanzkapital, bevor es in den heutigen Genuß der Freiheit des Geldverschiebens gekommen ist, erst einmal der sicheren Notwendigkeit gefolgt ist, die sich aus den eindeutigen Unterschieden, der Hierarchie der Nationen ganz von selbst ergab. Und bei allem Respekt, den der Irrsinn der Spekulation mit ihren widerstreitenden Beweggründen und zirkulären Kalkulationen verdient – im Grunde hat die Finanzwelt immer ganz brav ihr Vertrauen für die Nationen reserviert, an deren Geld am meisten zu verdienen ist, weil in ihnen und durch sie am meisten verdient wird. Das ist auch kein Wunder; denn die Spekulation auf künftige Bilanzen nimmt eben doch Maß an den vorgefundenen.
Auch für die Regierungen und Notenbanken der Weltwirtschaftsmächte hat sich mit der weltweiten Blüte des fiktiven Kapitals eines nicht geändert: Das Vertrauen der Märkte, die die Anerkennung des eigenen Kredits vollziehen und im Verhältnis zu anderen Nationen gewichten, erwerben sie sich durch die Leistungen ihrer Wirtschaft. Dennoch sieht die Sache heute ein bißchen anders aus. Das Zugriffsmittel auf jede erdenkliche Art Geschäft, daheim wie auswärts, ist – da haben die Konzessionen an das Finanzkapital und die Konventionen des Währungssystems ihre Wirkung getan – der Kredit, der sich auf den Märkten und seitens der anderen Nationen seine Gültigkeit erhält. Alles, was sich die reichen Nationen leisten können, beruht darauf, daß sie jedem eine lohnende Verwendung ihres Geldes garantieren, also dafür sorgen, daß der Besitz ihrer Kreditzettel für In- und Ausländer, eben auf dem ganzen Weltmarkt, gewinnträchtig ist und bleibt. Jede der drei soliden Währungen muß den Vergleich mit den beiden anderen bestehen und sich als die bessere Kapitalanlage bewähren. Solange die Finanzmärkte die Lizenz haben, diesen Vergleich vorzunehmen, konkurrieren auch die drei Weltwährungen um die Attraktivität ihres Kredits, und zwar auf Kosten der anderen. Die Abwicklung der internationalen Konkurrenz vermittels eines ebenso internationalen Geldmarkts, die schon manche Währung ihre globale Brauchbarkeit gekostet hat, weicht keiner friedlichen Koexistenz, nur weil es bloß noch drei sind.
Nicht zu übersehen ist dabei, daß für das Gewinnmachen hier im Bereich des Finanzkapitals nur zwei Quellen zu Gebote stehen: die Enteignung anderer – durch Entwertung – und die Schöpfung neuen Kredits. Das geht, hat aber Konsequenzen für den internationalen Vergleich. Der ist ja nicht von der Tagesordnung gestrichen, sondern steht von neuem an. Allerdings mit reduziertem Geldbesitz auf der einen Seite: mit entwerteter Valuta, die in die eben favorisierte Währung gehen könnte; mit famosen Anlagen auf der anderen Seite, deren rechtmäßig verbürgten Gewinnanspruch außer dem Währungshüter am Ende keine andere Adresse mehr einlöst. Daher seit geraumer Zeit die Klage von Nationalbanken, der Zuspruch, den ihr Geld genießt, sei „bloß spekulativ“. Dafür steht auch der Katzenjammer der amerikanischen Notenbank angesichts der Kosten, welche die Hochzinspolitik unter Reagan heute nach sich zieht. Und die Japaner verzeichnen bei aller Attraktivität des Yen schlechte Bilanzen. So sehr die Weltwährungsnationen darauf erpicht sind, von den Finanzmärkten mit Nachfrage bedacht zu werden, so vertraut ist ihnen eben auch der Unterschied zwischen einer „gesunden Nachfrage“ nach ihrem Geld und „bloßer Spekulation“, welche ihre Verschuldung erhöht, ohne zu ihren Einnahmen etwas beizutragen. Sie gewahren ein Anwachsen ihres Kredits ohne Wachstum, dafür mit dem Risiko der Inflation, die sich aufgrund der Erhöhung dreier Geldmengen einstellt; einer Inflation, die Geschäfte im Innern ebenso unterbindet wie die mit dem Ausland – die Rede ist von „wirklichen“ Geschäften.
In solchen und anderen Befunden würdigen die potentesten Währungshüter dann doch noch die prekären Leistungen ihres Weltwährungssystems. In dem wirtschaftlichen Sachverstand des Jahrhunderts eigenen Fassungen bemerken sie,
- daß die Kopie des nationalen Kreditwesens im auswärtigen Handel dasselbe leistet wie das Original. Der Ersatz von Zahlungen durch Schulden genehmigt auch international die Illusion, daß die Produktion am Markt keine Schranke hat. Er gestattet denen, die für den Markt produzieren, die Inanspruchnahme der durch Kredit geschaffenen Zahlungsfähigkeit. Der Kredit erlaubt eine enorme Vergrößerung der Kapitalmasse, die in der Konkurrenz zum Einsatz kommt. Unvermeidlich ist deswegen auch im Welthandel die regelmäßige Auskunft des Marktes, daß nicht genug Kaufkraft vorhanden ist, um den gigantischen Investitionen ihren Gewinn zu bezahlen. Dafür hat eine Anhäufung einer enormen Summe von Eigentumstiteln stattgefunden, deren Inhaber mit nichts anderem befaßt sind als mit der Suche nach Adressen, die die beste Verzinsung gewähren. Diese Zinsen müssen bezahlt werden; sonst ist nämlich nicht nur der eine oder andere Kredit, sondern das ganze System im Eimer.
- Insofern bietet die Ausdehnung des Kapitals auf den ganzen Globus nichts Neues, außer eben in der Größenordnung.
- Eine nicht unerhebliche Modifikation der Konjunkturen des Geschäfts ergibt sich allerdings daraus, daß der Kredit, und zwar gleich mehrfach, als der Inbegriff nationalen Reichtums daherkommt. Er präsentiert sich als Nationaluniform von Geld, ist also nicht nur Mittel des kapitalistischen Geschäfts, sondern die Produktionsbedingung ganzer Nationen. Mit seiner Qualität und Haltbarkeit steht und fällt die nationale Bilanz. Als Instrument des Geschäftslebens, das auf dem Territorium eines Staates stattfindet, versagt er seinen Dienst, sobald er international seine Anerkennung einbüßt. Wieviel in einer Nation und an ihr, aber auch durch sie an anderen verdient werden kann, hängt davon ab, wie er sich im Währungsvergleich bewährt. Im nationalen Geld, in seiner Stärke bzw. Schwäche, ist die Brauchbarkeit und die Leistung der „Anlagesphäre Nation“ zusammengefaßt. Was ein „Standort“, ein staatlich umhegtes Territorium mit seinem toten und lebenden Inventar taugt, pflegt in der schönen Welt der internationalen Verflechtung und Abhängigkeit zu einer ebenso schlichten wie abstrakten Größe zusammengerechnet zu werden: relativer Wert und Masse des Geldes.
Daß diese Größe von den Finanzmärkten ermittelt, quasi hergestellt wird, ist erstens so geregelt und zweitens jeder Regierung recht, solange sie Erfolge verbucht. Sie verfügt über den Beweis, ihre Nation zu der Leistung hinregiert zu haben, auf die es ankommt. Fällt die Bilanz dagegen schlecht aus, stellt gar der Handel mit Kredit Einheit und Anzahl des nationalen Geldes in Frage, werden selbst Lenker von Weltwirtschaftsmächten kritisch. Wenn das loanable capital seine Dienste für die Nation versagt, dann hat deren Inventar den Erfordernissen des Weltmarkts nicht genügt. Wenn die Realisierung einer erfolgreichen nationalen Bilanz unterbleibt, dann erinnert die politische Führung ihr Volk, die Wirtschaft und die anderen, jeden auf seine Weise, nachdrücklich daran, wofür sie da sind. Sie sind zur Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt verpflichtet, weil der Reichtum ihrer Nation in nichts anderem besteht als im Geld, das sie an der ganzen Welt verdient. Der Geschäftswelt leuchtet das ein, weil sich ihr privater Reichtum längst in dem Maße erhält und vermehrt, wie sie am internationalen Handel gewinnen. Die anderen müssen lernen, daß ihre Arbeitsplätze doch nicht vom Weltmarkt kommen, sondern umgekehrt in Zahl und Ausstattung für den Weltmarkt passend gemacht werden.
Wenn die nationalen Bilanzen nicht stimmen, wenn auf der einen Seite der Kredit so reichlich vorhanden ist, daß er eher den Charakter von Schulden annimmt statt Geld darstellt, weil auf der anderen Seite das Wirtschaftswachstum nachläßt, welches sich aus gewinnbringend verkauften Produktionen errechnet, dann geht es merkwürdig zu. Das, was das Inventar der Welthandelsnation immer ist: ein Kapitalstandort, wird höchst programmatisch gesichert und erhalten. Und das ist alles andere als konservativ.
d)
„Standortpolitik“ ist ein neuer Name für das, was Nationen immer dann tun, wenn der auswärtige Handel samt den ihn begleitenden Geldbewegungen der Nation kein Geld mehr einspielt. Wenn eine Plethora von Geldkapital unterwegs ist, ohne die Außenhandelsbilanzen zu befördern, weil weniger verkauft und produziert werden kann. Weit davon entfernt, einzusehen, daß die Bedingungen der Produktion und der Realisierung von Gewinn nun einmal nicht zusammenfallen, daß sie aktuell sogar gründlich auseinandergetreten sind, besteht die Politik darauf, rentable Geschäfte wieder herbeizuregieren. Nicht, was der Markt nicht hergibt, ist für sie interessant, sondern daß er es uns
nicht zuteil werden läßt. Standortpolitik ist der Entschluß, die Konkurrenten – und das sind andere Nationen, die in gemütlicheren Zeiten auch Partner heißen – zu verdrängen. Das probate Mittel besteht in der Mobilisierung der Quellen des nationalen Reichtums. Das sind nicht „die Produktivkräfte“, die sich in der Nation finden, sondern selbige in Gestalt von Kapital und Arbeit. Deswegen sieht die Initiative so aus:
- „Unsere“ Firmen müssen produktiver, also rentabler werden. Erstens als bisher, zweitens als die im Ausland. Dann ist ihre Ware im allfälligen Preisvergleich denen der anderen überlegen, sie wird verkauft, bringt den Betrieben Profit und der nationalen Bilanz ein Plus. Der zugrundeliegende Standpunkt ist der einer Exportnation, die ihre Waren weltweit auf Kosten anderer Exportnationen absetzen will. Die erforderlichen Maßnahmen fallen weitgehend in das angewandte ABC der Betriebsführung, das vom Mittelstand bis zum vertikalen Trust beherrscht wird. In dem einen oder anderen Fall sind allerdings staatliche Hilfen angesagt, damit Gesundschrumpfungen, Fusionen und Kapitalaufstockungen nicht am Geld scheitern. Die Senkung der Kosten gebietet das Ziel eines rentablen Marktpreises, so daß die Klage über ein zu teures Arbeitsvolk sowie die Behebung dieses Mangels zur nationalen Kampagne werden. Die erforderliche Zahlungsfähigkeit wächst dem Projekt daheim wie auswärts zu, weil die Konkurrenten sie abtreten.
- Heimische Firmen müssen ins Ausland, also überall hin, wo exportierte Ware der der Konkurrenz unterlegen ist. Auch dorthin, wo sich die Kosten günstiger gestalten als am alten Standort. Die heikle Frage, ob das Verlassen des heimatlichen Territoriums nicht mit einem Verlust an nationalen Einkünften verbunden sei, wird gelöst: Der nationalen Sache wird nicht nur lokal-patriotisch gedient, sondern auch geld-patriotisch – die Hausbank des Konzerns nimmt auch Devisen. Der zugrundeliegende Standpunkt ist der der Kompensierung von Standortvorteilen, die anderen Märkte sichern, die „uns“ spätestens aufgrund des Ortswechsels zustehen.
- Auswärtige Investoren müssen sich „bei uns“ engagieren. Das erleichtert die Herstellung der zur Konkurrenzfähigkeit nötigen Kapitalgröße, erspart staatliche Zuwendungen und fördert – wenn die geldpatriotischen Technika richtig geregelt sind – die Nachfrage nach „unserer“ Währung.
- Wo die Besichtigung des Weltmarkts zu der traurigen Diagnose führt, daß andere Nationen in bezug auf zukunftsträchtige Produkte und hinsichtlich der Kapitalgröße hoffnungslos überlegen sind, ist noch lange nichts entschieden. Hoffnung stiftet da ein mit Staatskredit geschmiedeter nationaler Konzern, der natürlich nie als Staatsbetrieb, sondern 100%ig privatisiert der Konkurrenz gewachsen ist.
- Nicht zu verachten ist die Ausdehnung der Zuständigkeit auf andere Territorien. Freilich ist das nur in seltenen Glücksfällen der Geschichte zu haben, die der Nation ein zusätzliches Inventar samt Manövriermasse in die Hände spielen. Und selbst in diesen Fällen stellt sich manche Widrigkeit ein. Fällige Erschließungskosten strapazieren erst einmal den Nationalkredit, bevor sie sich als Beitrag bemerkbar machen. Da trifft es sich gut, daß sich internationale Schranken des nationalen Gelderwerbs auch anders niederreißen lassen: durch Bündnisse und mit Geld – Europa.
Man sieht: Nationen, die sich ausgerechnet das Kapital zu ihrem Lebensmittel erkoren haben, taugen zu dem, was man Völkergemeinschaft nennt, nicht recht. Besagtes Lebensmittel ist nicht zu haben und zu kultivieren, ohne daß es sich die politischen Herren aller Länder, der wichtigsten zumal, streitig machen. Die Verwendung der eigenen Gesellschaft wie des Auslands hat keinen anderen Inhalt als das ihrer ökonomischen Grundrechnungsart entsprechende Staatsziel: den Nationalismus des Geldes. Die Sicherung und Mehrung dieses Stoffes, die den designierten Opfern im Inland als Sparpolitik verdolmetscht, die zu allem Überfluß auch noch als Sachzwang verkauft wird, schließt den polemischen Umgang mit dem Ausland ein. Krisenbewältigung ist stets ein kräftiges Dementi der internationalistischen Legenden, die aus der Abhängigkeit der Staaten voneinander und von der Weltwirtschaft insgesamt ableiten, daß es aufs Miteinander und auf die gemeinsamen Werte ankommt. Der Wert, um den es im Welthandel geht, ist Gegenstand der Konkurrenz – weswegen es auch verfehlt ist, sich über andere „Widersprüche des Imperialismus“ den Kopf zu zerbrechen.
Die ganze Not, die die Weltwirtschaftsmächte sich zu beheben anschicken, ist eben die, daß in der Krise ihre Rechnungen nicht aufgegangen sind. Daß der auswärtige Handel die als Gewohnheitsrecht genossene Übertragung von Reichtum in ihre Kassen nicht bewerkstelligt hat, was sie an der relativen und zeitweiligen Unbrauchbarkeit ihres Kreditgeldes bemerken. Wenn sie diesen Mißstand nun beheben, kommen sie zur Sache. Ihr Recht auf den Geldreichtum der inzwischen zur Gänze freien Welt suchen sie durchzusetzen, und aus dem unschuldigen Instrumentarium der Marktwirtschaft werden banale Waffen der Konkurrenz.
Die erste Waffe ist der Kredit, den sie haben. Weit davon entfernt, sich einzuschränken und zu sparen, finanzieren sie auf sämtlichen Märkten Geschäfte, die ausdrücklich auf Kosten des Auslands gehen. Das Interesse, ihren gefährdeten Kredit zu „untermauern“, solide zu machen, verfolgen sie mit der Vermehrung ihrer Schulden und dem Anspruch, die anderen dafür geradestehen zu lassen. Darin eingeschlossen ist die Verarmung der Partnernationen, die Entwertung von deren Kredit als Folge davon, daß ihnen Verdienstquellen abhanden kommen. Vorgesehen sind die Welthandelspartner in der Rolle von Zahlern und Schuldnern.
Die zweite Waffe ist die eigene Nation – in ihrer Eigenschaft als Geldquelle. Das durch eine schon ältere staatliche Fügung tätige Privateigentum darf seinen Beruf, das Wachstum, im nationalen Auftrag und der Notlage des Staates entsprechend ausüben. Der Rest wird unter neue Arbeits- und Lebensbedingungen gestellt sowie mit der nationalistischen Botschaft versorgt, daß sich sein Unterhalt nur lohnt, wenn er dem Kapital und dem Staat Gewinne aus dem Weltmarkt verschafft. Deutsche, amerikanische und japanische Arbeitsplätze verhalten sich deswegen schon seit längerer Zeit wie Entweder und Oder.
Der Einsatz dieser Waffen zwischen den verbliebenen drei Weltgeldbesitzern hat freilich Folgen. Er schädigt die Reichtumsquellen der anderen Nation und beschränkt damit den Nutzen, der ihrem Kredit zugedacht ist.
Immerhin steht jedes dieser drei Vorzugsgelder nicht nur als Plus in den Büchern der jeweiligen Garantiemacht und ihrer Bürger; ihre anerkannte Weltgeldgleichheit bot ja gerade „den Märkten“ und allen, die sich an ihnen mit haltbarem Geld versorgten, die Gewähr, mit keinem von ihnen einen prinzipiellen Fehlgriff zu tun und mit der Streuung ihres Besitzes auf sie die Sicherheit zu erlangen, die man sich wünscht. Die Verluste aus der Entwertung eines dieser Kredite lassen sich garantiert nicht lokalisieren.
Ebensowenig die Einbuße an Zahlungsfähigkeit, die die betroffene Nation und ihre Geschäftswelt erleiden. Denn an der Ausnützung ihrer Kaufkraft, an der Geldwertstabilität der eingegangenen Zahlungen hängt das Markteroberungsprogramm der Standortpolitik allemal. Die Übertragung von Reichtum durch Export hatte schließlich bislang ihre Gewähr in der Solidität des nationalen Zahlungsmittels. Wenn die entfällt, kommt in den auswärtigen Handel ein Maß an Spekulation, das ihn zum Risiko macht und nicht, wie die jetzigen Warentermingeschäfte, zu einem sicheren Feld des Gewinns.
Daß die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte jede von ihnen hergestellte Kursveränderung nicht nur registriert, sondern prompt mit den branchenüblichen Einschätzungen und Hochrechnungen versieht, relativiert die Früchte der Sieger in der Konkurrenz ebenfalls. Nicht nur auf die Entwertung eines der drei Weltgelder wird dann spekuliert, sondern auch auf die wirklichen und vermeintlichen Wirkungen, welche deren Kursschwankungen auf das Geschäftsleben aller potenten Nationen haben.
Kurz: Die dieser Tage eingeschlagene Strategie, die sich auf die Unanfechtbarkeit eines der drei großen Weltgelder richtet, untergräbt das schöne Weltwährungssystem, weil nicht nur die unterlegene Nation betroffen ist. Daß mit einem erheblichen Aufwand an neuen Staats- und anderen Schulden eine ebenso erhebliche Menge von Produktivkräften aufgestellt wird und Produkte vom Feinsten zum Verkauf anstehen, hilft dabei kaum etwas. Für den Gebrauchswert ist die ganze Veranstaltung ja ebensowenig gedacht wie für den Genuß der Völker.
Dieser Erfolg ist abzusehen.
Zum aktuellen Stand der internationalen Konkurrenz ums Geld der Welt
Nicht zu überhören ist im Sommer und Herbst 94 – in der Einleitung war davon schon die Rede –, daß die Akteure des Geldhandels, die Währungshüter, die Staatsschuldenmacher, dazu die fachkundigen Dolmetscher des Börsengeschehens, von gewissen Zweifeln geplagt werden, die das Gelingen ihrer gemeinsamen Veranstaltung betreffen. Das ist kein Wunder. Denn mit ihren Entscheidungen, die nicht bloß ansehnliche Geldsummen bewegen, sondern den Kurswert von Kreditpapieren und Kreditzeichen dazu, und die damit noch ansehnlichere Summen entstehen, derzeit aber vor allem in Nichts zergehen lassen, setzen sie ihrem Laden seit einiger Zeit ganz ordentlich zu. Den Ergebnissen ihres Wirkens stehen sie oft genug ratlos gegenüber, was sie aber nicht an neuen entschlossenen Taten hindert. Die richten sich in den letzten Monaten vor allem gegen eine der drei großen Weltwährungen, nämlich die amerikanische; aber dabei bleibt es nicht. Mittlerweile untergraben sie die Funktionsbedingungen ihres ganzen schönen Systems.
Aber – eins nach dem andern.
a) „Die Märkte“ lassen den Dollar fallen
Maßgebliche Marktteilnehmer haben einen „Trend aus dem Dollar“ befürchtet und ihn damit eingeleitet. Kaum war er da, wußte schon der ganze Rest, daß er längst fällig gewesen war. Immer auf der Suche nach dem verläßlichsten Geld, spekuliert der Devisenhandel über ein halbes Jahr hinweg gegen das amerikanische und findet sich erst gut bedient, wenn 1 Dollar weniger als 100 Yen und gut 1,50 DM kostet. Alle guten Gründe dafür faßt ein professioneller Beobachter so zusammen:
„Mit steigenden Unternehmensgewinnen und niedrigen Inflationsraten bei kräftigem Wirtschaftswachstum sahen die USA wie das Traumland für Anleger aus. Nur: Die US-Haushaltslage ist immer noch prekär; die Handelsbilanz gleitet immer tiefer in die roten Zahlen, und die Clinton-Administration hat offenbar keine anderen außenwirtschaftlichen Konzepte, als den Dollar nach unten zu reden und die Japaner zu Handelsdirigismus zu zwingen… Die USA-Regierung muß trotz des Konjunkturaufschwungs weiter ein bedeutendes Budgetdefizit finanzieren. Ohne Hilfe des Auslands geht es nicht, zumal nicht ohne Japan. Statt indessen die Japaner zu hofieren,“ – wer weiß, was die Märkte dann gesagt hätten?! – „setzt die Clinton-Administration sie unter Dauerdruck… Für eine Regierung, deren Reformvorhaben feststecken und deren Glaubwürdigkeit tagtäglich an allen Fronten angezweifelt wird, leistet sich die Clinton-Administration den Luxus, die außenwirtschaftliche Komponente ihrer Politik völlig zu vernachlässigen. Als diese Schwäche immer deutlicher wurde, kamen die Märkte zu dem Schluß, daß auch höhere Zinsen noch nicht hoch genug sind.“ (Handelsblatt vom 23.6.94)
In einem Aufwasch sind hier sämtliche Zwars und Abers beieinander, die einem Spekulanten so durch den Kopf gehen, wenn er sich traut, einer Tendenz gegen die umfänglichste Weltwährung, das Geld der letzten Supermacht dieser Erde, Recht zu geben. Auffällig daran ist, daß alle Argumente sich genausogut andersherum hindrehen ließen: Dann wäre Clinton zwar mit ein paar international völlig uninteressanten Reformen gescheitert, aber hohe Zinsen hätten den Dollar attraktiv gemacht – wie vor 12 Jahren, als Vor-Vorgänger Reagan mit einer Hochzinspolitik Erfolg hatte –; zwar hätten die USA – wie damals – enorme Defizite im Staatshaushalt und in der Außenhandelsbilanz, aber eine bombige Binnenkonjunktur… Warum die andere, die negative Lesart?
Das eine wollen „die Märkte“ auf alle Fälle begriffen haben: Die Diskrepanz in Amerika zwischen Konjunktur einerseits, Haushalts- und Außenhandelsbilanz andererseits spricht gegen Amerika. Zwar wird in den USA – wieder – Geld verdient; weil das aber an den beiden Defiziten nichts ändert, die den Wert des verdienten Geldes insgesamt betreffen, muß man zu dem Urteil kommen, daß die USA darüber überhaupt nicht reicher werden. Dort Geld zu verdienen, lohnt sich nicht; die Akkumulation, die der Boom allenfalls zuwege bringt, ist nichts wert, hat Masse und Schlagkraft des amerikanischen Kapitals nicht vergrößert. Statt dem Geld der Nation seinen Wert zu sichern, wird der innere Erfolg durch den Verfall des Geldes aufgefressen. Seine eigene Objektivität gibt sich dieses Urteil in seiner praktischen Wirkung: Die Abwertung des Dollar entwertet Amerikas Reichtum im Weltvergleich. Die Spekulation gegen den Dollar setzt die defizitären Bilanzen des Landes gegen alle anderen Gesichtspunkte als die maßgeblichen Größen ins Recht; sie stellt daran den Konkurrenzvergleich mit den anderen großen Wirtschaftsmächten an und entscheidet ihn.
Warum dieser Vergleich so und nicht anders entschieden gehört – immerhin bleibt ja nicht verborgen, daß die USA Japan unter „Dauerdruck“ setzen und nicht umgekehrt –, dafür haben „die Märkte“ eine weitere Einsicht zu bieten: Die glückliche Symbiose Amerikas mit Japan – die im Export nach USA verdienten Dollar fließen wieder in US-Staatsanleihen – bedeutet Abhängigkeit, und diese Abhängigkeit spricht gegen die USA; nicht grundsätzlich, aber derzeit, weil die US-Regierung kein Konzept hat, um dieses Verhältnis ihrerseits souverän zu handhaben. Die disparatesten Beobachtungen stimmen auf einmal überein in der Diagnose, daß es der amerikanischen Staatsmacht an der Fähigkeit fehlt, das, was sie sich vorgenommen hat, auch mit Erfolg zuende zu bringen. „Die Märkte“ sind die letzten, denen es um Clintons gescheiterte Gesundheitsreform leid täte; aber als Beleg fürs Prinzip: mangelnde Durchsetzungskraft, paßt auch das in ihr Bild amerikanischer Schwäche, an dem sie im Grunde etwas ganz anderes interessiert: das Kräfteverhältnis zwischen den USA und ihren weltwirtschaftlichen Rivalen. Daß das sich gegen die USA verschoben hat, wollen sie begriffen haben und leiten daraus eine Konsequenz ab, die mit diesem Befund, selbst wenn er stimmt, nur über ein aufschlußreiches Zwischenargument zusammenhängt: Dann helfen auch die schönsten Zinsen dem Dollar nicht. Offenbar haben die Finanzkapitalisten mit ihrer bisherigen Wertschätzung der US-Währung – ihrer eigenen, jetzt praktisch wahrgemachten Einschätzung zufolge – zu großen Teilen Amerikas politische Dominanz honoriert. Jetzt rächen sie gewissermaßen an Clinton, was sie dem Vorkämpfer des kalten Krieges noch unbedingt, seinem Gewinner nur noch bedingt und dem Sieger des Golfkriegs schon nicht mehr zugute gehalten haben, nämlich ihr geldschöpferisches Vertrauen auf die unbezweifelte Supermacht des Kapitalismus, und streichen mit dem politischen Bonus erhebliche Prozente am Yen- und DM-Preis des Dollar. Kein Wunder, daß gegen diese fundamentale politische Kurskorrektur der schönste ökonomische Boom nicht aufkommt.
Für diese Sicht haben die Börsen einen letzten, nach ihrer eigenen Einschätzung besonders schlagenden Beleg: die amerikanische Weltmacht selbst. Denn:
b) Die USA profitieren nicht von ihren Versuchen, den Konkurrenzvergleich gewaltsam zu korrigieren
Immerhin ist ja die US-Regierung selbst unter der Zielsetzung angetreten, den eigenen Laden machtvoll in Ordnung zu bringen, um ihrer Macht nach außen wieder ein tragfähiges Fundament zu verschaffen. Den Streit mit Japan um Begünstigung amerikanischer Exporte und mit der EU um für Amerika vorteilhafte GATT-Regelungen hat sie fortgeführt, um so das Außenhandelsdefizit der Nation endlich zu verkleinern. Daher haben „die Märkte“ also ihre Maßstäbe. Daß Amerika denen nicht genügt – weder läßt eine innere Runderneuerung alle Sorgen ums Haushaltsdefizit verstummen, geschweige denn die Defizite verschwinden, noch kehrt der geballte Einsatz der Diplomatie die Vorzeichen in der Außenhandelsbilanz um –, das ist nicht bloß der Fall; die Nation sieht es auch so und gibt ihrer Führung die Schuld. Da können sich die Geldhändler nur anschließen: Sie spekulieren gegen den Dollar, testen damit noch einmal Macht und Entschlossenheit der Regierung, ihre Spekulation in die Schranken zu weisen, werden nicht abgeschmettert[11] und haben sich damit einmal mehr bewiesen, was – eigentlich gar nicht mehr – zu beweisen war.
Dabei ist es gar nicht so, als ob der „Dauerdruck“, den die USA offenbar immerhin – gegen Japan vor allem – entfalten können, wirkungslos geblieben wäre: Reglementierungen des internationalen Freihandels im amerikanischen Sinn sind durchaus zustandegekommen. Und bei aller „Kraftlosigkeit“, die „die Märkte“ den Mächtigen in Washington attestieren: Daß sie sich mit ihrer Spekulation gegen deren Geld womöglich zum Erfüllungsgehilfen regierungsamtlicher Absichten machen, mögen die aufmerksamen Spekulanten selbst nicht ganz ausschließen:
„Eine Schule von Beobachtern glaubt, die amerikanische Regierung sehe in einem schwachen Dollar die einzige Möglichkeit, das amerikanische Handelsdefizit abzubauen und die Japaner dazu zu zwingen, ihre Märkte für amerikanische Exporte zu öffnen.“ (Handelsblatt vom 27.6.94)
Doch wäre selbst das alles andere als ein Souveränitätsbeweis; und vor allem bleibt der schlagende Erfolg aus. Der Schädigung des japanischen Außenhandels – dessen gigantische Dollarüberschüsse verlieren mit ihrem Wachstum an Wert – entspricht kein amerikanisches Plus, noch nicht einmal ein überzeugend geschrumpftes Minus. Also ist die Sache klar: Der Fall des Dollar beweist Amerikas Ohnmacht, ihn aufzuhalten.
Ein Gegenargument hätten die Devisenhändler eventuell noch respektiert: Wenn es den Amerikanern gelungen wäre, auf dem G7-Gipfel im Sommer eine Einheitsfront der maßgeblichen Staaten gegen die Anti-Dollar-Spekulation herzustellen. Aber auch das ist unterblieben, so daß kein Spekulant Farbe bekennen mußte, ob ihn ein Signal in die entgegengesetzte Richtung mehr überzeugt hätte als sein eigener Trend:
„Die Börsianer hatten nicht unbedingt Großes von G7 erwartet, aber insgeheim (?) doch so etwas wie kraftvolle, überzeugende Dollar-Solidaritätsbezeugungen, gegebenenfalls ergänzt durch konzertierte Unterstützungsmaßnahmen. Die gab es bislang aber nicht. Wie Händler betonten, sei außer üblichen Gemeinplätzen beim G7-Treffen in Neapel nichts herausgekommen, was als richtungsweisendes Signal für die Finanzmärkte interpretiert werden könne.“ (Handelsblatt vom 11.7.94)
Es bleibt also erneut bei dem großen Zwar-Aber: Die Weltmacht USA setzt einiges an Gesetzesmacht nach innen und Verhandlungsmacht nach außen ein, um ihre Konkurrenzposition da zu verbessern, wo sie selbst Schwächen und Abhängigkeit diagnostiziert – ohne Erfolg. Sie versucht sich mit allen möglichen Mitteln als entscheidende, nämlich die Konkurrenz erschlagende Geschäftsbedingung – und bewährt sich nicht als solche.
Doch was bedeutet dieses Ergebnis? Ist etwa „Normalität“ in dem Sinn eingekehrt, daß auch die USA sich in einer nach pur ökonomischen Kriterien ausgetragenen Konkurrenz als reine Wirtschaftsmacht gegen ihre Partner behaupten und nun erst einmal ihre früheren politischen Privilegien abbüßen müssen, die sie als Vormacht der freien Welt genossen haben? Oder sind gerade umgekehrt ökonomische Konkurrenzangelegenheiten dabei, zu reinen Machtfragen zu werden, die die USA nach dem Ende ihrer anerkannten Anführerschaft nicht mehr eindeutig zu ihren Gunsten zu entscheiden verstehen oder vermögen? Oder ist doch bloß Clinton ein Schwächling?
Niemand braucht solche Fragen zu beantworten. Denn auf der anderen Seite ist soviel klar:
c) Die Konkurrenten werden mit dem Fall des Dollar nicht glücklich
Deren Währungen bekommen zwar im Vergleich zum US-Geld einen Pluspunkt; doch ist der wenig eindeutig. Was nützt Japan sein starker Yen, wenn dessen Kehrseite, der Verfall des Dollar in japanischer Währung, an die Substanz der japanischen Exporterlöse geht? Wenn die positive Außenhandelsbilanz die inneren Gewinne, den Überschuß in Yen, und damit die reale Akkumulation des japanischen Kapitals aufzehrt? Die Lage für Amerikas großen Lieferanten ist dann zwar umgekehrt wie die Amerikas beschaffen, aber überhaupt nicht günstiger.
Für das europäische Deutschland mag dieser Effekt weniger schlimm ausfallen – sehr selbstbewußt verkündet der Wirtschaftsminister noch im Sommer:
„Rexrodt befürchtet nicht, daß die deutsche Exportkonjunktur in den nächsten Monaten von der Kursentwicklung des Dollar in Mitleidenschaft gezogen wird. Zwei Drittel der deutschen Exporte gingen nach wie vor in die EU und seien damit vom Dollarkurs nicht unmittelbar betroffen.“ (Süddeutsche Zeitung vom 6.6.94),
und es gibt sogar die unvermeidlichen Schönfärber, die gleich eine Umkehr der überlieferten Verhältnisse ausmachen und herbeireden wollen:
„Immer mehr Beobachter schreiben der $-Schwäche sogar Gutes zu. Für die internationalen Anleger gewinne der deutsche Rentenmarkt Konturen eines sicheren Hafens.“ (Handelsblatt vom 12.7.94)
Als lachender Dritter kommt die Hauptwirtschaftsmacht Europas aber durchaus nicht aus der Dollarkrise heraus. Die läßt sich nämlich gar nicht auf Amerika und seinen fernöstlichen Handelspartner lokalisieren. Die Entwertung der US-Währung trifft alle Bilanzen, weil alle Geldhändler, Notenbanken, Multis usw., auch die deutscher Nationalität, große Teile ihrer Guthaben in Dollar halten: Die sind mit-entwertet,[12] und es hilft nichts, daß man für die übriggebliebenen Yen- und DM-Guthaben mehr von den wertloseren Dollars kaufen könnte – wenn man wollte… Ebenso mitbetroffen sind Deutschlands Schulden – börsentechnisch: „Renten“ –, wenn „die Märkte“ zur Belohnung für ihre Spekulation gegen den Dollar auf höhere Zinsen für US-Staatsanleihen setzen – denn daß die vielleicht nicht reichen, um den Dollarkurs zu heben, heißt ja nicht, daß sie nicht gefordert und abgezockt werden! – und sie womöglich sogar kriegen: Dann geraten natürlich auch deutsche Staats-Zinsen unter „Erwartungsdruck“, und der allein entwertet schon alte Staatspapiere[13] und hemmt den Absatz neuer bzw. macht ihn teurer.[14] Dabei braucht der deutsche Staat neuen Kredit und nicht zu knapp; denn mit seinem Haushaltsdefizit steht er gar nicht grundsätzlich besser da als der amerikanische, dem sein Budget-„Loch“ von „den Märkten“ so übelgenommen wird. Und das bleibt „den Märkten“ natürlich nicht verborgen: Ausländische ebenso wie langfristige Geldanlagen in deutschen Staatspapieren finden viel zu wenig statt.
„Bundesanleihe besteht Testrunde“ – aber: „Trotz der guten Aufnahme sollte bedacht werden, daß die Anleihe größtenteils bei den Banken liege, die sie für Arbitragegeschäfte nutzten… Endinvestoren seien derzeit eher die Ausnahme.“ (Handelsblatt vom 21.7.94)[15] „Heimische Anleihen gaben deutlich nach… Neben Irritationen von jenseits jenseits des Atlantiks verweisen die Pessimisten auch auf den hohen Kreditbedarf der öffentlichen Hand in der zweiten Jahreshälfte, die anhaltende Zurückhaltung ausländischer Anleger und das Auslaufen des Zinssenkungsprozesses.“ (Handelsblatt vom 25.7.94)
Im Endeffekt sind sämtliche Börsen in höchst unbekömmlicher Weise „volatil“[16], was die Verantwortlichen ihnen ziemlich übelnehmen.[17] Sie beschweren sich über eine verkehrte Technologie des Spekulierens –
„Jeder vermeintlich wichtige Anhaltspunkt für die künftige geldpolitische Linie werde registriert – Äußerungen führender Notenbankvertreter ebenso wie minimale Veränderungen bei den Zuteilungssätzen der Wertpapierpensionsgeschäfte. Allzu oft würden jedoch aus diesem pausenlosen ‚Bundesbank-Watching‘ Gerüchte entstehen, die jedweder realen Grundlage entbehrten.“ (Bundesbank-Direktoriumsmitglied Issing auf dem Börsentag, Handelsblatt vom 5.7.94) –
und sind doch in Wahrheit mit einer eindeutigen Festlegung konfrontiert, die die Geldanleger mit ihrer fatalen „Unstetigkeit“ treffen: Als die sichere Anlagewährung, die die vom Dollar abwandernden Geldkapitalisten suchen, gilt die DM wegen ihrem Kursgewinn noch lange nicht.
Einen solchen Durchbruch zu gesicherter Anerkennung, die alle Geldsorgen erledigen würde, sehen im übrigen auch die deutschen Wirtschaftspolitiker nicht. Für sie ist die Aufwertung ihrer Mark gegen den Dollar weder Ergebnis noch sicheres Mittel eines grundsoliden Erfolgs, also kein Grund zur Zufriedenheit, sondern ein Anlaß mehr, die gründliche innere Erneuerung ihres Wirtschaftsstandorts zu fordern und zu betreiben. Offenkundig gehen sie davon aus, daß Deutschland trotz besserer Bilanzen und mit aufgewerteter Währung in gar keiner grundsätzlich besseren Lage ist als Amerika mit seinem Versuch, durch innere Reformen und bessere Außenhandelsbilanzen Land zu gewinnen.
Um so bemerkenswerter ihre Reaktion:
d) Die Deutschen lassen Rücksichten fallen
Die Fragwürdigkeit währungshändlerischer Pluspunkte ist für die deutschen Aufbruchspolitiker überhaupt kein Grund, den heillosen und allseits letztlich bloß Verluste stiftenden Trends der Spekulation eine Gemeinschaftstat der großen Wirtschaftsmächte entgegenzusetzen, wie es die früher ja durchaus schon gegeben hat. Der Chef der Bundesbank gibt zu verstehen, daß er gar nicht ungern seinen US-Kollegen die einstige Nötigung heimzahlt, sich als deutscher Währungshüter für die amerikanische Währung zu engagieren:
„Die Weltwirtschaft muß an einem starken und einem – nach innen, wie nach außen – stabilen Dollar interessiert sein. Das gilt auch für uns… Natürlich liegt die primäre Verantwortung für die Stärke des Dollar bei den USA selbst. Die Anfang der 70er Jahre dort vertretene These ‚It is our currency, but your problem‘ sei zu kurz gedacht. Im übrigen sei sie den USA damals[18] nicht bekommen.“ (Bundesbankpräsident Tietmeyer nach Handelsblatt vom 15.7.94.)
Der Chef des deutschen Wirtschaftsministeriums ermuntert „die Märkte“ geradezu dazu, gegen alle Versuche der Dollar-Stützung mit ihrer Spekulation Recht zu behalten:
„Eher stimuliert denn beruhigt worden seien die Spekulanten schließlich durch die letzte Interventionsrunde zugunsten des Dollar, die gegen den Rat der Bundesbank zustandegekommen sei. Die deutsche Auffassung, daß Interventionen gegen den Markttrend nicht erfolgreich sein können, hat sich damit erneut bestätigt.“ (Rexrodt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 6.6.94)
Da wird keineswegs eine unparteiische Lehre aus jahrzehntelanger gemeinschaftlicher Währungspolitik gezogen – die ja immerhin stattgefunden und jeweils ihre Wirkungen gezeitigt hat. Da nimmt vielmehr Deutschland einen sehr entschiedenen Standpunkt ein, den es dann auf dem G7-Treffen im Sommer, zum Erstaunen „der Märkte“, als Gemeinschaftslinie durchgesetzt hat: gegen Gemeinschaftsaktionen zugunsten der USA und ihres Dollar. Die Betonung liegt auf beiden Momenten. Erstens: Nichts zugunsten des großen Weltwährungsrivalen. Wo Amerika das große Plus seiner Vergangenheit verliert, den Bonus der Macht, auf die selbst Deutschland hat hören müssen; wo also endlich Waffengleichheit einkehrt in die transatlantische Konkurrenz, da bekennt Deutschland sich im Zweifelsfall zur Konkurrenz ohne Abstriche. Und zweitens: Überhaupt keine supranationalen Garantien. Wo der Währungsvergleich Verluste zuteilt und Unsicherheit stiftet, da hört für die Deutschen das gemeinsame Betreuen und Kontrollieren der Bewegungen des Kreditüberbaus auf. Allgemeiner: Wo die bisherige Ordnung im Konkurrieren wacklig wird, wirft man sie weg. Sollte das wirklich so gemeint sein: Die Musterknaben der Weltwirtschaft brechen mit zentralen Gepflogenheiten dieses Wunderwerks?!
Schon wenig später hat sich die Gelegenheit für eine neue Klarstellung in dieser Frage ergeben:
e) IWF-Tagung in Madrid – Die Weltwirtschaftsmächte demontieren ihre supranationale Kreditbetreuungsagentur
Es ging um den Vorschlag des IWF-Chefs Camdessus, zur Erleichterung der Zahlungsnöte bedürftiger Staaten Sonderziehungsrechte im Gegenwert von 35 Mrd. Dollar zu schaffen. Deutschland und die USA einigten sich und die G7 auf den Gegenvorschlag, nur den neu zum marktwirtschaftlichen Paradies hinzugestoßenen Oststaaten 16 Mrd. Dollar SZR verfügbar zu machen.
„Die führenden Industrienationen waren nicht willens, untereinander oder mit dem Rest der Welt einen Kompromiß einzugehen. Sie hatten ihre Absprache in privater Sitzung getroffen – und es hieß ‚take it or leave it‘. Die anderen Staaten verzichteten: Ein Diktat ließen sie sich nicht bieten.“ (Guardian Weekly vom 9.10.94)
Allen Beteiligten ist klar, daß es hier nicht um ein paar Milliarden Peanuts ging, sondern ums Prinzip.
„Auf der einen Seite gibt es die mitleidlose Sichtweise, daß jede Nation, angefangen bei dem ums Überleben kämpfenden exkommunistischen Aserbeidschan bis hin zu entwickelten Industrienationen wie Spanien, sich der unsichtbaren Hand des Marktes zu unterwerfen habe. Auf der anderen Seite hält sich die Auffassung, vertreten durch den leitenden Direktor des IWF, Schwellenländer wie Indien und seitens Frankreichs und Japans, daß die Welt einer gewissen Ordnung bei der Regelung ihrer Handels- und Finanzströme bedarf. Es war dieser Prinzipienstreit, der eine Einigung verunmöglichte. Camdessus bestand darauf, daß der Fonds an seiner Mission als Verfechter des öffentlichen Wohls der Welt festhalten müsse… Der IWF macht sich Sorgen über die massive Instabilität, die durch die Deregulierung der globalen Finanzmärkte verursacht wird.“ (ebd.)
Die Ideologie vom globalen Allgemeinwohltäter beiseitegelassen, geht es dem IWF-Chef um die bislang unstrittige Hauptaufgabe seines Instituts, nämlich durch geregelten „Zugang zu internationaler Liquidität“ für alle Nationen die Haupt- und Generalvoraussetzung eines weltweiten Handels unter heutigen Verschuldungsbedingungen aufrechtzuerhalten. Allgemeine neue Kreditlinien hält er dafür für erforderlich, weil die hemmungslose Ausweitung des Weltkredits durch die Großen – nämlich durch die „strukturellen Defizite der öffentlichen Sektoren“ in den Weltwährungsländern – und die dadurch verursachte „Instabilität der Finanzmärkte“ allen übrigen Nationen die Geldbeschaffung teuer und schwierig bis unmöglich machen.[19] Gerade durch die Großen werde aber die ordentliche IWF-kontrollierte Liquiditätszufuhr verunmöglicht, weil sie Sonderziehungsrechte nicht mehr – statutengemäß – allgemein zuteilen wollten, sondern wenn überhaupt, dann nur für ausgewählte Sonderfälle.[20] Diese Politik verhindere es,
„die Rolle der SZR im Währungssystem zu bewahren und die SZR zu einem wesentlichen Liquiditätsinstrument zu machen.“ (Handelsblatt vom 26.9.94)
Von diesem Standpunkt aus war das Ergebnis von Madrid eine Katastrophe:
„Der Vorstoß des IWF zur Verstärkung der Rolle der SZR war der erste zaghafte Versuch zurückzuschlagen – und der schmähliche Zusammenbruch der Initiative ist ein dramatischer Rückschlag… Wenn jedoch in dieser Frage keine Einigkeit herstellbar ist, dann sind die Chancen, einen Konsens über die Notwendigkeit eines neuen Wechselkursregimes oder über Kontrollen der Kapitalbewegungen herzustellen, nicht existent… Das Signal von Madrid ist, daß es keine koordinierten Anstrengungen geben wird, ein neues System einzurichten. Die einzige Ordnung ist die Nicht-Ordnung, die derzeit herrscht.“ (Guardian Weekly vom 9.10.94)
Genau das sehen die maßgeblichen Auftraggeber des IWF ganz anders. Deutschland und Amerika beharren darauf, daß die „Versorgung“ der Nationen, und zwar aller, mit „Liquidität“ durch die Entscheidungen des Finanzkapitals längst bestens sichergestellt sei:
„Camdessus konnte den Vertretern der großen Industriestaaten nicht begreiflich machen, daß für eine so kräftige Aufstockung der internationalen Liquidität ein ‚globaler Bedarf‘ bestehe… Lt. Waigel zeigen die Kapitalzuflüsse in die Entwicklungsländer, daß Liquidität ‚ausreichend vorhanden‘ sei.“ (Handelsblatt vom 4.10.94)
Wo über den Fonds höchstoffiziell geschaffenes und gesichertes Weltkreditgeld hingetan werden soll, das wollen sie, Statuten hin oder her, nach ihrem Ermessen und Interesse fallweise entscheiden. Denn es ist ja nicht so, als ob sie für dieses supranationale Geld überhaupt keine Verwendung mehr wüßten: Um die Investitionen abzusichern, die sie im Bereich des ehemaligen Ostblocks vorhaben – ungemein unsichere, aber ungemein verlockende Geldanlagen offenbar! –, wären zusätzliche Fondsmittel ihnen durchaus recht – aber eben auch nur für diesen Zweck.
Unter dieser Maßregel ändert das ehrwürdige Institut seinen Charakter schon ein wenig. Vom Instrument des gemeinschaftlichen Managements internationaler Zahlungsnöte[21] wird es zum Tummelplatz für Auseinandersetzungen der führenden Nationen um kollektive Kreditgarantien für ihre jeweilige spezielle Klientel: Das war der Inhalt des Konsens, zu dem die USA und die BRD es in Madrid gebracht haben. Das können sich diese Mächte offenbar gut vorstellen: die Weltgemeinschaft der Handelspartner, also vor allem einander für ihre Sonderinteressen in Anspruch zu nehmen, ohne sich durch irgendein supranationales Ordnungs- und Lenkungsinteresse in Anspruch nehmen zu lassen.
f) Kleines Zwischenfazit
So etwas geht auch; der Übergang zu einer neuen internationalen „Streitkultur“ in Kreditfragen findet gerade statt. Was diese leistet, ist absehbar. Ihr Gegenstand ist immerhin ein Gesamtkunstwerk, welches das höchste kapitalistische Gut nach Masse und Gültigkeit erstens aus dem Konsens aller Nationen ableitet, Schulden für Reichtum zu nehmen, und zweitens aus der Fähigkeit der Beteiligten, mit dem ihrer Rolle entsprechenden Maß von wirklichem Reichtum für diese Gleichung einzustehen. In ihrem Wahn, das je Eigene zu sichern, werden die Herren des Systems einigermaßen rücksichtslos gegen dessen Grundlagen.
[1] Deswegen halten kapitalistische Staaten es einfach nicht aus, wenn irgendwo auf der Welt ein anderer Begriff von Reichtum gilt: Die Absolutheit des Werts, für die sie einstehen, ist damit negiert.
[2] Zur Vermeidung von Mißverständnissen: Daß der wahre Reichtum der Gesellschaft nicht in ihren Gebrauchsgütern, sondern im abstrakten exklusiven Verfügungsrecht darüber liegt und dieses Recht im Geld seine dingliche Existenz und sein quantitatives Maß hat: diese Verrücktheit war auch schon zu den Zeiten, als Goldmünzen herumgereicht wurden und Papiergeld eine wirkliche Anweisung auf Edelmetallquanta war, keine Eigenschaft der Geldmaterie, sondern – wie in der modernen Zettelwirtschaft – ein Werk der höchsten Gewalt.
[3] Das ist übrigens das ganze Geheimnis der berüchtigten „terms of trade“, die zu Zeiten, als der kapitalistische Wahnsinn noch eine „real existierende“ Alternative hatte und sich deswegen einige idealistische Anfeindungen gefallen lassen mußte, von Utopisten eines menschenfreundlicheren Weltmarkts zum Inbegriff einer skandalösen Ungerechtigkeit erklärt worden sind. Daß arme Länder immer mehr Ware fürs Geld abliefern müssen und fürs eingenommene Geld immer weniger Ware aus den kapitalistischen Spitzennationen kaufen können, ist zwar skandalös, aber völlig sachgerecht: Im Wechselkurs wird der einzig wahre, nämlich geldwerte Reichtum festgestellt, den diese Länder mit ihrer Kaffee-, Bananen- und sonstigen Produktion zustandebringen; in ihm bekommen sie unanfechtbar und marktwirtschaftlich objektiv bescheinigt, wie unrentabel die Arbeit ist, die bei ihnen ausgebeutet wird, und wie wenig wert deswegen die Ware, die sie zu exportieren haben. Daß sich mit dem Geld fortschrittlicher Nationen kapitalistisch unvergleichlich mehr, nämlich Rentableres anfangen läßt, macht deren Währung umgekehrt so wertvoll. Der Weltmarkt vergleicht eben nicht Kaffeesäcke mit Lokomotiven, geschweige denn Arbeitsstunden hier und dort, um den Werktätigen ihren Aufwand gerecht zu vergüten, sondern Währungen; und was an denen verbindlich verglichen wird, ist die Konkurrenzfähigkeit der Kapitalisten, nämlich die Konkurrenzfähigkeit ihrer Kapitalmassen, die eine nationale Wirtschaft ausmachen. Deswegen ist es, nebenbei, auch so: Bekämen die „benachteiligten“ Staaten für ihre Produkte immerzu gleich viel, blieben also Preise und Wechselkurse immer konstant und so die „terms of trade“ unverändert, dann würden die Kaffee- und Bananenrepubliken der Dritten Welt ihre nationale Symbolfrucht längst aus holländischen Treibhäusern beziehen…
[4] Um sich die Sache klarzumachen, darf man nicht gleich als erfahrener Zeitungsleser einwenden, daß unterschiedliche Inflationsraten verschiedener Währungen sich doch auf die Wechselkurse auswirken, und zwar so, daß mit dem stärker inflationsgeschädigten Geld auch im Ausland weniger zu kaufen ist. Diese Wirkung tritt nämlich nur deswegen so sicher ein, weil von der Teuerung in einem Land ausländische Kapitalisten profitieren, die mit vergleichsweise billigen Preisen bestens auf ihre heimischen Kosten kommen, und die entsprechend verschlechterten Außenhandelsbilanzen eine „Anpassung“ erfordern.
[5] Um nur das nächstliegende Beispiel zu nennen: Entgegen anderslautenden Gerüchten über jene Zeit wurde die bundesdeutsche Republik in den Jahren 68/69 am heftigsten vom Streit um Aufwertung (Schiller/SPD) oder Nicht-Aufwertung (Kiesinger/CDU) der DM erschüttert; Wähler und Geschichte haben dann einer „innovativen Finanzpolitik“ und nicht der permanenten Revolution als Lebensform recht gegeben.
[6] Jeder weiß, daß die Banken sich das Austauschgeschäft mittlerweile sehr vereinfacht haben; sie bekommen es nur noch mit ganz wenigen internationalen Handelswährungen zu tun. Damit werden die hier erläuterten Unterscheidungen, die das Bankgeschäft praktisch trifft, aber nicht hinfällig: Auf diese Unterschiede haben die Geldinstitute ja eben mit der Bereinigung ihres Sortiments um solche Währungen reagiert, die ihr Devisengeschäft nur mit Risiken und Umständlichkeiten belasten.
[7] Auch sein inneres Kreditgeschäft macht das Bankgewerbe mit dem Geld der Nation: Das ist der Grundstock, auf den es den nationalen Kredit gründet; und im Zins berechnet es den Preis für das nationale Kreditgeld, das es schöpft. Analog im Außengeschäft: Da geht es der Bank um ausnutzbare Differenzen um den Wert der nationalen Währung herum; mit dem macht sie ihren Gewinn, indem sie ihn in fremder Währung beziffert. Der Preis des nationalen Geldes: Nach innen wie nach außen ist diese eigentümliche Größe das Geschäftsmittel des Finanzkapitals.
[8] Was das für die Staaten bedeutet, wird im nächsten Kapitel behandelt.
[9] Die letzte Grundlage für solche paradiesischen Verhältnisse ist die bewährte Stärke des nationalen Kapitalismus: Masse, Wachstumsrate und internationaler Geschäftserfolg des in diesen Nationen akkumulierten Kapitals – und auf der anderen Seite die Verfügbarkeit schwächerer Konkurrenten, die nicht bloß als Quelle des andernorts konzentrierten Reichtums herhalten, sondern diesen Dienst auch noch über die Schranken ihrer Zahlungsfähigkeit hinaus leisten. Wenn auf dieser Grundlage der weltumspannende Währungsvergleich lange genug die guten Währungen immer besser gemacht und die schwachen aussortiert hat, dann gibt es diesen Fall, daß Schulden direkt als Weltgeld gelten.
[10] Alles Nötige dazu ist nachzulesen in dem ‚Exkurs über eine mächtige Ideologie: „Der Staat spart“‘ in GegenStandpunkt 4-92, S.91.
[11] Wird die Clinton-Administration entschlossener handeln als letzte Woche, um den Spekulanten das Handwerk zu legen? Mit dem halbherzigen Vorgehen am Freitag, als der FED und 16 andere Notenbanken zweimal mit Dollarkäufen intervenierten, sei es nicht getan, meinten Händler…
(Handelsblatt vom 27.6.94)
[12] Genaues weiß mal wieder keiner; aber: Wertpapieranalysten und Ratingagenturen schießen sich verstärkt auf Europas Universalbanken ein… Auf den Weltfinanzmärkten entwickelt sich so etwas wie ein Konsens, daß die global angelegte Wertpapieranlage in den nächsten Jahren bei namhaften kontinentaleuropäischen Bank- und Finanzadressen mit so manch ‚böser Überraschung‘ wird rechnen müssen… Viele europäische Banken dürften wegen ungenügender Kreditqualität über die Mitte der 90er Jahre hinaus unter Druck geraten.
(Handelsblatt vom 13.8.94)
[13] An der Frankfurter Börse hatten öffentliche Anleihen bei hektischem und nervösem Geschäft Einbußen von bis zu 0,80 DM hinnehmen müssen… Die Akteure schlossen die Fortsetzung der Talfahrt und einen Fall der Bund-Futures bis auf 89% nicht aus.
Denn: In Reaktion auf die schlechte Marktverfassung
– von wegen also „sicherer Hafen“! – hat das Bundesfinanzministerium die Renditen für seine Daueremissionen erhöht.
(Handelsblatt vom 16.6.94) Einen Monat später: Aus den kräftig gestiegenen Zinsen resultiert derzeit erheblicher Wertberichtigungsbedarf in den Rentenportefeuilles. Bei einem Rückgang des deutschen Rentenindex um 6,2% seit Jahresbeginn ermitteln sich für die Portefeuilles der einzelnen Institute rechnerische Kursverluste zwischen 3,7 und 1,6 Mrd. DM.
(Handelsblatt vom 11.7.94)
[14] Mit Sorge betrachteten viele Marktteilnehmer, daß jede Kurserholung nur noch die Hälfte der vorangegangenen Verluste ausmache… Aufgrund der schwachen und unsicheren Lage kocht das Emissionsgeschäft im DM-Sektor weiter auf Sparflamme. Händler verwiesen in diesem Zusammenhang auch auf die hohen Bestände unplazierter Anleihen in den Banken-Portefeuilles. ‚Die Institute sind nicht bereit, sich weitere Emissionsware auf Halde zu legen‘, sagte ein Konsortial-Manager.
(Handelsblatt vom 16.6.94)
[15] Die Bundesbank registriert eine Aufblähung dessen, was sie „Geldmenge“ nennt: DM-Kredit in Form kurzfristiger Anlage häuft sich, während die solide Nachfrage nach langfristigen Finanztiteln sich einfach nicht einstellen will. Das ist für sie ein besorgniserregender Zustand, deutet es doch darauf hin, daß die Eigentümer dieser Geldvolumina sich mit dem Einwechseln von Dollar in DM gar nicht eindeutig für Anlage in DM entschieden haben, sondern das Bundesbankgeld bloß zum vorläufigen Anhäufen von DM-Schätzen benutzen, die man anders als ein Rentenpapier jederzeit ohne Kursverlust wieder abstoßen kann.
[16] Nach Zins- und Inflationsbefürchtungen überschatten jetzt auch noch Dollarängste die Finanzmärkte. Schlimmer kann es kaum noch kommen, erläuterte ein Händler an der Wall Street… Die Landesbank Rheinland-Pfalz verglich das derzeitige Geschäft mit einer Geisterbahn… Für den Schweizer Bankverein hat das Marktgeschehen teilweise irrationale Züge angenommen.
(Handelsblatt vom 20.6.94)
[17] Auf der Jahresversammlung der BIZ hat der BIZ-Präsident F. Duisenberg die möglichen Hintergründe des abrupten Anstiegs der langfristigen Zinssätze von Anfang 1994 untersucht. Sowohl das Ausmaß als auch die internationale Dimension seien für viele Finanzmarktteilnehmer und Entscheidungsträger überraschend gekommen… Die Finanzmärkte seien oft Stimmungsumschwüngen ausgesetzt, die sich kaum durch Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen erklären ließen… Angesichts der Innovationen auf den Kapitalmärkten werde eine stabile, mittelfristig ausgerichtete Geldpolitik noch wichtiger. Wenn die Marktteilnehmer Vertrauen in die mittelfristigen Umfeldbedingungen ihrer Investitionsentscheidungen haben, sei die Chance größer, daß diese zur Stabilität beitragen und keine Störungen zur Folge haben.
(Handelsblatt vom 14.6.94)
[18] Damals schon – heute ist aber die deutsche Seite nicht mehr bereit, für Folgen geradezustehen, die dem Dollar daraus erwachsen, daß die USA „nach innen wie nach außen“ ihren Kredit aufblähen.
[19] Ein Beispiel dafür nennt das Handelsblatt: Seit Beginn dieses Jahres werden die ‚emerging markets‘ von massiven Kursverlusten heimgesucht. Auf der Verliererliste belegen China, die Türkei, Polen und Venezuela mit Einbußen von 30% und mehr die Spitzenplätze… Die Kurse von Bradybonds rutschten allein im ersten Quartal dieses Jahres um 15% ab… Weil dreiviertel der von Entwicklungs- und Schwellenländern emittierten festverzinslichen Anleihen auf $ lauten, habe die jüngste Dollarschwäche den Korrekturprozeß an den jungen Märkten noch einschneidender gemacht.
(HB vom 29.9.94) Venezuela etwa hat deshalb seit Ende Juni den freien Handel mit Devisen verboten, eine staatliche Devisenzuteilungsbehörde gegründet und einen festen Kurs des Bolivar zum $ verfügt, mit der Folge, daß der Handel mit dem Land zunehmend zusammenbricht. Genau solche Konsequenzen sollte der IWF verhindern helfen.
[20] Vgl. hierzu den Artikel: IWF heute. Supranationaler Kredit unter den Bedingungen der Krisenkonkurrenz, in: GegenStandpunkt 3-93, S.79.
[21] Daß so etwas nicht mehr aktuell sei, wissen amerikanische Vordenker schon ein wenig schneller und ziehen ihre Schlüsse daraus: Für IWF und Weltbank gibt es nach Meinung einer Gruppe privater amerikanischer Ökonomen keine richtigen Aufgaben mehr. Nach ihrer Auffassung würden die IWF-Kredite an Rußland nur die Kapitalflucht finanzieren. IWF und Weltbank könnten durch ein kleineres Institut mit begrenzten Aufgaben ersetzt werden. Sie sollte nur zwei Funktionen haben: Kreditbewertung der Schuldner und Informationssammlung für die Darlehen sowie die Vergabe von subventionierten Krediten an die ärmsten Länder.
(Handelsblatt vom 13.9.94)