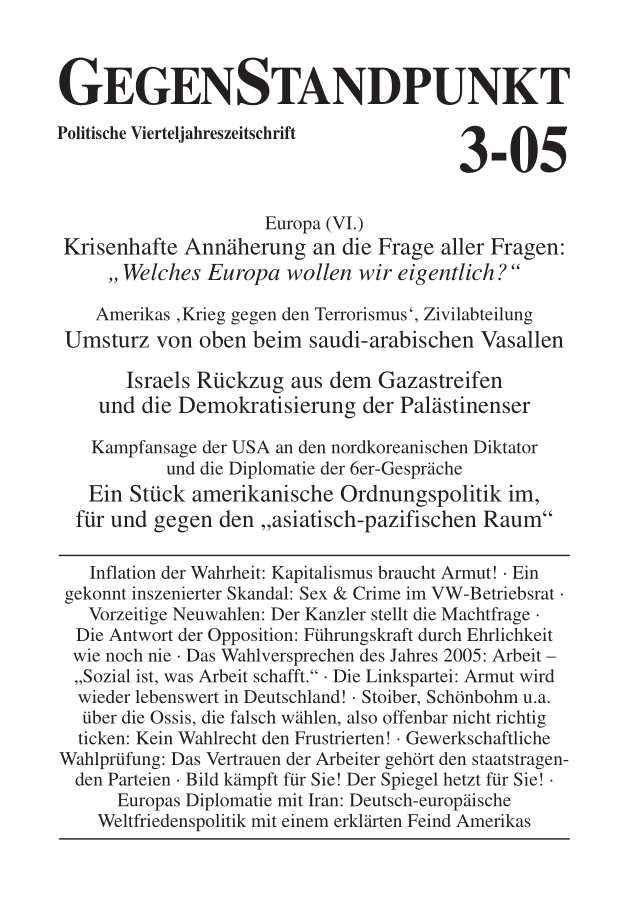Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Bundestagswahl 2005
Das Wahlversprechen des Jahres 2005: Arbeit
„Sozial ist, was Arbeit schafft.“
Bundespräsident Köhler fordert „Vorfahrt für Arbeit“, die CDU-Kanzlerkandidatin verspricht statt der unzureichenden „Agenda 2010“ eine echte „Agenda für Arbeit“; der bayrische CSU-Ministerpräsident definiert: „Sozial ist, was Arbeit schafft“, und alle, einschließlich des sozialdemokratischen Wirtschaftsminister schließen sich, das Motto leicht variierend, an: „Fair ist, was Arbeit schafft.“
Aus der Zeitschrift
Teilen
Bundestagswahl 2005
Das Wahlversprechen des Jahres 2005:
Arbeit
„Sozial ist, was Arbeit
schafft.“
Die Machtfrage des Kanzlers, das ehrliche Gegenangebot
der Opposition sowie überhaupt alle Konkurrenzen,
Polemiken und üblen Nachreden, mit denen Kandidaten und
Parteien etwas für ihre Unterscheidbarkeit tun und die
Wähler betören, finden statt auf dem Boden einer ganz und
gar gemeinsamen Diagnose der krisenhaften Lage der Nation
und einer ebenso geteilten Therapie: Dem Volk fehlt
Arbeit, diese Not muss bekämpft werden! Im Licht dieser
überragenden Aufgabe werden alle anderen
Tagesordnungspunkte der Nation zur Nebensache. Ihr war
schon Schröders Amtsantritt vor 7 Jahren gewidmet. Er
wollte sich an der Reduktion der Arbeitslosenzahlen
messen lassen, und ist mit all seinen Agenda
2010-Reformen, die das Land gründlich verändert haben, an
diesem Ziel gescheitert. Die unerledigte Aufgabe will er
mit einem neuen Auftrag und neuem Elan fortsetzen.
Dieselbe Aufgabe wollen ihm die anderen abnehmen.
Bundespräsident Köhler fordert Vorfahrt für
Arbeit
, die CDU-Kanzlerkandidatin verspricht statt
der unzureichenden Agenda 2010
eine echte
Agenda für Arbeit
; der bayrische
CSU-Ministerpräsident definiert: Sozial ist, was
Arbeit schafft
, und alle, einschließlich des
sozialdemokratischen Wirtschaftsminister schließen sich,
das Motto leicht variierend, an: Fair ist, was Arbeit
schafft.
1.
Die Politik kennt und anerkennt nur noch ein echtes,
unbedingt schutzwürdiges Interesse der sozial
Schwachen
– das absurdeste: das an Arbeit. So einfach
wird nämlich niemand von einem Bedürfnis nach Arbeit
umgetrieben. Arbeit ist immer noch der Aufwand,
der getrieben werden muss, um die Gegenstände und Mittel
herzustellen, nach denen ein Bedürfnis besteht,
nicht das Bedürfnis selbst, und jeder Arbeiter,
der seine Sinne beieinander hat, ist froh, wenn die
Arbeit erledigt und wieder vorbei ist. Das Bedürfnis nach
Arbeit, dem die Politiker sich nachdrücklich
verpflichten, ist kein waldursprünglich menschlicher
Drang, sondern Ausdruck einer hergestellten, erzwungenen
Lage. Nach Arbeit seufzen, Arbeit suchen, das tun nur
Proletarier in der kapitalistischen Gesellschaft, Leute,
denen es unmöglich ist, die für ihre Bedürfnisse nötigen
Arbeiten nach eigenem Entschluss und nach Maßgabe ihres
Bedarfs zu verrichten. Leute, die getrennt sind von den
Mitteln der Produktion, so dass sie davon leben müssen,
Dienste für die Reichtumsvermehrung anderer nach deren
Vorgaben und Ansprüchen zu verrichten und sich dafür
bezahlen zu lassen. Politiker, die Arbeit schaffen
wollen, unterstellen die ganze, mit staatlicher
Rechtsgewalt hergestellte und von ihr geschützte
Eigentumsordnung, die Scheidung in die Klasse der
Eigentümer der Produktionsmittel auf der einen und in die
Klasse der eigentumslosen Arbeitskräfte auf der anderen
Seite, als eine eherne Realität
, der sie in der
Ausübung ihres Amtes gerecht zu werden hätten. Nur die
von dieser Realität erzwungenen Interessen und
Nöte anerkennen sie als legitime Interessen der Bürger –
und denen dienen sie dann.
Zynisch setzen sie darauf, dass der Bedarf nach solchen Diensten im Volk reichlich vorhanden ist, denn – doppelt absurd – das erzwungene Interesse, für den Reichtum der Reichen schaffen zu dürfen, ist für Millionen gar nicht zu befriedigen. Der Bedarf der Armen nach Lohnarbeit, mit der sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen können, ist viel größer als das Bedürfnis der kapitalistischen Gesellschaft nach den Leistungen ihrer Arbeit. Die Eigentümer können die vielen Arbeitskräfte, die sich ihnen anbieten, für die Verwertung ihrer Investitionen einfach nicht gebrauchen. Nicht, dass sie weniger Waren produzieren würden als früher – ganz im Gegenteil; nicht dass die Herstellung irgendwelcher Produkte unterbliebe, die sich mit Gewinn verkaufen lassen; alles, was kapitalistisch gebraucht wird und geht, wird produziert und verkauft – aber eben mit erheblich weniger Arbeitskräften als früher. In der Not der Millionen Erwerbslosen reflektiert sich keine allgemeine gesellschaftliche Armut, kein Mangel an Produkten und Produktionsmitteln, sondern Überfluss: der erreichte Stand der Produktivität der Arbeit, mithin die Ergiebigkeit der Springquellen des materiellen Reichtums. Ihr Fortschritt verwirklicht sich im Kapitalismus so pervers, weil die Unternehmer die Arbeit ihres Personals immer produktiver machen, aber nicht um ihren Leuten Arbeitsmühen zu sparen, sondern um Arbeitskräfte einzusparen, sich die Bezahlung ihres Lohn zu ersparen. Dafür machen sie die Arbeit der Leute, die sie weiterhin für ihren Geschäftszweck benutzen, immer rentabler; und dafür wenden sie zugleich immer weniger Arbeitskräfte rentabel an. Der Nutzen der hohen Arbeitsproduktivität verteilt sich also sehr einseitig: Das Kapital bekommt die Leistung seiner Arbeitskräfte immer billiger, indem es pro Arbeitstag immer mehr verkaufbares Produkt aus seinen Beschäftigten herausholt; die Arbeitskräfte aber haben vom wachsenden Wirkungsgrad ihrer Arbeit nichts zu erhoffen als die Bedrohung ihrer Existenz. Noch froh sein muss der Teil der Belegschaft, der für seine ergiebigere Arbeit denselben alten Lohn erhält; der andere Teil fliegt wegen der gewachsenen Leistungskraft seiner Arbeit nämlich auf die Straße und bezahlt den Fortschritt der Produktivkräfte mit unmittelbarer Verelendung. Der Segen, dass immer weniger Arbeit für die Herstellung der benötigten und erwünschten Güter erforderlich ist, wird für kapitalistische Arbeitskräfte zum Fluch: Sie leben vom Gebraucht-Werden für fremden Gewinn, können daher umso weniger leben, je weiter die Entwicklung der materiellen Reichtumsquellen fortschreitet. Dass sie sich von dieser ruinösen Fessel befreien, sich die Produktionsmittel aneignen und die notwendige Arbeit selbst so organisieren, dass alle mit weniger Mühe mehr Güter ihres Bedarfs produzieren und das Leben ein bisschen gemütlicher angehen: Diese Vorstellung ist mit den kommunistischen Bewegungen ausgestorben.
Herrschende Demokraten lassen sich wählen mit dem
Versprechen, sich der Not anzunehmen, die mit der Mehrung
des kapitalistischen Überflusses wächst, und einmal im
Amt, tun sie das auch. Sie sorgen erstens für diese Not,
indem sie eisern und mit allen Hebeln der Staatsgewalt
sicherstellen, dass anders als durch fürs Kapital
lohnende Arbeit niemand leben kann. Zweitens dadurch,
dass sie sich der Aufgabe verschreiben, von der relativ
überflüssig gewordenen Arbeit wieder mehr zu „schaffen“.
Dies drittens aber nicht so einfach: Öffentlich Arbeit zu
organisieren, weil Arbeitslose etwas zum Leben brauchen
und es sich schaffen sollen, das kommt im Reich der
Freiheit nicht in Frage. Arbeit zu schaffen, ist hier
Privileg und edle Pflicht der freien Wirtschaft. Das
Privileg gibt es – niemand sonst befindet
darüber, ob, von wem, wie lange und für welchen Zweck
gearbeitet wird; die edle Pflicht ist jedoch ein
Märchen. Eine Aufgabe namens Arbeit schaffen
kommt
im Pflichtenheft der Herren Kapitalisten überhaupt nicht
vor. Sie benutzen und bezahlen immer gerade so viel oder
so wenig Personal, wie sie für ihr Geschäft lohnend
finden – und dabei kalkulieren sie, wie gesagt, knapp:
Möglichst wenige bezahlte Arbeitskräfte sollen ihnen
möglichst viel Arbeit erledigen. Paradoxerweise stehen
die Ausbeuter der Arbeit umso mehr im guten Ruf des
Arbeitgebers, je mehr Leute sie entlassen, und
je mehr die Gesellschaft gewahr wird, wie unbedingt sie
von den Kalkulationen der Herren Arbeitgeber abhängt,
wird diese Abhängigkeit bejaht. Dann lernt sie an der
massenhaften Produktion von Arbeitslosen auch nicht, dass
in dieser Wirtschaft von einer Aufgabe oder Pflicht zum
Arbeit-Geben keine Rede sein kann; im Gegenteil: dann
lernt sie daran, wie schwer es den Unternehmern offenbar
fallen muss, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
nachzukommen. Da meldet sich dann viertens die in Sachen
Arbeit-Schaffen ohnmächtige Politik wieder, reklamiert
dann doch eine Gesamtverantwortung für die Arbeitsplätze
im Land und schafft Arbeit
, so wie es ihr in einer
freien Wirtschaft eben ansteht: Sie kämpft gegen die
Hindernisse und reißt die Schranken ein, die den
Kapitalisten das Arbeit-Schaffen schwer machen. Wenn sich
im Land zu wenig Arbeit fürs Kapital lohnt, dann ist die
Arbeit eben nicht rentabel genug, jeder Arbeitslose ist
dann ein Beweis dafür, dass die Rendite der Kapitalisten
zu niedrig ist. Dann tut die Politik das kapitalistisch
Angemessene gegen die Not der Arbeitslosen, indem sie sie
billiger macht.
2.
Das Versprechen, das Volk besser mit Arbeit eindecken und keinen anderen Mangel als den an Arbeit mehr gelten zu lassen, definiert neu, was einmal „sozial“ hieß. Mehr als ein Jahrhundert lang hatte Sozialpolitik das Ziel, den Kapitalismus für die Lohnarbeiter aushaltbar zu machen. Dazu war einiges nötig. Aus demselben Grund nämlich, aus dem das Kapital die Leistungsfähigkeit der Arbeit durch Wissenschaft und Technik steigert – es spart an der Bezahlung der Arbeit, aus der es immer mehr Leistung herausholt –, kann der menschliche Kostenfaktor vom Ausfüllen seiner ökonomischen Rolle an und für sich nicht leben, jedenfalls nicht ein Leben lang. Erst die gesetzliche Beschränkung der Unternehmerfreiheit, Grenzen für die Dauer des Arbeitstages, die Zulassung von Gewerkschaften und die Rechtsverbindlichkeit der von ihnen ausgehandelten Tarifvereinbarungen hat die Ausbeutung des Arbeiters für ihn überhaupt zu einem Erwerb mit halbwegs festgelegtem Aufwand und Ertrag werden lassen. Auch davon aber konnte er auf Dauer nicht leben ohne staatliche Sozialversicherungen, die Teile seines Lohnes konfiszieren und im Interesse des Überlebens der Arbeiterklasse zwangsbewirtschaften. Für die notwendigen Phasen des Elends im Lebensweg des Lohnabhängigen – Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit – werden aus dem Lohn, den das Kapital zahlt, Versicherungsbeiträge abgezweigt und nach erworbenen Anwartschaften und Bedürftigkeit unter den einkommenslosen Mitgliedern der Arbeiterklasse umverteilt. Das Zwangsregime hat dem Lohn abgerungen, was er von sich aus nicht ist: ein Einkommen, mit dem ein Leben lang der Unterhalt des Arbeiters bestritten werden kann – das alles natürlich um den Preis seiner weiteren Schmälerung.
In Zeiten millionenfacher Überflüssigkeit von
Arbeitskräften für die Wirtschaft setzen Politiker aller
Couleur auf die Überzeugungskraft des Arguments, dass es
für Lohnarbeiter Schlimmeres gibt, als ausgebeutet zu
werden – nämlich nicht ausgebeutet zu werden,
die Chance also gar nicht erst geboten zu bekommen, sich
durch Bereicherung des Arbeitgebers den Lebensunterhalt
zu erarbeiten. Diese „Einsicht“ begründet die Umwertung
alles Sozialen, das der Staat einmal für nötig gehalten
hat: Alle Vorkehrungen und Nachhilfen, die die Ausbeutung
für den Arbeiter aushaltbar machen sollten, verteuern die
Arbeit. Sie beschädigen also, wovon der Arbeiter in
Wahrheit lebt – seine Rentabilität für das
Profitinteresse des Kapitals –, und zerstören seine
herrliche Einkommensquelle. Alles, was der Arbeiter von
seiner Arbeit hat und aus seinem Arbeitsentgelt
finanziert – Lebensunterhalt, Freizeit, soziale
Sicherheit –, verhindert die soziale Hauptsache: Dass
überhaupt Ausbeutung stattfindet und der Arbeiter
„Beschäftigung“ hat. Alle einhundertjährigen staatlichen
Regelungen, Korrekturen und Kompensationen der Ausbeutung
waren ein Fehler. Der Kapitalismus lässt sich nicht
sozial veredeln – und wer es versucht, schädigt
zuallererst die Schwachen
, die er schützen will.
Seine Ausbeutung als billige Arbeitskraft ist selbst die
soziale Wohltat des Kapitals, auf die der Normalbürger zu
hoffen und zu setzen hat.
3.
Der Gehalt des Wahlversprechens wird verstanden. Die Wähler entnehmen der Neudefinition des Sozialen sehr wohl die Ansage weiterer „Grausamkeiten“, wie das in der gemütlichen Sprache der Politik heißt. Bei uns wird eben nichts verschwiegen. Die Bürger sollen die Opfer, die sie bringen werden, billigen, ja am besten noch selbst fordern. Selbst die Verarmung der Masse der Bevölkerung wird in Form einer hoch demokratischen Konkurrenz von Amtsanwärtern um die Gunst der Betroffenen abgewickelt. Das geht – und nicht nur, weil die Wähler ja doch keine Wahl haben, wenn alle Parteien gleichermaßen versprechen, mit aller Macht Arbeit zu schaffen, sondern weil sie sich die Notwendigkeit der ‚unvermeidlichen Einschnitte‘ einleuchten lassen. Die demokratische Politisierung des Untertanen ist nichts anderes als die Kunst, ihn gegen seine Interessen zu interessieren. In all seiner Radikalität ist der Wahlkampf 2005 ein Musterfall davon. Die Wahlkämpfer sprechen den Bürger auf seine erzwungene Angewiesenheit auf die Nachfrage des Kapitals nach Arbeit an, erinnern ihn an seine Abhängigkeit vom feindlichen Interesse und versprechen ihm, an den Schalthebeln der Macht dieser Abhängigkeit gerecht werden zu wollen. Sie versprechen, wenn gewählt, der Eigentümerklasse nach besten Kräften zu dienen, sie von Beschränkungen freizusetzen, in jeder Hinsicht zu fördern und ihren arbeitenden Wählern dafür alles wegzunehmen, was den Reformern als hinderlicher Besitzstand ins Auge fällt. Diese Bürger sind Objekte des Ausbeutungsinteresses der Gegenseite und werden politisch auf dieses Abhängigkeitsverhältnis mit aller Härte festgelegt – der demokratische Wahlkampf aber spricht sie als Subjekte ihrer Abhängigkeit an, als Leute, die im wohlverstandenen eigenen Interesse den Ansprüchen gerecht werden müssen, denen sie zu ihrem Schaden unterworfen sind. Ihre Verarmung besorgen ihnen ihre Volksvertreter nur zu ihrem Besten, weil in schweren Zeiten eben viele Interessen hinter dem wichtigsten, ersten Interesse zurückstehen müssen! Das erzwungene, absurde Bedürfnis nach Arbeit bekommen die Betroffenen erläutert als das, was es unter kapitalistischen Existenzbedingungen tatsächlich ist: ihr erstes und eigentliches Lebensbedürfnis – alle ihre anderen Bedürfnisse, die sie mit dem Ertrag ihrer Arbeit befriedigen wollen, lassen sie sich als verzichtbaren Luxus schlecht machen, der in Zeiten entwickeltster Produktivkräfte einfach nicht mehr finanzierbar ist.
4.
Ein paar Recken des Wahlkampfs sind angesichts der zuerst
von CDU-CSU besetzten Parole „Sozial ist, was Arbeit
schafft!“ doch tatsächlich versucht und unverantwortlich
genug, der Versuchung nachzugeben, für einen Augenblick
den Konsens der Demokraten zu verlassen und zu
polemisieren. Die Ministerin für Bauern und Verbraucher
erinnert sich bei Köhlers Vorfahrt für Arbeit
glatt noch an Wahrheiten aus linken Vorzeiten: Das heiße
nichts anderes als Vorfahrt für die Gewinne einiger
weniger
. Vertreter der WASG finden, mit einer solchen
Definition des Sozialen könne man auch Sklaven- und
Zwangsarbeit rechtfertigen, obwohl derlei ja wirklich
niemand einführen will. Man verurteilt per Übertreibung,
und teilt eben dadurch mit, dass man sich dieser
„wirtschaftlichen Vernunft“, wenn verantwortlich und in
Maßen praktiziert, keinesfalls verschließt: Dass im
Interesse von mehr Wachstum und Arbeit Abstriche bei Lohn
und der sozialen Sicherung sowie höhere Arbeitszeiten
kein Tabu sein können, ist eben auch den Keynesianischen
Wirtschaftslenkern der neuen Linkspartei nicht fremd.
Da ist Ludwig Stiegler von der Bayern SPD schon ein anderer Kerl – wenigstens einen Tag lang: Er fühlt sich von dem Spruch an Hitler und seine populäre Arbeitsmarktpolitik erinnert und kann seine Assoziation sogar begründen: „Er betrachte den Slogan als ebenso zynisch wie die NS-Parole ‚Arbeit macht frei‘, weil damit außer Acht gelassen werde, ob eine Arbeit gerecht entlohnt werde, ob sie menschenwürdig sei, ob sie mit Kündigungsschutz und Mitbestimmung verbunden sei. Dieser Begriff von Arbeit ist ein Begriff ohne Adjektive.“ (SZ, 13.7.05) Wenn Arbeit pur zum Ziel der Politik wird – und das ausdrücklich gegen alles, was der Arbeiter von seiner Arbeit hat, dann ist das nicht weit weg vom Wahlversprechen des Jahres 1933: Damals machten die Nazis den Arbeitslosen mit einem Arbeitsdienst Eindruck, der ihnen nichts einbringen sollte als Arbeit und eine warme Suppe.
Kaum gesagt, fällt vom CDU-Generalsekretär bis zum
Kanzler und dem SPD-Parteichef die ganze Nation über den
geschichtskundigen Bayern her: Er habe den politischen
Gegner mit den Nazis verglichen, was man offenbar umso
weniger darf, je mehr die Ähnlichkeiten ins Auge stechen.
Unisono unterstreicht man die Ruchlosigkeit des
Vergleichs dadurch, dass man ihn gleich gar nicht
versteht: Ausdrücklich zitiert man in den ‚Tagesthemen‘
Hugenberg, der seit 1932 das Copyright für die
CDU-CSU-Wahlparole von heute hat – um im nächsten Zug die
absolute Unvergleichbarkeit derselben Worte von damals
und heute damit zu beschwören, dass ein ähnlicher Spruch
wie ‚Arbeit macht frei‘ über dem Eingangstor von
Auschwitz stand. Wieder erfährt man, was für eine
argumentative Produktivkraft in der Einzigartigkeit
der NS-Verbrechen steckt
: Die werden von
einem verharmlost, der in demokratischen Wahlparolen
faschistische Gesinnung entdeckt! Also werden die Opfer
der Nazis mit Verve in Schutz genommen und vor der
Ehrverletzung bewahrt, mit der Hartz-IV-Klientel der
modernen BRD auch nur irgendwie in Zusammenhang gebracht
zu werden. Als sich dazu auch noch die Vorsteher der
israelischen Kultusgemeinde zu Wort melden und vehement
gegen die Beschädigung des Opfermonopols der Juden
ankämpfen, zeigt sich, dass der Bayer Stiegler eben doch
überhaupt kein anderer Kerl, sondern auch nur ein mieser
Wahlkämpfer ist: Er entschuldigt sich für den Tritt ins
Fettnäpfchen, der ihm bei einer allzu unkontrollierten
gedanklichen Assoziation unterlaufen wäre…
Ohne Abstriche von der antisozialen Radikalität ihrer Parole zu machen, ohne überhaupt ein Wort darüber verlieren zu müssen, inwiefern sich ihr nationaler Ruf nach Arbeit sans phrase – im Interesse deutscher Arbeitsloser, die als solche dem Staat zur Last fallen, statt zum Allgemeinwohl beizutragen – von Hitlers nationalem Arbeitsprogramm unterscheidet, verbittet sich die vereinte politische Klasse mit Erfolg die ehrenrührige Zuordnung ihres Wahlversprechens zu jener dunklen Phase unserer Geschichte. Sinnig ergänzt um ein kleines Adjektiv, bleibt die nationale Losung endgültig unwidersprochen „‚Arbeit schaffen‘, das ist schön und gut. Aber nicht um jeden Preis. Wir Sozialdemokraten fordern: ‚Menschenwürdige Arbeit schaffen!‘“ (Müntefering) Wo der Nationalsozialist die Würde des Menschen in seiner fürs nationale Kollektiv nützlichen Arbeit begründet sieht, hält der sozialdemokratische Nationalist den Zusatz für angebracht, dass man in der Demokratie der Arbeit diese Würde schon noch ansehen können muss. Immerhin ein Unterschied, mit dem sich beide gut voneinander unterscheiden lassen.