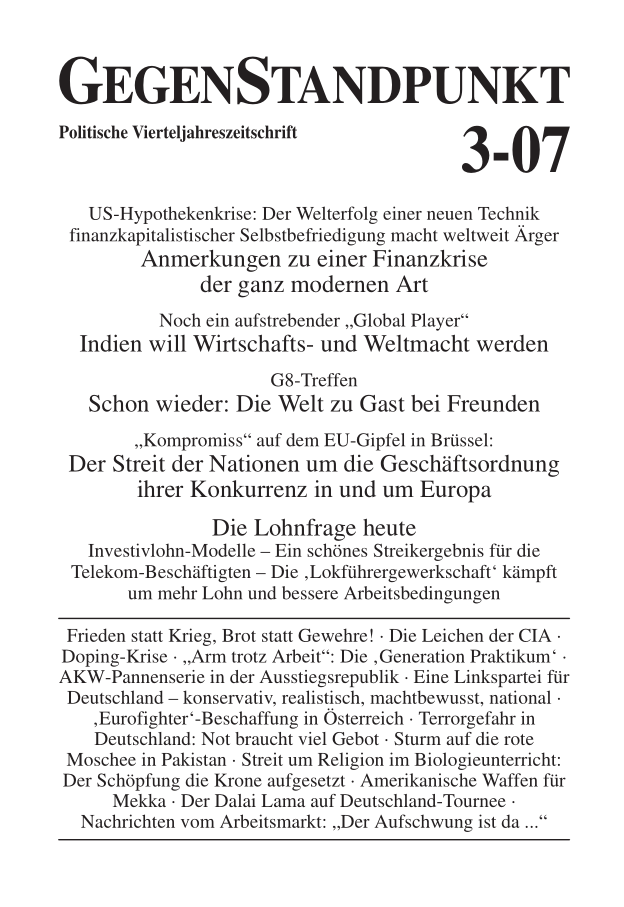Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Zum Umgang mit der Linkspartei:
Demokraten üben sich in der Pflege ihrer sprichwörtlich hochstehenden politischen Kultur
Ein nicht ganz unwesentlicher Qualitätsausweis der besten aller möglichen Staatsformen besteht ja bekanntlich darin, dass diejenigen, die sowohl mit der Regierung als auch mit den vorhandenen Oppositionsparteien unzufrieden sind, jederzeit ihre eigene Partei gründen können. Dies ist das in der Demokratie zugelassene und gilt damit auch als das einzig senkrechte Verfahren, um einem alternativen politischen Standpunkt praktische Geltung zu verschaffen. Wie es denjenigen ergeht, die dieses demokratische Postulat in die Praxis umsetzen und dabei auch noch einen gewissen Erfolg haben, ist aktuell am Umgang der etablierten Parteien und der Öffentlichkeit mit der Linkspartei zu studieren.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Zum Umgang mit der Linkspartei:
Demokraten üben sich in der Pflege ihrer sprichwörtlich hochstehenden politischen Kultur
Ein nicht ganz unwesentlicher Qualitätsausweis der besten aller möglichen Staatsformen besteht ja bekanntlich darin, dass diejenigen, die sowohl mit der Regierung als auch mit den vorhandenen Oppositionsparteien unzufrieden sind, jederzeit ihre eigene Partei gründen können. Dies ist das in der Demokratie zugelassene und gilt damit auch als das einzig senkrechte Verfahren, um einem alternativen politischen Standpunkt praktische Geltung zu verschaffen. Wie es denjenigen ergeht, die dieses demokratische Postulat in die Praxis umsetzen und dabei auch noch einen gewissen Erfolg haben, ist aktuell am Umgang der etablierten Parteien und der Öffentlichkeit mit der Linkspartei zu studieren.
1. Die Argumente der etablierten Parteien, insbesondere der SPD: „Mörder!“ „Spalter!“ „Populisten!“
Über alle Parteigrenzen hinweg wird deutlich gemacht, dass die Neuen schlicht unerwünscht sind: Sie gehören einfach nicht in die politische Landschaft der Republik. Der Vorsitzende der SPD ist sich und seiner notleidenden Partei, die nun von links Konkurrenz bekommt in Sachen Sozialdemokratie, diese Klarstellung besonders schuldig. Aber natürlich sind es nicht Gründe aus den Niederungen der Parteienkonkurrenz, die er gegen die Linkspartei geltend zu machen hat, sondern moralisch höchst ehrenwerte Gründe, die jedem anständigen Menschen einleuchten müssen:
„Dort sitzen Leute auch an maßgeblichen Stellen, die das Gebot der Freiheit mit Mauer und Stacheldraht, mit Schießbefehl beantwortet haben.“ (Kurt Beck, SZ, 25.6.07)
Dass es in Deutschland einmal einen zweiten Staat mit einer sozialistischen Staatsräson gab, der seinen Bestand mit gar nicht so unüblichen Methoden der Grenzsicherung geschützt hat, galt damals und gilt 18 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch als ein einziges Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zwar gibt es dieses andere Deutschland schon längst nicht mehr, das den Rechtsanspruch der Bundesrepublik auf ganz Deutschland allein schon durch seine Existenz verletzt hat. Aber das Feindbild, in dessen Namen man diesem Staat hierzulande die herzlichste Feindschaft angetragen hat, ist noch intakt. Es lässt sich jederzeit mobilisieren und ohne große Schwierigkeiten auf die neue Linkspartei übertragen: Der Fortbestand des mit der Existenz der DDR verbundenen Unrechts in dieser Partei ist durch die Herkunft von deren einer Hälfte aus der alten SED hinlänglich erwiesen. Da sitzen Leute, die schon damals in der SED gesessen sind, also ist diese Partei die Partei der Mauermörder. Damit ist der erste Teil der politischen Auseinandersetzung mit der neuen Partei fertig. Wofür diese Partei politisch eintritt, was ihr Programm mit dem Sozialismus der DDR oder sonst einem Sozialismus zu tun hat, ob ausgerechnet in ihr die Vorliebe für Stacheldraht an Grenzen und andere Staatsschutzmaßnahmen besonders ausgeprägt ist und ob dergleichen Vorlieben nicht eher dem Genossen Schäuble nachzusagen wären, das alles spielt keine Rolle. Es nützt der Linkspartei also auch nichts, dass sie DDR und SED so gründlich wie nur denkbar durch alle möglichen Distanzbezeugungen und Reuebekundungen „bewältigt“ hat und sich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit nicht nur „abstrakt“ aufs Grundgesetz beruft, sondern die Kompatibilität der von ihr vertretenen Anliegen mit dem Kodex der (west-)deutschen Demokratie für sie politisches Programm ist. Die Linkspartei mag verkünden, was sie will, sie wird als Nachfolgeorganisation einer SED-Nachfolgeorganisation dingfest gemacht, ist damit mit „unserer“ Demokratie nicht vereinbar und gehört grundsätzlich ausgegrenzt.
Aber es gibt sie nun einmal und sie stört mit ihrem Auftreten als Anwalt der sozial Schwachen und dem Anspruch, die wahre Partei der Sozialdemokratie zu sein. Das darf so nicht stehen bleiben. Nur, wie begegnet man als Chef der SPD, die als Regierungspartei nun schon in der zweiten Amtsperiode sozialen Kahlschlag betreibt, dem in dieser neuen Partei lebendigen und ständig präsenten Vorwurf, man würde durch seine Politik Verrat an der Sozialdemokratie begehen? Beck ist auch da um ein Argument nicht verlegen:
„Die SPD sei das sozialdemokratische Original, sagte Beck, die neugegründete Partei schade hingegen der Linken und damit auch den Menschen“. (ebd.)
‚Wir waren zuerst da!‘ – interessant, wie demokratische Politiker sich eines ‚Arguments‘ bedienen, das man ansonsten eher im Sandkasten hört. Sie reklamieren ein Monopol auf die Vertretung ihrer Stammwähler. Per definitionem ist allein die SPD dazu befugt, aus der Unzufriedenheit mit den nicht zuletzt von ihr herbeiregierten sozialen Verhältnissen Wählerstimmen zu schlagen. Daraus ergibt sich dann wie von selbst der zweite schlagende Vorwurf gegen die neue Partei: Sie ist nichts als eine Spalterorganisation
. Das sitzt und erledigt jede Prüfung der politischen Taten, welche das Original in Sachen Sozialdemokratie in jüngster Zeit vollbracht hat. Da mag der frühere SPD-Kanzler noch so sehr damit geworben haben, welch bittere Pille im Interesse der Nation gerade die Klientel seiner Partei zu schlucken habe, als ein Argument gegen die SPD und für die Linkspartei wird das nicht gelten gelassen. Wer trotzdem eines daraus macht, spaltet die in der SPD real existierende Einheit der Sozialdemokraten – auch da ist jede Nachfrage verboten, ob Spalten nicht das Beste ist, was man mit dieser SPD machen kann. Und er spaltet im übrigen nicht nur die SPD, sondern die Linke
, also genau das, was die neue Partei zu vertreten vorgibt, was in Wahrheit aber in der SPD seine Heimat hat.
Dabei ist man in der SPD, aber auch in allen anderen etablierten Parteien, jederzeit zur Stelle, wenn es gilt, der Linkspartei das ultimative Totschläger-Argument gegen jedes linke oder sonst wie abweichende Anliegen um die Ohren zu hauen: Sie vergehe sich an der „Realität“, wenn sie z. B. mehr Geld für die Rentner fordert:
„Hier wird besonders deutlich, dass Lafontaine in eine Zeit zurück will, die es nicht mehr gibt. Das ist Ideologie, aber nicht verantwortungsvolle Politik. Die alte Rentenformel ist nicht wiederherstellbar in einer Gesellschaft, in der die Menschen Gott sei Dank länger leben, andererseits die Lebensarbeitszeit relativ kürzer ist und weniger Kinder geboren werden.“ (Umweltminister Gabriel, ebd.)
Ganz und gar nicht ideologisch ist es hingegen, die von der Regierung betriebene Verarmung von Rentnern und sonstigem Volk unter Verweis auf die Geburtenrate und die höhere Lebenserwartung für unausweichlich und unwiderruflich zu erklären. Man tut so, als wäre die Sozialpolitik, die man betreibt, einfach durch die demografischen Fakten zwingend geboten, und leugnet so, dass sie in politischen Zwecken begründet ist, deren rücksichtslose Durchsetzung man sich als Regierungspartei zur Aufgabe gemacht und die man jederzeit selbstbewusst vertreten hat: Die Arbeitgeber sollten von Lohnnebenkosten befreit werden, damit die deutsche Wirtschaft im internationalen Wettbewerb noch mehr hermacht; das machte es erforderlich, dass die Kosten der Altersversorgung zunehmend von den Arbeitnehmern getragen werden und die Rentner ihren Gürtel noch etwas enger schnallen. Wenn die Linkspartei hier gewisse Abfederungen im Sinne der Betroffenen propagiert, treibt sie keine verantwortungsvolle Politik
, sondern Populismus
. Diesen Vorwurf zieht sie sich zu, weil sie sich nämlich auf die Unzufriedenheit vieler Wähler mit den Reformen nicht so bezieht, wie es der demokratische Verhaltenskodex im Allgemeinen und der Konsens der etablierten Parteien in Sachen Hartz IV etc. im Besonderen verlangt: Es ist guter demokratischer Brauch, dem Volk aufs Maul zu schauen, also die allfällige Unzufriedenheit des Wahlvolks verständnisvoll zu zitieren, sich als Anwalt derselben zu gerieren und unter Berufung auf sie die Politik zu machen, die man im Interesse der Nation für richtig hält. Wenn aber eine Partei dabei den Anschein entstehen lässt, sie lasse sich von Volkes Stimme tatsächlich die politische Agenda diktieren, gilt das unter Demokraten als grober Verstoß gegen die Tugend der politischen Verantwortung. Die verpflichtet sie nämlich auf die Exekution dessen, was im höheren Interesse der Nation notwendig ist und gebietet daher den souveränen Bezug auf den „Volkswillen“, nicht dessen Vollzug. Mit diesem Bekenntnis zum demokratischen Zynismus stellen die Etablierten klar, dass die neue Linkspartei schlicht die Art von Konkurrenz stört, mit der sie auf dem Gebiet der sozialen Frage gegeneinander antreten und in der sie gemeinsam die Alternativlosigkeit ihrer sozialstaatlichen Reformpolitik durchsetzen: Es geht in Ordnung, wenn man sich wechselseitig Fehler bei der Verwaltung der Armut vorwirft, aber das Programm der Verarmung in Frage zu stellen, ist durch und durch unverantwortlich.
2. Die Argumente der kritischen Öffentlichkeit: „ewig-gestrig“, „lächerlich“, „unseriös“
Von links droht neues Unheil
titelt die Bildzeitung am 17.6. Ihr kommt der Jahrestag des 17. Juni 1953 wie gerufen, um den Gründungsparteitag der Linkspartei tags zuvor ins rechte Licht zu rücken:
„Die Arbeiter in der DDR erhoben sich gegen ihre Ausbeutung durch die SED ... Die Linke will einen anderen Aufstand: gegen die soziale Marktwirtschaft, gegen unsere Mitwirkung im Kampf gegen den Terrorismus, gegen unsere Freundschaft mit den USA.“ (ebd.)
Die neue Partei will zwar alles andere als einen Aufstand
, sie hält bloß der SPD deren eigenes Parteiprogramm vor. Aber das ist nach Auffassung des proletarischen Zentralorgans für Antikritik schon gleichbedeutend mit einem Angriff auf unser
wunderschönes Gemeinwesen, auf das bekanntlich für alle Beteiligten so gedeihliche marktwirtschaftliche Miteinander von Arbeitgebern und -nehmern, Mietern und Vermietern usw. Immer noch bzw. sofort wieder im Schützengraben, wirft das Blatt die Systemfrage auf – Freiheit oder Sozialismus, Freund oder Feind –, und die entscheidet sich für es nicht zuletzt an der Stellung einer Partei zur amerikanischen Weltmacht und deren Antiterrorkrieg, weil der ja bekanntlich ebenso unsere
Sache ist wie die deutsch-amerikanische Freundschaft. Also ist die neue Partei eine sogar noch größere Seuche als die SED: „Die alte SED hat viel Unheil über unser Ostdeutschland gebracht. Von der Linken
droht neues Unheil für das ganze Land.“ (ebd.)
Selbstverständlich ist sich eine seriöse Tageszeitung eine stilvollere Befassung mit der Linkspartei schuldig. Und die geht so, dass man einen einfühlsamen Stimmungsbericht vom Parteitag der Linken abliefert:
„Am Flügel sitzt Konstantin Wecker, und er singt im Prinzip immer noch so, als ginge es wie damals, als es die DDR noch gab und Ronald Reagan regierte, gegen die Raketen: ‚Mach dich stark und misch dich ein.‘“ (SZ, 18.6., wie auch alle folgenden Zitate)
Ja damals, gegen einen US-Präsidenten, der mit seinem Rüstungswahnsinn die Existenz Deutschlands aufs Spiel setzte, da war die Aufforderung, sich einzumischen, vielleicht noch angebracht – findet die SZ zumindest heute, 20 Jahre später. Aber heute, bloß wegen der paar kleinlichen materiellen Sorgen in Gestalt von Hartz IV, wirkt sie auf den stellvertretenden Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung einfach lächerlich. Er hat sich dafür entschieden, die Linkspartei im Wortsinn alt aussehen zu lassen, und verfährt auch da nach dem bewährten Grundsatz journalistischer Antikritik, dass man Politiker immer nach den Maßstäben beurteilen muss, nach denen sie beurteilt werden wollen: Und so etwas will eine „neue Kraft“ sein! Wer sich einen Liedermacher einlädt, der wie vor 20 Jahren singt, ist ja so was von endout. Schaut sie euch nur an, die
„eher reifen Körper“ von „Lothar, Oskar und Gregor ... Wir nennen sie jetzt mal beim Vornamen, weil wir uns auf einem Parteitag befinden, der gleichzeitig den Geist des solidarischen Sozialismus (‚Du, Genosse‘) und den Geist der westdeutschen Wohngemeinschaft (‚Ey du, Bärbel, ey‘) atmet.“
Kein Aufbruch also, nirgends. Wo man den von einer neuen Partei ja wohl erwarten kann. Stattdessen schlägt dem Herrn SZ-Redakteur der miefige Geruch von Wohngemeinschaften entgegen, den er noch nie leiden konnte. Und dann sagt diese Partei auch noch immer und überall bloß Nein! Das spricht doch wohl schon für sich:
„Niemalszufriedene ist ein ganz guter Begriff für jene rund 800 Delegierten, ... Die neue Partei lehnt, zumindest offiziell und wenn sie nicht gerade in einer Landesregierung ist wie in Berlin, vieles, sehr vieles ab, was die anderen Parteien vertreten.“
Für Herrn Kister unvorstellbar, dass es für ein ablehnendes Urteil so etwas wie ernst zu nehmende Argumente geben könnte. Dabei beherrscht diese Partei noch nicht einmal das Neinsagen richtig und verstößt gegen die einfachsten Grundregeln politischer Agitation, die der Experte für revolutionäre Rhetorik aus der SZ-Redaktion Lothar Bisky leicht hätte beibringen können. Aber was macht der stattdessen?
„In der Haltung der Schildkröte, den Kopf zwischen die Schultern gezogen“, tritt er auf, und „eine seiner beiden Reden auf dem Parteitag schließt mit dem Satz: ‚Hier ist die Linke.‘ Der müsste eigentlich gerufen werden, laut, in Versalien und mit Betonung auf jeder einzelnen Silbe: ‚HIER IST DIE LIN-KE! Bei Bisky kommt in etwa heraus: ‚HierIstdielinke.‘ Danke, setzen.“
Lauter Oberlehrer haben sich da also versammelt, Stubenhocker, Bürokraten und Biedermänner, anstatt knackige Bolschewisten, die nicht lange fackeln:
„Außerdem führt man endlose Geschäfts- und Wahlordnungsdebatten, was ein identitätsstiftendes Merkmal aller revolutionären Parteien in Deutschland war, ist und auf alle Zeiten sein wird. Auch diese Linke würde, käme es zum Umsturz, erst einmal eine Bahnsteigkarte lösen, und zwar quotiert, bevor sie den Bahnhof stürmte. Noch wahrscheinlicher ist allerdings, dass man anstatt den Sturm einzuleiten, ein Papier verfassen würde, warum die Bahn wieder in Gemeineigentum überführt werden muss.“
Da schmunzelt der Reaktionär, der schon bei kurzen Eisenbahnerstreiks den Bestand Deutschlands gefährdet sieht und nach dem Arbeitsrecht ruft, wenn er in der Pose des Insiders in Sachen Weltrevolution mit kosmopolitischem Flair der deutschen Linken ihren immerwährenden Legalismus hinreiben kann. Damit sind dann die Neuen auch unter diesem Gesichtspunkt als Versager gebrandmarkt. Obendrein sind sie auch noch unglaubwürdig, weil ihnen Herr Kister ihre politischen Bekenntnisse nicht glaubt. Da mag Lafontaine noch so betonen, wie sehr er sich dem Erbe derer verpflichtet fühle, die als Sozialdemokraten ... in der DDR eingesperrt waren
, also für die Opfer von einst
Partei ergreifen. Für Herrn Kister steht er auf der Seite der Täter:
„Er blendet aus, dass er jetzt Chef einer Partei ist, in der die Sympathien für ... die Partei der einstigen Verfolger noch ziemlich groß ist.“
Im übrigen ist er ein Machtmensch, ... der eine Welt aufbaut, in der allein seine Partei, also er recht hat
. Was in seinem Fall natürlich gegen ihn spricht und ihn nicht als Mann mit Führungsstärke und gesundem Machtbewusstsein auszeichnet, woran sich für die demokratische Presse sonst die Eignung für politische Ämter zeigt. Im Feuilletonteil derselben Ausgabe wird aus dem charismatischen Rhetoriker
von einst, als er noch SPD-Parteivorsitzender war, dem Bonvivant
, der französische Spitzenweine zu genießen versteht, ein Dauerbeller, ... mit rotweinrotem Gesicht herumschreiend
. Eine wirklich seriöse Kritik also. Man versagt dem Chef der neuen Partei schlicht den Respekt, den man den Vertretern der politischen Eilte üblicherweise zollt und mit dem man sie dem Publikum als vertrauenswürdige Personnage der Herrschaft empfiehlt. Personenkult umgekehrt.
*
Es gibt aber auch andere Stimmen.
Polemik der Öffentlichkeit und Vernichtungsfantasien der politischen Konkurrenz hin oder her: Mit jeder Wählerumfrage, mit jedem Eintritt eines verdienten SPD-Mitglieds wird der Linkspartei eine steigende Akzeptanz bescheinigt und sie wird zum Objekt von Koalitionskalkulationen, wenn nicht zum Adressaten entsprechender Angebote. Im Berliner Senat ist sie ja auch schon in einer rot-roten-Koalition an den Regierungsgeschäften beteiligt. Auch Leitartikler nehmen zur Kenntnis, dass die Neuen sich wohl fürs erste etabliert haben. Und das bleibt nicht ohne Einfluss auf ihren Standpunkt zu dieser Linkspartei; und sogar ihr politisches Urteil über sie bleibt interessanterweise davon nicht ganz unberührt. Bei aller Abneigung und Ablehnung geht eben der Opportunismus der politisch maßgeblichen wie der meinungsbildenden Demokraten nicht verloren. Wenn die Neuen schon nicht kleinzukriegen sind, dann gilt es sie als Machtfaktor in der Parteienkonkurrenz zu funktionalisieren. Und das scheint so manchem strategisch denkenden Kopf auch die wirksamere Methode zu sein, sie wieder auf Normalmaß zu schrumpfen
. Z. B. dem SZ-Kommentator Christoph Schwennicke, der den Umgang der etablierten Parteien mit der Linkspartei 3 Wochen später überhaupt nicht mehr für überzeugend hält:
„Was der SPD bisher als Antwort darauf einfällt, was im Grunde allen Parteien dazu einfällt, ist enttäuschend wenig. Sie verteufeln, sie ächten, sie schmähen. Und je mehr sie das machen, umso schneller laufen die Sympathisanten über ... Schluss mit dem Versuch der Ignorierung, Schluss mit der kindisch wirkenden Behandlung Lafontaines als Unperson.“ (SZ, 7.7.)
Ächten und Ignorieren sind für ihn blamable Formen der politischen Auseinandersetzung – wenn sie nicht verfangen. Und dass sie nicht verfangen, sieht man ja an jeder Wählerumfrage.
„Die Auseinandersetzung muss daher auf einer anderen Grundlage als bisher geführt werden... Die Existenz der Linken, ihr bis auf weiteres fester Platz im parlamentarischen Spektrum muss von allen Parteien als Tatsache akzeptiert werden.“
Und wenn sie das tun, werden sie sehen, was der SZ-Kommentator jetzt schon sieht:
„Sie ist nicht weniger eine demokratische Partei als die anderen im Bundestag vertretenen auch.“
Sein Publikum soll sich da nichts vormachen, lautet seine Botschaft: Die politischerseits und von seinesgleichen lancierten Urteile, denen zufolge es sich bei der Linkspartei um ein undemokratisches Monster mit einem Faible für menschenverachtende Diktaturen handelt, sind natürlich nur für die Parteienkonkurrenz erfundene nützliche Lügen, die man auch mal wieder zu lassen hat, wenn es nicht mehr opportun ist. Ihm scheint es günstiger, sich dieser Partei so anzunehmen:
„Sie ist bloß eine weniger seriöse Partei. An dieser Stelle muss man sie treffen ... Die politische Konkurrenz, und dabei zuerst die SPD, muss die Linke aus der Schonung der Opposition holen und auf die Lichtung der Verantwortung stellen. Das heißt in letzter Konsequenz, dass Koalitionen nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werden dürfen ... Bereits der Bundestag erweist sich oft als Prüfstand der Linkspartei ... Das Parlament als Ort der Entzauberung reicht aber nicht. Wer sich auf Totalopposition spezialisiert und dort eingerichtet hat, muss von den anderen in Richtung Exekutive gezerrt werden ... Nur so kommt die SPD aus der Defensive ... Wo ist die PDS/Linkspartei erfolgreich geschrumpft worden? Dort, wo sie mitregiert ... Umarmen statt ausgrenzen ... Man muss die Linke ernst nehmen, auf den (Koalitions-)Prüfstand stellen, kühl sezieren. Nur so geht es.“
Mit allen anderen, die eine Regierungsbeteiligung noch immer für die verlässlichste Methode halten, Oppositionsparteien zu entzaubern, ist sich der SZ-Kommentator nämlich in einem unverschämt sicher: dass sich jede Partei, die eine sozialere oder friedlichere Politik betreiben will und mit entsprechenden Versprechen auftritt, an der Natur des Staatswesens, das sie regieren will, die Zähne ausbeißt.