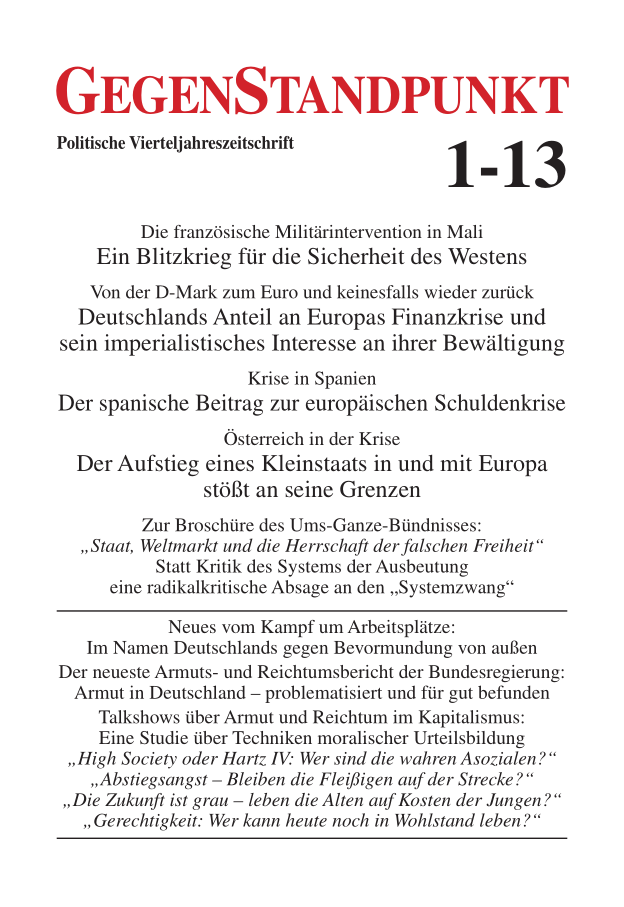Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Maischberger, Will, Plasberg und Jauch kümmern sich um Armut und Reichtum im Kapitalismus
Eine Studie über Techniken moralischer Urteilsbildung
Anlässlich des regierungsamtlichen „Entwurfs des 4. Armuts- und Reichtumsberichts“ widmen sich gleich vier Talkshows der Sache: „High Society oder Hartz IV: Wer sind die wahren Asozialen?“ (Maischberger) „Mittelschicht in Abstiegsangst – Bleiben die Fleißigen auf der Strecke?“ (Will) „Die Zukunft ist grau: Leben die Alten auf Kosten der Jungen?“ (Plasberg) „Wer kann noch in Wohlstand leben?“ (Jauch) So die Themen, die sich um ein und dieselbe Frage drehen: Geht die Verteilung von Armut und Reichtum hierzulande in Ordnung?
Das zeugt von professioneller Ignoranz: Keine Diskussion wirft einen Blick auf die Sphäre, in der Reichtum und Armut zustande kommen. In der Verteilungsfrage von heute ist offensichtlich jede Erinnerung an die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums, mit der über dessen Verteilung grundsätzlich entschieden ist, und jedes Bewusstsein von einem Gegensatz von Kapital und Arbeit getilgt. Was bleibt dann?
Eine
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Sandra Maischberger: High Society oder Hartz IV: Wer sind die wahren Asozialen?
- Für Buschkowsky sind asoziale Arme Produkt des Sozialstaats
- Für Wüllenweber sind die Reichen noch schlimmer
- Renan Demirkan hält manche Äußerungen von Heinz Buschkowsky für rassistisch
- Helena Fürst verteidigt die Armen gegen die Asozialen in den Ämtern
- Czentarra zeigt, dass jeder eine Ausnahme ist
- Krafts Apologie der Reichen
- Anne Will: Mittelschicht in Abstiegsangst – Bleiben die Fleißigen auf der Strecke?
- Kathrin Fischer, Journalistin, Pressesprecherin und lebender Beweis dafür, dass die Mittelschicht nicht mehr gerecht entlohnt wird
- Patrick Döring von der FDP kennt nichts Ehrbareres als die gesellschaftliche Leistung des Unternehmertums
- Michael Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat herausgefunden, dass nichts so gerecht ist wie unverfälschter marktwirtschaftlicher Wettbewerb
- Für Sahra Wagenknecht verfälscht eine verkehrte Politik das schöne Prinzip der Leistungsgerechtigkeit
- Uwe Huck, Betriebsratschef von Porsche, beschwört die Rückkehr des Anstands im Unternehmen
- hart aber fair: Die Zukunft ist grau – leben die Alten auf Kosten der Jungen?
- Blacky Fuchsberger über die Tugend der Tatkraft in der Not
- Michelle Müntefering über die Tugend, unaushaltbare Lebensumstände auszuhalten
- Wolfgang Gründinger über die Tugend der Solidarität
- Leonhard Kuckart über die Tugend der Verständigungsbereitschaft
- Klaus Hurrelmann über die Tugend von Realismus und Respekt
- Günther Jauch: Eine Frage der Gerechtigkeit: Wer kann heute noch in Wohlstand leben?
- Fazit
Maischberger, Will, Plasberg und Jauch kümmern sich um Armut und Reichtum im Kapitalismus
Eine Studie über Techniken moralischer Urteilsbildung
Mitte September 2012 macht die Süddeutsche Zeitung den vom Bundesarbeitsministerium erstellten „Entwurf des 4. Armuts- und Reichtumsberichts“ publik und befördert so die aktuelle, regierungsamtliche Bestandsaufnahme der sozialen Lage in Deutschland
für ein paar Tage zum Top-Thema des Parteienstreits und der diesen kritisch begleitenden Öffentlichkeit. Ihren Beitrag zu diesem von oben angezettelten öffentlichen Diskurs – die Minderbemittelten in Deutschland waren insoweit nicht zu vernehmen – steuern gleich vier Talkshow-Redaktionen der ARD bei. Sie machen binnen einer Woche den neuen alten gesellschaftspolitischen Problemschlager von Armut und Reichtum in der Marktwirtschaft zum Gegenstand der von ihnen geladenen Diskussionsrunden:
Wo Arm und Reich so radikal auseinander klaffen, da gibt es für Sandra Maischberger zwei gesellschaftliche Randgruppen, die sie zur Auswahl stellt, um von ihren Gästen ermitteln zu lassen, wer sich ganz und gar am Wohlstand der Nation vergeht: High Society oder Hartz IV: Wer sind die wahren Asozialen?
Und wenn es schon bei Arm und Reich darum geht, ob und inwieweit die deutsche Gesellschaft als Ganzes darunter leidet, dann sorgt sich Anne Will um deren tragende Säule: Mit der Frage Mittelschicht in Abstiegsangst – Bleiben die Fleißigen auf der Strecke?
thematisiert sie das Schicksal all derer, die sich mit viel Leistung für wenig Ertrag redlich um ihr Auskommen bemühen. Frank Plasberg fokussiert das Thema auf Die Generationen-Debatte
, legt seinen Gästen also einen jedem Fernsehzuschauer wohlbekannten Streit als den Kern des Problems zur Diskussion vor und provoziert mit vorderhand eindeutiger Stoßrichtung: Die Zukunft ist grau: Leben die Alten auf Kosten der Jungen?
Schließlich steuert Günther Jauch zielstrebig darauf zu, dass hier nicht weniger als eine gesellschaftliche Grundsatzfrage im Raum steht, die wirklich jeden betrifft und angeht, nämlich Eine Frage der Gerechtigkeit
, die da lautet: Wer kann noch in Wohlstand leben?
Mit seiner Themenstellung gibt der Vorzeigemann der ARD fast schon erschöpfend Auskunft über den gemeinsamen Nenner aller vier Sendungen: Sie handeln vom Nebeneinander von Armut und Reichtum in der modernen kapitalistischen Gesellschaft – und dem Reim, den einer sich darauf machen soll. Wo es darum geht, ob die Fleißigen
von ihrem Fleiß denn auch etwas haben, ob die Alten den Jungen was wegnehmen oder umgekehrt, ob die Superreichen oder die Sozialschmarotzer auf Kosten von uns allen leben und wer überhaupt vom gesellschaftlichen Wohlstand
wie viel abbekommen soll – die dem Publikum offerierte Themenstellung dreht sich immer um ein und dieselbe Frage: Geht die Verteilung von Armut und Reichtum hierzulande in Ordnung? Unter einem beliebig herausgegriffenen, aber in jedem Fall irgendwie anerkannten Gesichtspunkt werfen alle Talkshow-Macher in ihrer Runde die Frage auf, welcher gesellschaftliche Charakter in welchem Maße gerechterweise am gesellschaftlichen Reichtum partizipieren darf, wobei eine Unterstellung immer mitschwingt: Es wird immer schwieriger, diesem Verteilungsproblem gerecht zu werden; denn in Zeiten von Wirtschafts- und Eurokrise
wird der allgemeine Wohlstand immer fraglicher…
Diese Gemeinsamkeit hat einen Grund. Er liegt in der Ignoranz gegenüber dem Grund der Verteilung, an der alle Talk-Runden herumproblematisieren. Alle handeln von Armut und Reichtum in Deutschland – aber in keiner von ihnen wirft man einen Blick auf die Sphäre, in der beides zustande kommt, auf die Produzenten des Reichtums in den Fabriken, auf die Unternehmer, denen dieser Reichtum gehört, und auf den Streit dieser politökonomischen Charaktere um eben diesen Reichtum. Ein Gewerkschafter, der auf der klassischen Gerechtigkeitsfrage in Sachen gesellschaftlicher Reichtum und seiner Verteilung, der des ‚gerechten Lohns‘, bestehen würde, ist – soweit sich noch einer gefunden hätte – als Diskutant nicht geladen. Der Interessenkonflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital, der Kampf ums Geld als dem Zugriffsmittel auf den Reichtum, der an rentablen Arbeitsplätzen produziert wird, hat in der ARD-Themenwoche keinen Platz. Die ideologische Verwandlung marktwirtschaftlichen Produzierens in ein Verteilungsproblem ist weit gediehen: In der Verteilungsfrage von heute ist jede Erinnerung an die kapitalistische Produktion des gesellschaftlichen Reichtums, mit der über dessen Verteilung ganz grundsätzlich entschieden ist, und jedes Bewusstsein von einem Gegensatz von Kapital und Arbeit getilgt.
Was bleibt denn dann?
Eine Studie über Techniken moralischer Urteilsbildung
Sandra Maischberger: High Society oder Hartz IV: Wer sind die wahren Asozialen?
Zu den im Armuts- und Reichtumsbericht angesprochenen Einkommens- und Vermögensverhältnissen in Deutschland fällt Maischberger das Stichwort asozial
ein. Damit gibt sie die Ebene vor, auf der sie Arm und Reich problematisiert haben möchte: Wo von diesen zwei ökonomischen Stellungen an den beiden Extremen der gesellschaftlichen Einkommenshierarchie die Rede ist, möchte sie eine Prüfung der moralischen Einstellungen haben, die die oberen Zehntausend und die Millionen von Sozialfällen an den Tag legen. Wenn die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden, liegt für diese Talkshow der Verdacht nahe: Sind da Figuren unterwegs, die gegen die Sitten verstoßen, deren Einhaltung die Gesellschaft von ihnen verlangt? Lassen sie es an der Quintessenz aller Moralität fehlen – am Willen, sich mit Anstand und Tüchtigkeit produktiv „ins große Ganze“ einzugliedern? Oder wollen sie vielmehr an ihm schmarotzen?
Dabei enthält Maischbergers Fragestellung – wie es sich für eine kritische Talkmasterin gehört – eine Provokation: Bei ihr werden nicht nur die Hartz-IVler unter den Verdacht gestellt, asozial zu sein; von diesen Objekten der staatlichen Elendsverwaltung denkt das ohnehin so ziemlich jeder, kriegen sie doch von der Gesellschaft ein Existenzminimum „spendiert“. Aber die Superreichen? Ihnen mag man vielleicht Angeberei und Verschwendungssucht nachsagen, aber keiner mag die „High Society“ – das sind die besagten Superreichen, sobald sie ihren Reichtum genießen und standesgemäß zur Schau stellen – so schnell als „asozial“ beschimpfen. Mit dieser Gleichsetzung von Überfluss und Elend in Form eines gleichmäßig verteilten Verdachts auf parasitäres Verhalten stellt Maischberger die Weichen: In ihrer Sendung soll es ganz objektiv und vorurteilsfrei zugehen, wenn man sich auf die Suche nach Schmarotzern begibt.
Das Ganze lebt zugleich von einem riesigen Kompliment an „die Mitte“. Auch wenn diese beliebte Figur in der Themenstellung gar nicht explizit zur Sprache kommt, so bildet sie doch in dieser Perspektive das Maß aller Dinge. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass sie als der sozioökonomische Durchschnitt zum Inbegriff der gesellschaftlichen Normalität erklärt wird, von dem aus Arm und Reich überhaupt zu „Extremen“ werden. Wo die soziale Außenstellung weit oben wie weit unten die Vermutung einer moralischen Abseitsstellung nach sich zieht, da liegt der ganz große Rest nicht nur in ökonomischer Hinsicht dazwischen, sondern auch in moralischer Hinsicht vollkommen richtig.
Den Anfang macht ein Gast, der in den letzten Jahren mit seinen Aussagen über die Mitglieder der Unterschicht – vor allem über die mit „Migrationshintergrund“ – für einiges Aufsehen gesorgt hat:
Für Buschkowsky sind asoziale Arme Produkt des Sozialstaats
Als Bezirksbürgermeister von Neukölln hat es Heinz Buschkowsky jeden Tag mit dem unteren Rand der Gesellschaft zu tun: 80-90 % der Schüler im Hartz-IV-Bezug
. Und was er da mit eigenen Augen sieht und am eigenen Leib erfährt, macht ihn zu einem ausgewiesenen Experten in Sachen Armut und Arme. So hautnah, wie er diese Kreaturen tagtäglich erlebt, kann man ihm kaum widersprechen, wenn er zum sachlich-nüchternen Befund kommt: Arbeitslose, vor allem Migranten, leben am Schnuller des Staates
. Mit diesem denunziatorischen Bild von erwachsenen Menschen, die sich wie Babys vom Staat durchfüttern lassen, sind die ökonomische Lage von Arbeitslosen und ihre sozialstaatliche Betreuung für ihn auf den Begriff gebracht:
„Es gibt für mich keine sinnvolle Begründung, dass ein gesunder junger Mann von 22 Jahren langzeitarbeitslos ist. Diese Begründung würde ich gerne mal hören!“
Die Begründung wäre zwar leicht zu haben: Arbeitslose gibt es, weil die Masse der Bevölkerung unter die Rubrik „abhängig Beschäftigte“ fällt, die nur dann eine Anstellung finden, wenn sich ein Unternehmer von ihrer Arbeit die Vermehrung seines Geldes verspricht. Gemessen an diesem unternehmerischen Bedarf nach rentabel auszunutzender Arbeit gibt es eine ganze Menge Arbeitsuchende, die schlicht überflüssig sind, und sämtliche Institutionen zur Betreuung der Arbeitslosen künden davon, wie felsenfest der Staat mit der steten Existenz solcher überflüssig gemachten Menschen auf allen Altersstufen rechnet. Aber die Begründung, nach der Buschkowsky sucht, ist von vornherein etwas anders gestrickt. Er will von den Arbeitslosen eine Rechtfertigung für ihre Arbeitslosigkeit hören – und der Satz, den er seiner Forderung voranstellt, macht deutlich, dass die nicht zu leisten ist. Klar, Schicksalsschläge
– die ganz zufällig immer die gleiche Klasse treffen – mag es geben, und dafür ist der Sozialstaat eine tolle, solidarische Sache
. Aber wenn sich dieser Status hinzieht, dann wollen diese Menschen das so, dann haben sie ihr Leben in diesem Status selbst entworfen
. Dafür muss Buschkowsky den Willen, den er da vorfindet, schon etwas umdeuten: Wenn sich Arbeitslose – wie überhaupt alle Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft – an die Lebenslage anpassen, die ihnen aufgezwungen wird, um daraus das Beste zu machen, dann sieht er darin das Resultat einer freien Entscheidung, eines selbst entworfenen Plans, nach dem einer zu leben trachtet. Dass das Sich-Einrichten von Hartz-IVlern in ihrer elenden Lage nichts anderes ist als das Lebensprogramm, es sich bequem machen zu wollen – dafür stehen schon deren Klagen:
„Ich bin arbeitslos, weil das Job-Center mir keinen Job besorgt; die Noten meines Kindes sind schlecht, weil die Schule schlecht ist, weil der Lehrer schlecht ist. D.h. ich suche mir immer einen Schuldigen für mein eigenes Wohlergehen ... das hat nichts damit zu tun, dass der Einzelne eigentlich einen Lebensentwurf macht und nach diesem Lebensentwurf strebt, dass er einen Aufstiegswillen hat und sich an seinen eigenen Erfolgen erfreuen will und auch Niederlagen ertragen muss... Es geht um den Leistungswillen.“
Die Art und Weise, wie diese Typen sich über ihre Lebenslage beklagen, ist ein eklatanter Verstoß gegen Buschkowskys Forderung nach einem Lebensentwurf, der alle Schranken und Niederlagen als Ermunterung nimmt, genau so weiter einen Aufstieg anzustreben. Weil das die fraglos gültige Lebenseinstellung ist, sprechen für ihn die zitierten Klagen nur dafür, wie zufrieden diese Typen letztlich mit dem Leben sind, das sie für sich da ausgesucht haben. Und nachdem Buschkowsky die Behauptung weit von sich weist, er würde alle in Hartz IV und alle Migranten zu Schmarotzern erklären, vielmehr nur die Feststellung eines Zustands
präsentieren, den er aus seinem eigenen, hautnah erlebten Abschnitt der Hauptstadt kennt, steht die Allgemeingültigkeit seines Befunds fest und ist seine Message hieb- und stichfest: Neukölln ist überall!
Schlimm genug, wie sich vor allem die Migranten in der Unterschicht aufführen, doch sie sind nicht das primäre Ziel von Buschkowskys Kritik. Er will ja nicht Menschen kritisieren, sondern menschliche Verhaltensweisen
– und da hat er vor allem den Sozialstaat im Visier, der diese Verhaltensweisen
überhaupt ermöglicht, indem er sich als Schnuller
anbietet. Seine Abteilung „Soziales“ ist die Brutstätte der Asozialen. Um diese seine Hauptkritik loszuwerden, bringt er sogar einiges an Verständnis auf für die Migranten, die ins deutsche Sozialsystem einwandern und sich dort einnisten – freilich vom verachtungsvollen Standpunkt eines hoheitlichen Verwalters, der ihr Verhalten als das Produkt seines Umgangs mit ihnen sieht:
„Ich werfe den Migranten nichts vor, ich werfe der Gesellschaft vor, eine ungesteuerte Einwanderung zugelassen zu haben. … Wir haben eben einen Großteil von Menschen, die aus grauenvollsten Lebens- und Kulturverhältnissen kommen, und wenn die in Deutschland ankommen, im Sozialsystem, ist das für sie ein unglaublicher Sprung, ein Quantensprung ihrer Lebensqualität, und von daher entsteht dort nicht mehr der Leistungsdruck: Ich will jetzt aufsteigen. Sie sind aufgestiegen, und insofern wird das Sozialsystem erstmal als eine gesunde Lebensgrundlage adaptiert. Ich bekomme Geld und kann besser leben als zuhause. Das führt ... zu einem Wohlfühleffekt.“
Eine mannhafte Verteidigung der armen Migranten, die Buschkowsky kein einziges Mal und an keiner Stelle
asozial nennt: Gegen diese Leute hat er nichts, man hat sich nur nicht genug gegen sie abgeschottet! Sein Verständnis für diejenigen, die es geschafft haben, durch diese viel zu großen und viel zu undichten Stellen in Deutschland einzusickern, spricht außerdem Bände über die Tugend, die Buschkowsky von der arbeitslosen Unterschicht – von Einheimischen wie von Migranten – erwartet, wenn er von ihnen Leistungswillen
sehen will: Der vielgepriesene Wille zum Aufstieg, zum eigenen Lebensentwurf und zu dessen erfolgreicher Durchführung – all das basiert auf der gesunden Grundlage einer gefühlten Not. Der Sozialstaat macht die Lage dieser Menschen einfach zu wenig grauenvoll
, verschafft ihnen im Gegenteil eine viel zu gesunde Lebenslage
, macht sie also zufrieden – und unterstützt damit eine Lebenseinstellung, die Buschkowsky gleich in einen großen kulturkritischen Rahmen stellt:
„Ich glaube, dass unsere Gesellschaft an sich auf einem gefährlichen Kurs ist, weil wir verlassen immer mehr die Verantwortung jedes Einzelnen, die er erst einmal hat für sein Leben.“
Für Wüllenweber sind die Reichen noch schlimmer
„Die Unterschicht ist gar nicht unser großes Problem, sagt ein anderer meiner Gäste. Er sagt, die Oberschicht ist das eigentlich dicke Problem, denn da sind Menschen, die ohne eigene Leistung immer reicher werden und sich der Verantwortung im sozialen Bereich komplett entziehen. Der Stern-Journalist Walter Wüllenweber.“
Auch der zweite Gast sieht sich in aufklärerischer Mission unterwegs. Zwar gibt er Buschkowsky vollkommen recht darin, dass es in der Unterschicht von Asozialen, die von der Gemeinschaft Leistungen in Anspruch nehmen, ohne selber Leistung zu erbringen, nur so wimmelt. Aber wenn man schon auf die Welt so blicken sollte, dass es in ihr darauf ankommt, Leistungswillen aufzubringen und Leistung zu erbringen – wofür oder wobei auch immer –, dann gilt eben: Neukölln ist überall!
Und zwar nicht nur in anderen Elendsvierteln wie Berlin-Marzahn oder Hellersdorf
, wo der Migrantenanteil sich eher im homöopathischen Bereich bewegt, sondern auch in der obersten Oberschicht. Deren guter Ruf gehört demontiert – und dazu präsentiert Herr Wüllenweber ein schwer zu überbietendes Meisterwerk des investigativen Journalismus: Es gibt tatsächlich Leute, die stinkreich werden, ohne etwas dafür zu leisten! Die sind die wahren Asozialen
:
„Von der Oberschicht haben wir ein völlig falsches Bild! Das falsche Bild, das wir von der Oberschicht haben, ist, dass das angeblich die Leistungsträger sind, die unsere Gesellschaft nach vorne bringen und dass die so viel arbeiten. Tatsächlich ist es so, dass die Oberschicht im Wesentlichen von ihrem Vermögen lebt, d.h. sie lebt von dem, was sie an der Börse spekuliert, nämlich was ihre Vermögensverwalter machen. Und das Geld ist leistungsloses Einkommen.“
Nicht nur erbringen sie keine produktive Leistung für die Gemeinschaft, sie raffen nicht einmal selber! Wüllenweber will weder Spekulationsgewinne beanstanden noch einem Aufstand ausgebeuteter Börsenmakler das Wort reden. Er will einfach nur sagen: Die richtig Reichen – nehmen wir z. B. die Familie Quandt
– tun da gar nix!
Aber schon das ist offenbar zu viel Ökonomie für eine Gesprächsrunde, in der es bei Armut und Reichtum nur insoweit um die Produktionsweise geht, als die Einstellung ihrer Figuren zu ihr auf dem Prüfstand steht – die Moderatorin interveniert:
„Was ist daran eigentlich asozial? Ich kann mir ja vorstellen, dass man sagt: ‚Das gehört sich nicht.‘ Aber was, bitte schön, ist daran asozial? Denn das heißt, dass das einen Bezug zur Gesellschaft hat, und zwar einen schlechten. Wo ist das Problem?“
Auch hier hat der Journalist eine tiefschürfende Analyse zu bieten:
„Ein Teil der Unterschicht lebt in einer Parallelwelt, zu der wir von der Mittelschicht kaum noch Kontakt haben. Und wir haben eine zweite Parallelgesellschaft, die ist am oberen Rand der Gesellschaft. Auch die beteiligen sich an der Gesellschaft kaum noch, auch die leben nach eigenen Wertvorstellungen, die sich abgekoppelt haben von der Mehrheit.“
Soll man den besorgten Journalisten fragen, wie er sich diesen Kontakt
vorstellt, den es bis gestern gegeben hat? Will er die Armen und Verwahrlosten wenigstens wieder zu Gesicht bekommen? Vermisst er die Zeiten gesellschaftlicher Beteiligung, in denen die Reichen mit ihren Maseratis zu Aldi gefahren sind? Nach eigenen Wertvorstellungen
– meint er damit, dass diese Randgruppen nicht nach seiner Einbildung leben, wonach Einkommen und Auskommen eigentlich nur denen zustehen, die ihre Zeit mit produktiven Leistungen für das Große Ganze erbringen, ungefähr so, wie er sich die Hauptgruppe zwischen den Rändern vorstellt? Wie dem auch sei: In der Talkshow geht es nicht um die real existierende Gesellschaft und ihre Ökonomie, sondern um ihren moralischen Kern – und was den betrifft, lautet die ziemlich tautologische Botschaft: So, wie die ganz Reichen leben, ist das nicht normal! Sie sind gar nicht mehr in der Mitte! Das macht sie sogar noch schlimmer als die Hartz-IVler, denen es mit ihrem leistungslosen Einkommen
wenigstens schlecht geht.
So spricht Wüllenweber eine materielle Beschwerde im Namen der Mitte aus – und macht dabei explizit, wovon die ganze Sendung implizit lebt:
„Und wir merken jetzt, wir Mittelschicht müssen die Schutzschirme halten – über unsere Steuergelder – über die Vermögen der Reichen und müssen auch das soziale Netz tragen. Und jetzt merken wir, wie schwer das ist. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum trotz der wirklich großartigen ökonomischen Situation in Deutschland die Mittelschicht das Gefühl hat: Bei uns kommt gar nichts an.“
Die tüchtige und gesellschaftsdienliche Mittelschicht muss für die Schmarotzer geradestehen, die ihr nur das Leben schwer machen. Die „Anständigen“ buckeln sich krumm und haben nichts davon, weil sie Asoziale „unten“ und vor allem auch „oben“ auszuhalten haben.
*
Buschkowsky und Wüllenweber haben bisher gezeigt, dass Maischbergers Frage selbst die Antwort ist: Selbstverständlich sind beide Ränder der Gesellschaft asozial! Die Anklage ist damit erhoben – und sie bleibt nicht unwidersprochen.
Renan Demirkan hält manche Äußerungen von Heinz Buschkowsky für rassistisch.
Denn für die soziale und sittliche Abseitsstellung der Migranten auf Hartz IV macht Buschkowsky ihre Herkunft verantwortlich:
„Das ist alles tendenziös und er ist damit ganz in der Nähe seines Parteifreundes Sarrazin, und deswegen ist es die Ursuppe des Rassismus. Obwohl er sich davon distanziert, weil er werte die Menschen nicht ab ... Er wertet sie ab. Und das ist, was Buschkowsky macht und was latent hochgefährlich ist. Er tut so, als wäre er ein Menschenfreund, ist aber immer dabei, sozusagen die Migrationskeule auszufahren, als wären die Migranten selbst schuld daran.“
So richtig ihren Finger darauf legen, inwiefern sich Buschkowsky mit seinen vielen Äußerungen über die Migranten aus der Unterschicht einer rassistischen Gesinnung schuldig macht und was genau daran zu kritisieren wäre, mag die antirassistische Schauspielerin und Autorin nicht. Buschkowsky befindet sich jedenfalls ganz in der Nähe
eines eindeutig überführten Rassisten; vielleicht pflegt er selbst nicht ein eindeutig rassistisches Weltbild, aber er rührt definitiv in dessen Ursuppe
– zumindest der Tendenz nach. Und das macht ihn ganz klar – jedenfalls latent
– zu einer Gefahr fürs Gemeinwesen. So rückt sie Buschkowsky ganz in die Nähe einer Kardinalsünde, die in der Demokratie so weitverbreitet wie verpönt ist – und sie verlässt sich darauf, dass damit alles schon gesagt ist. Für diese Sendung stimmt das sogar, denn das reicht für die Botschaft völlig aus: Buschkowsky und Konsorten sind die wahren Asozialen!
So viel hat Demirkan schon verstanden: Buschkowsky gibt den armen Migranten die Schuld an ihrer eigenen Lage. Das Problem, dass in der Unterschicht Menschen auf Kosten der Allgemeinheit leben und eine eigene Kultur jenseits des deutschen Mainstreams pflegen, teilt sie – aber die Schuldfrage dreht sie um und deutet mit dem Finger auf eine Gesellschaft und ihren Staat, die die Menschen in eine solche Lage versetzen. Wenn die Menschen draußen in einer Parallelwelt sind, dann deswegen, weil man sie in die Hauptgesellschaft nicht hineinlässt:
„Natürlich ist der soziale Rand in einer Gesellschaft immer ein Problem – egal welcher Nationalität. Und dass es einen sozialen Rand gibt, ist nicht eine Frage der Nationalität, sondern der sozialen Vernetzung, der Einbindung, der Bildung… Dass es [das Problem von asozialen Migranten in der Unterschicht] in diesem Fall [in Neu-Kölln] besonders stark ist, ist nicht von den Ausländern gemacht, sondern vom deutschen Staat, indem er sie in billige Unterkünfte verweist oder indem er sie in soziale Unterkünfte schickt… Diese Migranten sind zudem das geworden, was sie sind, innerhalb Deutschlands und nicht außerhalb. Kreuzberg und Neukölln sind nicht in Timbuktu, sondern in Deutschland.“
Die Absicht der Verteidigung ist klar: Die Leute sind nicht asozial – oder wenn sie es sind, dann wegen der Art und Weise, wie sie behandelt werden; nicht ihre ausländische Herkunft ist daran schuld, sondern das Land, in dem sie angekommen sind. Was sich da als Kritik einer Gesellschaft vorträgt, die manche von der Vernetzung
in ihr ausschließt, ist der Sache nach ein einziges großes Kompliment an alles, was sich in dieser Gesellschaft abspielt. Denn wäre der Umstand, dass diese Gesellschaft
einen erklecklichen Teil der Bevölkerung laufend an den Rand kickt und ihm keine Chance lässt, einen Lebensunterhalt zu verdienen, nicht wenigstens für den Anflug eines Verdachts gut, dass es sich bei dieser Gesellschaft
nicht gerade um eine Wohlfühlveranstaltung handelt, und man in diesen Laden nicht ohne Not eingebunden
werden möchte? Der unbedingte Leistungswille, den Buschkowsky so selbstverständlich zur zentralen Tugend dieser Gesellschaft erklärt – ist das nicht ein etwas abschreckender Hinweis darauf, was es heißt, in diese Veranstaltung integriert
zu sein? Offenbar nicht, und auch nicht für die nächste Fürsprecherin der Armen:
Helena Fürst verteidigt die Armen gegen die Asozialen in den Ämtern
Damit das erstmal klar ist: Buschkowsky hat keine Ahnung.
„Neukölln ist nicht überall und das sind auch nicht die Ausländer... Egal welche Schicht, es gibt solche und solche Menschen überall und bei Hartz-IV-Empfängern ganz besonders im Speziellen. Sie schildern irgendwelche krassen Einzelfälle, die Sie irgendwann einmal gesehen oder geschildert bekommen haben, Herr Buschkowsky. Sie waren noch nie – davon bin ich überzeugt – in einem Hartz-IV-Haushalt den ganzen Tag und haben sich da die Probleme wirklich angeschaut.“
Wenn man schon mit seiner beruflichen Nähe zu den Randfiguren der Gesellschaft argumentiert, dann muss man das auch glaubwürdig können. Frau Fürst kann das:
„Ich bin deutschlandweit unterwegs, ich war früher Sozialfahnderin, also ich weiß, es gibt Betrug, aber das gibt es überall.“ Deswegen hält diese „selbsternannte Anwältin der Armen nichts von Vorwürfen gegen Hartz-IV-Empfänger. Sie sieht Betrüger vor allem in den Ämtern, weil die nämlich Leistungen vorenthalten.“
Fürst, die in einer eigenen RTL-Sendung die Hilfe für die Armen und ihre Verteidigung zu ihrer Profession macht, beherrscht den Kunstgriff, einen Vorwurf durch eine erfahrungsgesättigte moralische Gegenoffensive außer Kraft zu setzen – und sie führt dabei vor, wie eine Verteidigung der Opfer nach den Kriterien, an denen sie gemessen und für schuldig befunden werden, diese Kriterien selbst vollständig affirmiert. Von wegen, diese Menschen würden sich wie unselbstständige Kleinkinder aufführen und allen anderen die Schuld an ihrer Lage geben; von wegen, sie pflegten eine verkehrte Anspruchshaltung:
„Die meisten sehen sich nicht als Opfer des Systems, sondern die sehen sich als nicht wahrgenommen. Sie werden gar nicht mehr wahrgenommen, weder vom Staat noch von irgendwelchen Arbeitgebern. Sie bekommen keine Bestätigung, sie möchten etwas tun, sie tun auch etwas, sie bewerben sich auf Jobs, sie machen Weiterbildung oder sie ziehen Kinder groß, aber es kommt nichts. Und warum kommt nichts? ... Sie bekommen keine Bestätigung, keiner hilft ihnen bei ihren Problemen, sondern sie bekommen immer mehr Druck von oben.“
Sie strengen sich doch an, sie machen Lebensentwürfe und verfolgen sie, sie wollen leisten
– aber sie sind nun einmal mittellose Menschen, die auf Leistungen der Ämter angewiesen sind. Dass sie diese abhängigen Kreaturen sind, ist nicht der Einwand, mit dem Frau Fürst aufwartet. Im Gegenteil: In ihrem Status als mittellose und hilfsbedürftige Wesen brauchen sie Bestätigung
und eben Hilfe
, damit sie sich in diesem Status durchschlagen können, wie sie es mit viel Tapferkeit und Geduld jetzt schon tun. Wer diesen strebsamen Opfern dabei nicht hilft – der ist der wahre Asoziale.
Czentarra zeigt, dass jeder eine Ausnahme ist
„Hans-Jürgen Czentarra ist seit zehn Jahren ohne Arbeit und klagt: ‚Hartz IV reicht vielleicht zum Überleben, aber eben nicht zum Leben.‘“ „Der 62-jährige engagiert sich ehrenamtlich als Stadtteilbürgermeister in Erfurt, wo jeder dritte sein Schicksal teile.“
Czentarras Beschwerde über seine materielle Notlage und die seiner Schicksalsgenossen ist die eine Sache; eine andere Sache ist, wofür der Mann in der Sendung steht: Hier gesellt sich zu den Fürsprechern der Armen ein wirklicher Kronzeuge, der die moralische Verteidigungslinie endgültig dicht macht. Da sitzt einer, der nicht nur beruflich welche kennt, auf die der Vorwurf des Schmarotzertums nicht zutrifft, er ist so ein Exemplar:
„Ich hab mich nochmal qualifiziert als Pharmareferent, hab nochmal ein Jahr Latein lernen müssen und alles, hab mich richtig auf die Bank gesetzt, hab sogar mit zwei abgeschlossen, junge Leute sind durch die Prüfung gefallen, hat mir echt Spaß gemacht ...“
Was mit einer Beschwerde über das Elend der Hartz-IV-Empfänger anfängt, endet mit einem Plädoyer dafür, dass letztlich jeder Mensch Herr seines Schicksals sein kann – und er selber scheint zumindest ein bisschen Wert darauf zu legen, dass er sich in seinem Auf- bzw. Umstiegswillen von seinen Schicksalsgenossen unterscheidet. Das sollte aber nicht gegen die Kollegen sprechen, sondern für die Botschaft, dass man auch als Hartz-IVler seinen Stolz und seine Würde behalten kann: Pauschalurteile über diese Menschen sind fehl am Platz! Wie in jeder anderen Gesellschaftsschicht gibt es hier Menschen, die ab dem ersten Tag ihres Hartz-IV-Bezugs arbeiten und damit den Respekt erwerben, der ihnen von der Gesellschaft im Allgemeinen und von den Arbeitsämtern im Besonderen vorenthalten wird. Dass diese Leute, die laut Czentarra genau die Kriterien erfüllen, nach denen sie für gewöhnlich abgeurteilt werden, auch noch vor den Ämtern die Hose herunterlassen
und damit höchstoffiziell ihre Würde abgeben müssen – das ist nun wirklich asozial.
Krafts Apologie der Reichen
„Alexander Kraft: Er beklagt das Reichen-Bashing. Der Luxusimmobilienmakler aus Monaco sagt, ‚die meisten Reichen arbeiten einfach härter als andere.‘“
Auch die Reichen müssen die Anschuldigung der Asozialität nicht auf sich sitzen lassen. Als ihr Anwalt präsentiert sich Kraft, der als Erstes den Vorwurf des leistungslosen Einkommens geraderückt:
„70, 80 % meiner Kunden, die durchaus viel Geld ausgeben, zwischen 1 und 100 Millionen Euro, das sind alles Leute, die 100 Stunden die Woche arbeiten und das machen bis zum Umfallen.“
Auch Kraft beherrscht das Spiel mit Regel und Ausnahme: Was Wüllenweber anführt, ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Denn bei den Reichen ist die Regel – und da kann sich Otto Normalarbeiter mal eine Scheibe abschneiden –, dass die bis zum Umfallen
arbeiten. Fragt sich nur, wann sie da noch die Zeit finden, ihre 1 bis 100 Millionen
auszugeben und mit Kraft nicht nur über seine Immobilien, sondern auch über ihr Berufsleben zu quatschen. Was sie da 100 Stunden pro Woche
treiben, stellt Kraft als Nächstes klar: Sie arbeiten pausenlos dafür, dass andere für sie arbeiten, und wenn sie dabei zufällig Geld verdienen, geben sie es gleich wieder für diesen Zweck her:
„Wenn Sie die Familie Quandt nehmen, da hat Vater Quandt nach dem Krieg wieder von Null ein Weltunternehmen aufgebaut, das Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland gibt. Warum sollen die Erben nicht davon profitieren? Und die nehmen das Geld ja nicht und hauen es in Ferraris, das ist eine Familie, die sehr diskret lebt und wieder reinvestiert in viele andere deutsche mittelständische Unternehmen. Also ich finde das totalen Quatsch zu sagen, die sind pauschal alle böse und asozial.“
Da ist der Schluss vom Genrebild der Quandt-Familie auf 70-80 % seiner Kundschaft viel weniger pauschal und vom totalen Quatsch meilenweit entfernt. Auch den Vorwurf von Wüllenweber, sich in Steuerfragen der nationalen Verantwortung zu entziehen, will Kraft nicht auf den Reichen sitzen lassen:
„Zweite Sache, die meisten Reichen oder Wohlhabende, die ich kenne, sind zumeist bereit, faire Steuern zu zahlen.“
Nun, dass es den Geldadel der Gesellschaft dazu drängt, Steuern auf Teufel komm raus zu zahlen, will der Apologet nicht gerade sagen, aber auch mit vier Relativierungen versteht man die Botschaft: Die Reichen wollen zum Gemeinwesen beitragen und tun es auch.
Bleibt nur noch die vielgescholtene Gemeinschaft der reichen Erben:
„Es ist viel zu pauschalisierend, was Sie sagen. Ja, viele Deutsche erben und machen aus dem Geld mehr, aber das ist genauso richtig wie für einen Neuköllner Bürger, der von seiner Oma 5.000 Euro erbt und die dann vielleicht in eine Würstchenbude steckt und damit Geld macht, als für einen Mediziner- oder Anwaltssohn, der irgendwann vielleicht 50 000 Euro kriegt und daraus eine Million macht.“
Wenn man mal davon absieht, welche Summe da vererbt wird und dass die Quantität des Geldes, die man sein eigen nennt, ziemlich entscheidend dafür ist, was man in der schönen Marktwirtschaft vermag, wenn man also von allen Unterschieden beim Erben absieht und nur wissen will, dass es stattfindet, dann sind wirklich alle Erben gleich. Auch so kann man offenbar den Vorwurf der Asozialität dementieren: Entweder alle sind asozial oder keiner!
Anne Will: Mittelschicht in Abstiegsangst – Bleiben die Fleißigen auf der Strecke?
Für Anne Will ist die Debatte über die „Randschichten“ unserer Marktwirtschaft in gewisser Weise selbst skandalös, weil dabei die Wichtigsten aus dem Blickfeld geraten:
„Es ist die Mittelschicht, die bei allen Diskussionen über die größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich ... geradezu übersehen wird; dabei sind es genau die, die den Laden zusammenhalten müssen und sich fragen, ob es nicht langsam ungerecht zugeht in diesem Laden... Wer in Deutschland fleißig arbeitet, kommt der noch auf einen grünen Zweig? ... Unterm Strich bleibt da oft ein Minus in der Kasse... Jedem dritten Vollzeitbeschäftigten droht Altersarmut.“
Wenn das Sorgeobjekt bei der Debatte über die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich
der Bestand der Gesellschaft ist, in der diese Kluft entsteht und wächst, dann darf man sich doch nicht bei deren Randfiguren aufhalten. Dann muss man vielmehr nach den Protagonisten schauen, nämlich der Mittelschicht
, die hier das Kompliment erhält, aus soziologischer Sicht verdammt wichtig zu sein. Welcher ökonomischen Tätigkeit auch immer die vielen Menschen dieser Schicht nachgehen mögen: Mit ihrer Strebsamkeit und ihrer Leistung sorgen sie für das Funktionieren der gesamten Gesellschaft, worin auch immer dieser Laden
bestehen mag, in dem Arm und Reich so weit auseinander liegen und doch so nahe beieinander sind. Wenn der berufliche Wille und die Tatkraft der Hauptgruppe die Grundlage von unser aller Wohl sind, dann gibt es eigentlich nur eine relevante Frage: Wird hierzulande deren Fleiß eigentlich noch gerecht entlohnt? Die „gesellschaftliche Entwicklung“ tendiert jedenfalls zum Gegenteil, nicht nur angesichts der trostlosen Perspektive von verarmten Vollzeitbeschäftigten
, sondern insbesondere auch hinsichtlich derjenigen, die, wie auch immer, aber jedenfalls ziemlich mühelos unverschämt reich werden:
„Sie aber müssen sich keine Sorgen machen: Deutschlands Reiche. Sie werden immer reicher... Inzwischen besitzen die reichsten 10 % 53 % des privaten Vermögens. Stellt sich die Frage: Sind die besonders Reichen auch die besonders Fleißigen?“
Die Debatte eröffnet
Kathrin Fischer, Journalistin, Pressesprecherin und lebender Beweis dafür, dass die Mittelschicht nicht mehr gerecht entlohnt wird:
„Ich würde schon sagen, dass ich zu den Fleißigen gehöre. Ich arbeite 39 Stunden, manchmal mehr.“
In Anne Wills Stellenbeschreibung von der Mittelschicht findet sich Frau Fischer exakt wieder. Was sie während dieser 39 Wochenarbeitsstunden tut, ist offenbar ziemlich gleichgültig, wenn es darum geht, sich für den Club der Fleißigen
zu qualifizieren, die auf der Strecke bleiben. Dafür kann sie das, was im Intro der Sendung über das Einkommen des Kollektivs aller gesellschaftlichen Funktionsträger behauptet wurde, nur bestätigen:
„Ich wüsste nicht, wie ich mir fleißig ein Vermögen ansparen sollte, selbst wenn ich mir noch so viel Mühe geben würde, weil es mit meinem Netto-Verdienst überhaupt nicht möglich ist... Reallöhne sind gesunken in den letzten zehn Jahren, die Besteuerung der Arbeitnehmer ist stärker geworden und die von Kapital hat abgenommen, wir haben Lebenshaltungskosten, die steigen... Ich würde sagen, nein, die Fleißigen sind nicht die Reichen in diesem Land... Das, was wir im Intro auf der Millionärsmesse gesehen haben, ist mit einem normalen Lohnerwerb nicht möglich, da muss man meines Erachtens schon erben oder sonstige andere Einkommen haben...“ Und sie weiß auch den Grund, warum aus ihr keine Millionärin wird: „Bei mir ist es so, dass meine Arbeitskraft arbeitet und nicht mein Kapital.“
Der Frau ist offenbar nicht mehr bekannt, dass diese zwei Reizwörter Arbeitskraft
und Kapital
einen Gegensatz zwischen zwei Einkommensquellen benennen, und damit den Grund dafür angeben, dass das Leben der Hauptgruppe in dieser Gesellschaft reich an Leistung und arm an Wohlstand ist. Stattdessen liefert sie ein mustergültiges Beispiel dafür, wie man einen Gegensatz in der kapitalistischen Produktion in eine Verteilungsfrage verwandelt:
„Und das bedeutet, dass ich nicht zu den Reichen gehöre, da die Arbeitskraft anders besteuert und anders entlohnt wird.“
Arbeitskraft und Kapital – das sind für diese fleißige Pressesprecherin bloß zwei unterschiedliche Weisen, ein Einkommen zu erzielen; miteinander haben diese zwei Einkommensquellen offenbar gar nichts zu tun, sind vielmehr zwei nebeneinander stehende Betroffene einer Zuteilung und eines Abzugs von Geld. Das Kapital, das die Arbeitskraft für die eigene Vermehrung in Anspruch nimmt und sie dafür entlohnt, wird in dieser Optik selbst entlohnt – nur eben anders! Von wem eigentlich? Beim Zuteilen wie beim Wegnehmen fährt die eine Erwerbsquelle besser, die andere schlechter – und daher kommt es, dass Arbeitskraft-Besitzer auf Millionärsmessen so selten zu finden sind. Das bekräftigt die Anfangsthese, dass es die Fleißigen in der Gesellschaft sind, die tendenziell auf der Strecke bleiben.
Kann es also tatsächlich sein, dass es bloß die oberen Zehntausend
sind, die reich werden können durch ihren Fleiß, und die anderen nicht?
, fragt Anne Will ihren nächsten Gast. Den in dieser Fragestellung anklingenden Verdacht, dass sich das schöne Leben der Reichen mehr aus ihrer privilegierten Einkommensquelle speist denn aus dem Fleiß ihrer Besitzer, begegnet der ganz offensiv: Wenn irgendjemand Reichtum verdient hat, dann die Reichen, denn
Patrick Döring von der FDP kennt nichts Ehrbareres als die gesellschaftliche Leistung des Unternehmertums:
„Das, was im Intro für die oberen Zehntausend gezeigt wurde, das trifft nicht die engagierte, auch ,obere Mitte‘ in Deutschland, denn in Deutschland gibt es sehr sehr vermögende Menschen, die damit Arbeitsplätze schaffen. 80 % der Ausbildungsplätze, 80 % der Arbeitsplätze sind im eigentümergeführten Mittelstand, die alle vermögend sind, die aber ihr Vermögen arbeiten lassen, nämlich für Arbeitsplätze in Deutschland, und das ist die Leistungskultur, die wir in Deutschland unbedingt erhalten müssen, sonst werden wir aus der Krise nicht herauskommen...“
Dass der Mittelstand
mit prassenden Millionären auf Millionärsmessen nichts zu schaffen hat, sagt eigentlich schon die erste Hälfte seines Namens; deshalb gehört er in die „Mittel“-Schicht, und dort zurecht in die „obere Mitte“. Denn der Rest dieser „Mitte“ sollte vor lauter Selbstgerechtigkeit bitte schön nicht übersehen: Wenn er mit seiner Dienstbarkeit als ach so unverzichtbarem gesellschaftlichen Beitrag hausieren geht, dann denke er mal an diejenigen, die ihm das überhaupt erst ermöglichen! Es sind schließlich die anständigen Unternehmer, die mit ihrem Vermögen die Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen, auf denen die Fleißigen dann fleißig sein können! Die stellen ihr Privatvermögen dem Nutzen der Gesellschaft zur Verfügung, wenn sie andere daran arbeiten und es vermehren lassen – und leisten damit einen großartigen Dienst an allen, die diesen Reichtum mit ihrer Arbeit vermehren dürfen, und auch an der Gesellschaft insgesamt, deren Funktionieren sie bei der Jagd nach Renditen mit ihrem Vermögen in Schuss halten. Die existenzielle Abhängigkeit des Großteils der Bevölkerung von einer Handvoll Reicher und deren Interesse macht Döring umstandslos zu einem Kompliment an letztere, die mit der ökonomischen Macht ihres Eigentums in aller Freiheit eine ganze Gesellschaft für sich in Anspruch nehmen. Er ist gar keine Erklärung schuldig für das, was jedem irgendwie selbstverständlich ist. Der Mann verlässt sich einfach auf die fertig eingerichtete und deshalb praktisch für jedermann gültige Realität, dass die Masse der auf Lohnarbeit angewiesenen Bevölkerung alternativlos den Berechnungen der mächtigen Unternehmer ausgeliefert ist: Das ist das ganze Argument dafür, sich vor letzteren demütig zu verneigen. Die Selbstverständlichkeit einer ökonomischen Verfügungsmacht von Eigentümern über den Rest der Menschheit stellt die Ökonomie dermaßen auf den Kopf, so dass es glatt die Vermögen
sind, die hierzulande arbeiten
, und stiftet am Ende auch noch die Selbstherrlichkeit, mit der man jeden Vorwurf, Reiche hätten nur ihren Privatnutzen im Sinne, ins Lächerliche ziehen kann:
„Wir haben nur ganz wenige, die einen ,Geldspeicher‘ haben und sich täglich ihres Eigentums ergötzen, im Gegenteil, diejenigen, die ich kenne und die sicher zu den oberen Zehntausend gehören, die sind nicht Dagobert Duck, sondern engagieren sich dafür, dass die Mitte Arbeit findet. Das ist die beste Zukunftssicherung, die man schaffen kann.“
Nein, mangelnde Fürsorge für andere lässt Döring seinen reichen Bekannten nicht nachsagen, da bürgt seine persönliche Nähe zu ihnen für höchste Objektivität. Die Unternehmer sind eben die wirklichen Funktionsträger und Dienstleister der Gesellschaft, denn wenn irgendetwas den ganzen Laden zusammenhält
, dann ihre engagierte
Gewinnerwirtschaftung, von der alles abhängt. Polemisch formuliert:
„Wir können anfangen, dass alle Unternehmen in Deutschland keine Gewinne mehr machen, aber das Ergebnis wird sein: massenhafte Arbeitslosigkeit, die die Mitte belastet, denn die Menschen brauchen Unternehmen, die die Löhne am Ende auch noch bezahlen können. Deshalb sage ich: Wer die Reichen ärmer machen will, schafft am Ende mehr Armut bei der Mitte der Gesellschaft.“
Zwar will kein Anwesender in der Talkshow Unternehmensgewinne sozialisieren, aber man kann es nicht deutlich und oft genug sagen: Wenn man den Reichen beim Reicherwerden was wegnimmt, kann man gleich den ganzen Laden dichtmachen – und wo er Recht hat, hat er Recht. Denn nur dafür werden Löhne in dieser Wirtschaft überhaupt bezahlt; wenn die Reichen mit der Arbeit anderer nicht auf ihre Kosten kommen, schauen alle dumm aus der Wäsche. So leicht geht es, aus einer Denunziation des Kapitalismus ein einziges Kompliment an Kapitalisten zu verfertigen; es gibt einfach nichts Sozialeres im Kapitalismus als freies kapitalistisches Unternehmertum.
Mehr in einem prinzipielleren Sinne unterstützt Herrn Döring ein anderer Talkshow-Gast bei der Verteidigung der Reichtumsverteilung in der Gesellschaft. Der will nicht nur eine bestimmte Schicht
der Gesellschaft für ihre besonderen Leistungen loben, der verhimmelt gleich das System, das hierzulande die Ökonomie und all ihre Beteiligten beherrscht:
Michael Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat herausgefunden, dass nichts so gerecht ist wie unverfälschter marktwirtschaftlicher Wettbewerb:
„Wenn Ungleichheit zustande kommt, weil Menschen sich nicht im Wettbewerb verhalten, sondern weil sie Machtvorteile nutzen können, wenn sie so an Vermögen kommen, weil sie sich in irgendeiner Weise Nischen schaffen, dann ist das sicherlich unerträglich.“
Herr Hüther führt vor, wie man den Mitdiskutanten berechnend ihre Kritik konzediert, um sie für gegenstandslos zu erklären: Er definiert die Beschwerde, dass in der Gesellschaft eine nicht mehr gerechtfertigte Ungleichheit entsteht, einfach um in die Ausnahme von dem Prinzip, das hierzulande garantiert nur gerechte Ungleichheit erzeugt. Unerträglich
ist dem Wirtschaftswissenschaftler nicht, was die Menschen vom Wettbewerb
haben, sondern dass man diesem Prinzip des Wirtschaftens irgend etwas Schlechtes nachsagen könnte – also hält er jedem, bei dem er ein kritisches Wort über marktwirtschaftlichen Wettbewerb zu hören vermeint, ein eindeutiges „Aber“ entgegen:
„Wenn die Rechtsordnung gilt und verlässlich exekutiert wird und dann im Wettbewerb Einkommen entsteht, dann kann ich zunächst nichts dagegen haben. Unsere Gesellschaft ist vom Gedanken der Freiheit, d. h. auch des Wettbewerbs, geprägt, hier kann jeder eigenverantwortlich handeln.“
Natürlich will Herr Hüther damit nicht die banale Wahrheit der Freiheit
im marktwirtschaftlichen Wettbewerb verraten haben, dass mit ihr die Menschheit auf einen gegensätzlichen Kampf um ihren Lebensunterhalt festgelegt wird. Für ihn ist umgekehrt der Wettbewerb
einer so schönen und guten Idee entsprungen, dass einfach kein real existierendes Resultat, und mag es noch so schäbig sein, mehr als Einwand gegen ihn gelten kann – auch nicht, dass bei der Konkurrenz ums Einkommen immer weniger zu haben ist, wenn noch mehr Erdlinge dabei mitmachen:
„Was man heute sieht, ist, dass der Anpassungsdruck an die Jüngeren heute größer ist... Und der Anspruch, der hat nicht nur mit Deutschland zu tun, der hat mit der Welt zu tun. Wir haben eine andere Arbeitsteilung, wir haben eine andere Wettbewerbssituation. Es sind heute Menschen mit uns dabei, Wohlstand zu erringen, die vor 30 Jahren noch nicht mit dabei waren, denken Sie an China oder Indien oder andere. Das verschärft den Wettbewerb.“
Dass die ökonomischen Bestrebungen der vielen Menschen in dieser freiheitlichen, weltweiten Arbeitsteilung
einander überhaupt nicht ergänzen und keinesfalls für eine Arbeitsentlastung aller sorgen, die Menschen sich vielmehr wechselseitig den Wohlstand
in wachsendem Maße bestreiten – auch das ist für diesen Ökonomen eine dieser Selbstverständlichkeiten, die zum „Wettbewerb“, diesem wunderbaren Mechanismus für ökonomische Gerechtigkeit, einfach dazugehören. Der ermittelt in jeder Wettbewerbssituation
das aktuell gültige gerechte Preisniveau für die arbeitsteilig miteinander konkurrierenden Teilnehmer, Anpassungsdruck
hin oder her. Freude pur ist angesagt:
„Ich finde es toll, dass diese Menschen die Chance haben, Wohlstand zu erringen. Es ist doch toll, dass diese Menschen, anders als vor 30 Jahren, ausbrechen können aus den Gefängnissen des Kommunismus und nun in der Welt mitmachen können!“
Das System von Freiheit und Wettbewerb ist das einzig richtige System, jede Abweichung von ihm ein Völkergefängnis. Jetzt gilt dieses System endlich weltweit, das verbietet jedes Rechten an seinen Resultaten – stattdessen ist ein Glückwunsch der Geschädigten an die Adresse ihrer Mitkonkurrenten um den Wohlstand
fällig.
Am „Wettbewerb“ kann auch der nächste Talkshow-Gast überhaupt nichts Schlechtes erkennen. Er findet seiner Meinung nach nur überhaupt nicht statt:
Für Sahra Wagenknecht verfälscht eine verkehrte Politik das schöne Prinzip der Leistungsgerechtigkeit
Wer sich für die Gesellschaft einsetzt, wird vom Fiskus und vom reformierten Arbeitsmarkt enteignet – wer nichts tut, wird belohnt, ein Abgrund von Unrecht tut sich auf:
„Jemand, der nicht arbeitet, sondern von seinem Vermögen lebt, also im Grunde gar nichts leistet, der bezahlt nur 25 % Steuern. Durch die Arbeitsmarktreformen haben wir eine Entwicklung, dass gerade diejenigen, die den Reichtum schaffen, immer weniger verdienen, immer weniger davon haben... Das hat gar nichts mit Wettbewerb zu tun, 80 % der Vermögen beruhen auf Erbschaften, d. h. die größte Leistung der Vermögenden beruht darauf, dass sie dem Club der glücklichen Spermien zugehörig sind, die richtigen Eltern hatten.“
Der Ex-Frontfrau der Kommunistischen Plattform ist also noch bekannt, dass hierzulande ein großer Bevölkerungsteil tagtäglich den Reichtum der ganzen Gesellschaft erarbeitet, von dem er in zunehmendem Maße ausgeschlossen bleibt. Aber auf die Idee, deswegen die Produktionsweise zu verurteilen, in der diese Menschen als Leistungserbringer für eine Sorte Reichtum in Anspruch genommen werden, für die sie zugleich Kostenfaktoren sind, will sie offenbar nicht mehr kommen. Und bei den Kapitalisten fällt ihr schon gar nicht mehr ein, dass denen der Reichtum gehört, den andere erzeugen – sie sich also mit fremder Arbeit bereichern. Kapitalistische Arbeitgeber sind jedenfalls nicht die Repräsentanten des leistungslosen Einkommens in der Marktwirtschaft, nach denen die linke Vorzeigefrau fahndet: Den Unternehmern billigt sie wie ihrer arbeitenden Manövriermasse die ökonomisch bedeutsame persönliche Leistung zu, für den Reichtum
zu sorgen, von dem die Volkswirtschaft lebt. Bei ihrer Fahndung kapriziert sie sich deshalb auf eine Figur, die jenseits dieser unschuldigen ökonomischen Reichtumsproduktion steht und bloß aufgrund ihrer persönlichen Beziehung in den privaten Genuss von viel Geld kommt: Den Erben hat sie im Visier, der beweist für sie, dass es in der Ökonomie der Geldvermehrung um Leistungsgerechtigkeit schlecht bestellt ist!
Haftbar zu machen für diese Verzerrung des marktwirtschaftlichen Leistungsprinzips – dafür hat die linke Oppositionspolitikerin ein sehr feines Gespür – ist eine falsche Politik. Mit ihren fiskalischen und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen drangsaliert sie die Fleißigen, während sie reiche Eigentümer schont:
„Die Ungleichheit kam zustande, weil die Politik so die Weichen gestellt hat. Ich finde die Debatte der Regierung um den Armuts- und Reichtumsbericht verlogen. Es wird gesagt, oh, das ist noch stärker ungleich geworden, die Reichen sind reicher geworden, die Mittelschicht schrumpft, die Armen verlieren massiv Einkommen, und dann wird so getan, als sei das wie Manna vom Himmel gefallen. Das ist ja Ergebnis politischer Entscheidungen. Wir haben seit Jahren eine Steuerpolitik, die Reiche regelrecht mästet, indem sie ihnen immer neue Steuergeschenke offeriert!“
Diese Fundamentalistin der Linken hat offensichtlich jeden Anflug einer Ahnung davon weit hinter sich gelassen, dass die materielle Ungleichheit, die sie vor sich hat, eine Klassenfrage ist. Die Ökonomie als den Ort, der diese Unterschiede permanent erzeugt, lässt sie links liegen; so entschieden hat Wagenknecht eine falsche Politik
der Regierenden als Ziel ihrer Kritik erkoren, dass sie einfach nicht mehr unterscheiden mag zwischen einer Ursache von etwas und dem Umgang mit ihm: Hungerlöhne werden gezahlt, weil der Staat es zulässt; der Reichtum der Reichen kommt zustande, weil ihnen der Staat weniger wegnimmt; Ungleichheit kam zustande
als Ergebnis politischer Entscheidungen
, und damit niemand sie falsch versteht, stellt sie gleich selbst ihre Polemik gegen die staatlich erzeugte Ungleichheit unter Vorbehalt:
„Ich bin nicht für eine Gesellschaft, wo jeder das Gleiche kriegt, aber ich bin auch nicht für eine Gesellschaft, wo der eine das Hundert-, Zweihundert- oder Dreihundertfache des anderen verdient, weil eine Gesellschaft, die so extrem ungleich ist, da gibt es z. B. eine sehr interessante Studie von britischen Sozialwissenschaftlern, die belegen, dass das Vertrauen der Menschen untereinander sinkt, dass es einen Anstieg an psychischen Erkrankungen, an Alkoholismus gibt. Also das heißt, wenn Gesellschaften ungleich sind, werden sie unmenschlicher!“
Das ist also Sozialismus heute: Kapitalismus ohne Suff, stattdessen mit menschlichem Antlitz.
Da passt der letzte Gast in der Runde wunderbar:
Uwe Huck, Betriebsratschef von Porsche, beschwört die Rückkehr des Anstands im Unternehmen:
„Ich bin für die Solidarität. Das heißt für mich: Derjenige, der hat, der gibt, und nicht: Derjenige, der hat, der nimmt. Der Eigentümer Ferry Porsche war immer darauf bedacht, dass es seinen Leuten gut ging. Wir haben in dieser Tarifrunde durchgesetzt, dass die prekäre Beschäftigung in Deutschland aufhören muss. Es kann nicht sein, dass junge Menschen nur noch als Praktikanten herumlaufen und von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. Das ist unanständig... Wir sollten mal wieder dahin gehen, was im Grundgesetz steht, das ich liebe: Art. 14 – Eigentum verpflichtet... Das muss in Deutschland wieder Mode werden: Wenn es einem gut geht, muss man anderen helfen, denen es nicht so gut geht... Die Altersarmut kommt nicht, weil wir so viele Reiche haben, sondern weil man die Menschen nicht mehr gescheit, also anständig bezahlt... Wir brauchen wieder Arbeitgeber, die ganz offen sagen: ,Ich bin stolz auf diese Mitarbeiter. Ich will Gewinne machen, aber nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter, sondern helft mir und ich helfe euch!‘“
Es kommt also doch ein Gewerkschafter zu Wort. Und zwar einer, der ganz vorne an der Tariffront kämpft, zugleich ganz authentisch im Betrieb verankert ist und der es schafft, in fünf Sätzen die DGB-Politik schlüssig auf den Punkt zu bringen: Seine Gewerkschaft setzt in ihren Tarifrunden durch, dass die böse Sorte „Beschäftigung“, die „prekäre“, nicht etwa aufhört, sondern „aufhören muss“. Das „muss“ ist moralischer Art: eine Frage nicht der Gewerkschaftsmacht, sondern des menschlichen Anstands. Für dessen Verwirklichung ist das Grundgesetz zuständig; was die Gewerkschaft dazu beizusteuern hat, ist der Wunsch nach einem Modetrend in Richtung Solidarität. Den Modemacher kennt Herr Huck auch schon: Es ist der gute kapitalistische Patron, der sich von seinen Leuten beim Gewinnemachen „helfen“ lässt und denen dafür beim Lohn aushilft. Wenn der stolz ist auf seine willigen Knechte, dann ist für den Gewerkschafter die Welt in Ordnung – was haben die andern bloß immer mit „arm“ und „reich“?!
hart aber fair: Die Zukunft ist grau – leben die Alten auf Kosten der Jungen?
Eine düstere Diagnose und eine ziemlich provokante Frage. Nur: Woran soll man da eigentlich denken? Leben etwa alte Obdachlose auf Kosten junger Millionäre? Oder alte Milliardäre auf Kosten erfolgreicher Jungunternehmer? Leben altersarme Rentner auf Kosten junger Arbeitsloser? Oder alte Facharbeiter auf Kosten junger Frührentner? Mit dem Untertitel der Sendung und mit seiner einleitenden Rede bietet Moderator Frank Plasberg seinem Publikum etwas Orientierung:
„Viele Alte genießen die Rente, ein paar Junge schuften dafür: Ist das Deutschlands graue Zukunft? Wer muss verzichten lernen, damit es gerecht zugeht? Die Generationen-Debatte unter anderem mit Blacky Fuchsberger (85) und Michelle Müntefering (32)!“ „Das wird die Nagelprobe werden für unsere Gesellschaft: Die Armut im Alter. (…) Was lässt sich eine junge Generation noch alles gefallen, eine Generation, die bald die historisch höchsten Rentenbeiträge bezahlt, dabei selbst aber mit dem niedrigsten Rentenniveau rechnen muss? (…) Müssen z.B. die Alten von heute den Wohlstand wieder teilen, den sie ja nach dem Krieg mit erarbeitet haben, damit die jüngeren Generationen nicht unter der Versorgungslast zusammenbrechen, übrigens wohl wissend, dass für sie selbst wenig übrig bleibt?“
Bei der Generationen-Debatte
, zu der „hart aber fair“ eingeladen hat, geht es also um die Rentenfrage. Bloß wie! Bei den jungen Generationen
, die Plasberg vorstellig macht, ist offenbar eine ganz bestimmte Unterabteilung dieser Generationen gemeint, nämlich die lohnabhängigen Einzahler in die Rentenkasse. Und zu den „Jungen“ gehört man mittlerweile bis zum 67. Lebensjahr! Dieser Generation
stehen dann die Alten
gegenüber – und auch hier ist genau der Teil der Bevölkerung gemeint, der sich ebenfalls aus der lohnabhängigen Menschheit rekrutiert, sich aber jenseits der staatlich festgelegten Rentengrenze befindet und daher als Kohorte berechtigter Leistungsempfänger firmiert. Dieses Verhältnis zwischen diesen zwei Parteien als einen Konflikt zwischen Generationen zu präsentieren ist ein mehrfacher Schwindel. Da gibt es, schon bevor Plasberg seine Gäste vorstellt, einiges klarzustellen:
Erstens sind die lohnabhängigen Mitglieder dieser Generationen in ihrem offiziellen Status als Beitragszahler oder Leistungsempfänger keineswegs Subjekte, vielmehr Objekte eines vom Staat organisierten Rentensystems. Unter sozialstaatlicher Obhut treten sie also zweitens gar nicht miteinander in einen Verteilungskampf, den sie zu führen hätten, sondern werden zueinander in ein Verhältnis gesetzt, über dessen Ausgestaltung die Hoheit ganz souverän entscheidet. Dabei geht der Staat wie selbstverständlich davon aus, dass der Lohn, den diese Menschen ihr Leben lang verdienen, für ein Leben im Alter todsicher nicht reicht – woraus er den ausgesprochen sozialen Schluss zieht, dass man auf keinen Fall diesen prekären Gestalten die Entscheidung überlassen darf, wie viel sie fürs Alter beiseitelegen, wenn das Geld für eine bescheidene Existenz auch nach dem Arbeitsleben noch reichen soll. Von einer Bereitschaft zum Verzicht macht der Staat hier also drittens nichts abhängig: Er entzieht denen, die noch im Arbeitsalter sind, einen Lohnanteil und führt ihn an die Rentenkasse ab, legt dann fest, welche Anrechte sie mit ihren Zwangsabgaben auf eine Rente aus dem Lohntopf der künftigen Einzahler erworben haben und welche Rentenhöhe sich aus diesen Anrechten ergibt. Nur in dieser staatlichen Mangelverwaltung und nur durch diese staatlich verordnete Zwangssolidarität zwischen „alten“ und „jungen“ Lohnarbeitern existiert überhaupt ein Verhältnis zwischen den Generationen
, die diese Talkshow gegeneinander antreten lässt. Sie sind gegeneinander aufgestellte Betroffene von Entscheidungen, die ganz andere Subjekte über sie fällen – nämlich Rentenpolitiker.
Damit wäre man bei den Akteuren, die in dem von Plasberg inszenierten Generationenkonflikt überhaupt nicht vorkommen. Zu Unrecht! Denn immerhin haben sie mit ihrer Renten- und Sozialpolitik die Sachzwänge gestiftet, die sie immer wieder in Rentendebatten und Rentenreformen überführen – nicht zuletzt mit der erfolgreichen Schaffung eines Niedriglohnsektors, den sie dem Rest von Europa als Erfolgsmodell anempfehlen und bei dem nicht nur Frau von der Leyen und Herr Plasberg fest davon ausgehen, dass die Altersarmut endgültig zur neuen Normalität wird. Plasberg wird in seiner Einleitungsrede wohl richtig liegen, wenn er seinem Publikum klarmacht, dass die Menschen in der Rentenfrage werden verzichten müssen. Allerdings steht dabei viertens fest, dass dieser Verzicht keineswegs von einer Naturnotwendigkeit diktiert wird, sondern von der Politik, und zwar nach den Notwendigkeiten, mit denen sie kalkuliert. Wenn die Regierung den einzahlenden und empfangenden Figuren ihres Rentensystems Verzicht verordnet, dann richtet sie sich ganz bestimmt nicht danach, was die Mitglieder dieser Generationen
für nötig halten, damit es gerecht zugeht
. Was hier gerecht ist, ergibt sich ganz nebenbei daraus, wie die entscheidungsbefugten Inhaber der staatlichen Gewalt die Altersarmut der heutigen Jugend produktiv zu gestalten gedenken, wem sie dabei welches Ausmaß an Leistungskürzungen bzw. Beitragserhöhungen zumuten, ohne die Kalkulationen der deutschen Wirtschaft oder die öffentlichen Kassen überzustrapazieren.
Aber wie gesagt: Von der Debatte und den dazu gehörenden Kriterien und Überlegungen soll einen ganzen Abend lang nicht die Rede sein. Die Rentenfrage, wie es sie wirklich gibt, wird in der Talkshow erwähnt, um sie in eine ganz und gar fiktive Debatte zwischen Generationen zu überführen, die ausschließlich mit zur Schau gestellten Tugenden bestritten wird. Die staatlich verordneten Kürzungen und Erhöhungen im Rentensystem tauchen darin nur noch als unterstellter Sachzwang auf, als ein unumgänglicher Mangel, den es gerecht untereinander aufzuteilen gilt, und der von selbst Verzicht gebietet. Für diese Debatte dürfen die Diskussionsteilnehmer sich als Repräsentanten der jungen oder alten Generation verstehen und entsprechend aufführen:
Blacky Fuchsberger über die Tugend der Tatkraft in der Not:
„Der Schauspieler und Moderator fragt: Woher nehmen die Jungen eigentlich das Recht, so viel Rente zu beanspruchen wie wir Alten? Meine Generation hat schließlich bei Null angefangen und sich ihren Wohlstand redlich verdient.“
Mal im Ernst: Kennt die deutsche Öffentlichkeit ihren Blacky nicht eher als Fernsehstar denn als Helden des Straßen- und Häuserbaus? Und in der Sendung lässt er schon sehr selbstbewusst raushängen, dass er so lukrative Jobs wie den eines Programmdirektors locker hat ablehnen können, und zwar aufgrund seiner erfolgreichen Promikarriere, die ihn aus der Abhängigkeit nicht nur vom staatlichen Rentensystem längst herauskatapultiert hat. Insofern ist Fuchsberger mit seinem Arbeitsleben wie mit seinem Rentnerleben die personifizierte Widerlegung seines Bildes von einer Aufbaugeneration
, die sich kollektiv unter den Nachkriegstrümmern heraus- und zu wirtschaftswunderlichen Höhen hinaufgearbeitet hat. Doch nach der bestechenden Logik dieses altgedienten Unterhaltungskünstlers soll man die Fiktion mitmachen, sich die Mitglieder dieser Generation unterschiedslos als tüchtige Exemplare einer großen Gemeinschaft vorzustellen, die ihren Wohlstand
geschaffen hat – völlig gleichgültig dagegen, wer in welcher Funktion und unter welchem Verschleiß diesen Wohlstand
erarbeitet hat, worin dieser Wohlstand eigentlich besteht und wie viel davon für wen abfällt. Nicht nur rückblickend vermag er den kleinen Unterschied nicht wahrzunehmen, dass manche in seiner Generation gerade nicht bei Null angefangen
, sondern über Grundeigentum und Produktionsmittel verfügt haben, an denen sie die andere, deutlich größere und vollkommen mittellose Fraktion ihrer Generation spottbillig haben arbeiten lassen, um aus deren Arbeit für den eigenen Gewinn ein Wirtschaftswunder herbeizuzaubern, in dem die meisten genau so viel Wohlstand redlich verdient
haben, wie ihre Verwendung fürs Geschäft der Unternehmer eine lohnende Angelegenheit war. Wer dabei zu welcher Seite gehörte, das kann man heute an der Armseligkeit der Rentenbezüge derjenigen ablesen, die ein Leben lang kommandiert und in Dienst genommen wurden. Und dass für diese Leute ein flächendeckendes staatliches Rentensystem überhaupt nötig ist, spricht Bände über den Wohlstand
, den sie da erarbeitet haben. Wie dem auch sei: Mit der von Blacky ins Feld geführten tatkräftigen Aufbauleistung haben sich die Alten nach seiner Logik als Gesamtheit redlich verdient
gemacht; wie unterschiedlich hoch ihr Wohlstand im Einzelfall ausfällt, ist irrelevant, es kommt nur auf dessen moralische Rechtfertigung an: Er ist in jedem Fall verdient und gerecht.
Die offensive Heftigkeit, mit der der stolze 85½ Jahre
alte Fuchsberger diesen Besitzstand seiner Generation vertritt, macht ihn dann doch zu einem sehr passenden Vertreter in diesem inszenierten Generationenkonflikt. Jedenfalls beherrscht er die Kunst der rhetorischen Frage gut genug, um damit die Ansprüche der anderen, der jungen Generation, ins Unrecht zu setzen: Woher nehmen die Jungen eigentlich das Recht, so viel Rente zu beanspruchen wie wir Alten?
Blacky dreht sich vorauseilend im Grab um, wenn er hört, die Jugend möchte tatsächlich so viel Rente genießen wie er und seine Generationsgenossen; er selber wäre zwar dann längst tot, aber er ist vom moralischen Anrecht seiner Generation so tief beseelt, dass ihn der Vorschlag einer Erbschaftssteuererhöhung zu einem empörten schämt euch!
treibt. Allein die Vorstellung, man könne von dem Eigentum, in das er mit seinem Verfügungsrecht auch seine Eigentümerseele hineingelegt hat, nach seinem Ableben noch mehr wegnehmen als bisher, lässt ihn noch zu Lebzeiten zu Tode erschrecken
. Was erlaubt sich die Jugend eigentlich!?
Diesen Vorwurf will sich der nächste Gast so nicht gefallen lassen –
Michelle Müntefering über die Tugend, unaushaltbare Lebensumstände auszuhalten:
„Die SPD-Politikerin (…) sagt: Die heutige Jugend ist besser als ihr Ruf. Denn für uns fängt die Unsicherheit schon bei der Ausbildung und Jobsuche an. Da fällt es verdammt schwer, an morgen zu denken.“
Ob Frau Müntefering tatsächlich jemals zu den Jungen gehört hat, die von finanzieller Unsicherheit im Job betroffen sind, sei dahingestellt. Ihren Beruf als Politikerin hat sie jedenfalls längst gefunden – und da ist es nicht nur eine üble Berufskrankheit, sondern eine ziemlich große Frechheit, wenn sie mit einem fiktiven „Wir“ im Namen von Leuten spricht, denen sie genau die Existenzsorgen beschert, auf die sie hier als Generationenvertreterin verweist. Entsprechend sieht die Lanze aus, die sie für die Jugend bricht: Sie plädiert nicht für eine materielle Verbesserung der unsicheren Lebensbedingungen der Jungen, sondern nimmt deren prekäre Situation als Beleg für die Tugendhaftigkeit „ihrer“ Generation; die Notlage spricht nicht gegen die Zwänge, mit denen die Jugend zurechtkommen muss, sondern für die Jugend, die mit diesen Zwängen zurechtkommt. Das ist eine denkbar affirmative Stellung zum Zwang, sich schon in jungen Jahren und dann ein Leben lang einteilen zu müssen; und für eine sozialdemokratische Nachwuchsrentenpolitikerin, die sich beruflich um das Funktionieren der Menschen unter den widrigen Umständen sorgt, die sie ihnen einbrockt, ist das auch eine denkbar passende Zurückweisung des Vorwurfs, die Jungen machten sich keine Gedanken über ihre Zukunft, indem sie die Rentenvorsorge für morgen vergäßen und es sich im Heute zu gut gehen ließen. Ihr Konter: Sie sind schon so arm, ihre Existenz ist schon so prekär. Respekt!
Mit diesem Hinweis auf die schweren Lebensumstände der Jungen nimmt Müntefering also die Konkurrenz um die Moralität ihrer Generation mit Blacky auf. Der hat zwar einen erlebten Krieg und Tatkraft beim Wiederaufbau für das Konto seiner Alten vorzuweisen, und mit einem das darf man uns nicht zum Vorwurf machen, dass wir den Krieg nicht erleben mussten
erkennt sie die erlittenen Kriegs- und Nachkriegsschäden als moralischen Berechtigungstitel voll an. Aber die Jugend braucht sich kein Versäumnis vorrechnen zu lassen; auch sie mit ihren Nöten, ihrer Unsicherheit und Perspektivlosigkeit muss ihr Licht nicht unter einen Scheffel stellen. Sie hat zwar keinen Krieg in der Heimat durchgemacht, musste nicht bei Null anfangen
, muss sich jetzt aber schon davor fürchten, dabei zu landen. Und das reicht allemal für ein Unentschieden...
Münteferings defensives Plädoyer überführt der nächste Jugendvertreter in eine offensive Forderung an die Alten –
Wolfgang Gründinger über die Tugend der Solidarität:
„Der Sozialwissenschaftler gilt als ‚Anwalt der Jugend‘ in Deutschland und fordert: Es ist höchste Zeit, dass die reichste Rentnergeneration uns etwas von ihrem Wohlstand abgibt. Denn für uns wird später nur eines sicher sein: die Rentenkürzung.“
Auch Gründinger verweist auf die kritischen Lebensbedingungen der Jugend – diesmal ist es, etwas vorausschauender, ihre Betroffenheit von zukünftigen Rentenkürzungen, die ins Feld geführt wird. Und auch von Gründinger ist über diese Lebensbedingungen selbst kein kritisches Wort zu vernehmen – weder über die niedrigen Löhne noch über die lückenhaften „Erwerbsbiographien“, die für die „junge“ Arbeitsbevölkerung zum modernen Sittenbild eines Lebens am erfolgreichen deutschen Standort dazugehören und die nicht nur für Gründinger zukünftige Rentenkürzungen unausweichlich erscheinen lassen. Für ihn gibt es zu dieser neuen „Normalität“ eines deutschen Arbeiterlebens selbst offenbar nichts anderes zu sagen, als dass sie eben die neue Normalität ist. Entscheidend ist, dass die Jungen, die sich in ihr zurechtfinden, einen Anspruchstitel in der Hand haben. Im Gegensatz zu Müntefering begnügt sich der Anwalt der Jugend
allerdings nicht damit, diesen Anspruchstitel für den Erwerb eines besseren Rufs dieser opferbereiten Generation einzulösen, sondern er lässt daraus tatsächlich etwas folgen, was wie eine materielle Forderung daherkommt: Die anderen sollen etwas von ihrem Reichtum abgeben!
Die Forderung richtet er allen Ernstes an die Generation der Rentner, als ob diese über einen fest vorhandenen und verfügbaren Reichtum kollektiv verfügten; als ob die Alten nicht bloß Rentenansprüche in der Hand hätten und mehr wären als Betroffene eines Rentensystems, das den einen Geld wegnimmt und den anderen Geld zuteilt. Er greift Fuchsbergers Bild einer wohlhabenden Gesamtgeneration auf und will genauso wenig wie dieser wissen, wer darin eigentlich wie wohlhabend ist. Für ihn steht fest: Angesichts der künftigen Armut der Jugend ist die Generation der (relativ) reichsten Rentner aller Zeiten in der Pflicht.
Dabei ist Gründinger als Mann der Wissenschaft pauschalisierendes Schubladendenken fremd:
„Nicht alle natürlich – es gibt nicht die reichen Alten. Man ist immer sehr schnell dabei diese Schubladen aufzumachen: Die Alten sind alle reich und böse (…) und die Jungen sind alle faul und unpolitisch und leben in Saus und Braus (…) Es geht nicht darum diese künstlichen Gräben aufzuziehen, sondern dass man sich die Probleme anguckt und sagt, (…) was wollen wir gerechter gestalten.“
Eine beliebte, nicht nur in Talkshows gern benutzte Argumentationstechnik: Man distanziert sich vorauseilend von „pauschalisierendem Schubladendenken“ und „künstlichen Konfrontationen“, um anschließend frei und theoretisch unbehelligt mit den nicht bloß pauschalen, sondern verkehrten Verallgemeinerungen und den fiktiven Größen argumentieren zu können, auf die es einem ankommt – bei Herrn Gründinger ist dies der solidarische Generationenvertrag
, zu dem wir alle zurückkehren
sollten. Er gibt zu, dass viele Alte gar nichts abzugeben hätten – bei vielen Leuten kann man die Rente doch gar nicht mehr kürzen, seien wir doch ehrlich
–, verwirft seine absurde Vorstellung einer Gesamtgeneration wohlhabender Rentner jedoch nicht, und möchte erst recht nicht die armen Alten und die armen Jungen zum gleichen Lager zählen. Er beharrt vielmehr auf den Frontlinien, die er längst gezeichnet hat, indem er seine Vorstellung einer alten Gesamtgeneration, von der etwas zu holen wäre, auf alte Nicht-Lohnabhängige ausdehnt: z.B. auch die Beamten, die Politiker, die Freiberufler (…), das wäre gerecht!
Die Verdienste der Alten will er keineswegs in Frage stellen, er gönnt ihnen auch den Lohn dafür: Die [Alten] haben ihr Leben lang gearbeitet, die haben Kinder erzogen, die haben viel geschafft – die sollen eine gute Rente bekommen.
Das Entgegenkommen hat allerdings seinen Preis: Das Problem ist nur, dass wenn ich später selbst mal alt werde, dass ich nicht mehr auf diese Rente vertrauen kann. Und das finde ich einfach ungerecht und unsolidarisch.
Wenn die Zeiten härter werden, gibt es nur eines: Man muss den als nun einmal notwendig
abgehakten Schaden gerecht verteilen. In diesem Sinne streckt Gründinger im Namen der Jugend die Hand aus, und da schau her –
Leonhard Kuckart über die Tugend der Verständigungsbereitschaft:
„Der Vize-Chef der Senioren-Union ist enttäuscht: Wir reichen den Jungen immer wieder die ausgestreckte Hand. Doch was bringt das? In der Regel nichts. Viele Jüngere sind an einem echten Dialog mit uns Älteren leider nicht interessiert.“
Das ist mal ein echt weiterführender Beitrag zur Rentendebatte: Von Rente ist endgültig nicht mehr die Rede, geschweige denn von Geld; stattdessen hebt Kuckart die Debatte auf eine höhere Ebene und bringt die Tugend der Verständigungsbereitschaft ins Spiel, um die es doch eigentlich zwischen den Generationen gehen muss. Auch eine Art Solidarität – nämlich eine ganz ohne materielle Substanz, bloß noch als Bereitschaft, über alles Mögliche zu diskutieren:
„Ich halte, dass wir streiten, für den richtigen Weg. Aber ich habe was dagegen, wenn Fronten aufgebaut werden. Wir müssen zusammenfinden (…), sonst geht die Gesellschaft zu Bruch. (…) Führen wir die Generationen doch zusammen und spalten die nicht!“
Dazu hat der Vertreter der Senioren-Union etwas beizutragen, nämlich einen großen Vorwurf: Wenn seine Vorstellungen eines gerechten Rentensystems bei Anwälten der Jugend auf Ablehnung stoßen, dann will die Jugend nicht einmal reden, dann will sie sich über nichts verständigen! Auf der fiktiven Ebene dieses moralischen Rechtsstreits ist sich Kuckart sicher: An ihm und seiner Generation kann es jedenfalls nicht liegen, wenn für Deutschland eine graue Zukunft
droht; da ist es vielmehr die Jugend, die auf die Anklagebank gehört:
„Wir müssen doch mal weiterkommen…[Die Jugend] ist nicht bereit, darüber zu sprechen, wie man das machen soll, [aber sie müssen] mal Vorschläge machen [statt unsere] abzuservieren... Abservieren… aber nie eine Alternative! Man kann nicht sagen ‚es geht nicht so‘, sondern man muss sagen, wie es geht!“
Der Senior beherrscht die Manier, Kritik mundtot zu machen: Wer sich nicht selbst mit Vorschlägen zur Behebung des Schadens hervortut, gegen den er protestiert, hat die Schnauze zu halten.
Gut, dass die Wissenschaft der Jugend beisteht –
Klaus Hurrelmann über die Tugend von Realismus und Respekt:
„Der Jugendforscher stellt fest: Die heutige Jugend ist sehr realistisch und fast schon ein bisschen altmodisch. Das Überraschende dabei: Trotz Unsicherheiten und Krise ist die junge Generation sehr optimistisch.“
Was Müntefering vom Standpunkt der Betroffenen formuliert, bestätigt Hurrelmann von der wissenschaftlichen Warte des Soziologen aus, speziell des Jugendforschers. Er stellt sich noch eine Ebene höher als Herr Kuckart, nämlich gleich oberhalb des inszenierten Generationenstreits, und geht der Frage nach: Funktioniert die Jugend von heute? Um die Problematik recht eindrücklich zu schildern, die ihn als Wissenschaftler fordert, sind ihm Umstände wie Dauerarbeitslosigkeit, 11. September, Umweltprobleme und Finanzkrise
gleichermaßen recht; worin die jeweils bestehen, inwiefern die Jugend davon eigentlich betroffen ist – das alles fällt nicht in den Bereich der Wissenschaft, die dieser Professor vertritt. Aus seiner wissenschaftlichen Sicht sind diese locker aneinander gereihten Katastrophen-Gemälde unterschiedlicher Art und Größenordnung lauter Fälle von Unsicherheit
, die das Funktionieren der Jugend erschweren und womöglich gefährden – in und mit einer Welt, in der das Leben laut einem Grundsatz der Soziologie eigentlich aus nichts anderem besteht als dem Zurechtkommen mit unsicheren Umständen.
Und siehe da: In der Hinsicht kann Hurrelmann seinen jugendlichen Forschungsobjekten ein fettes Kompliment aussprechen. Trotz aller schlechten Lebensbedingungen stellen sie sich auf die Welt ein, in der sie nun mal leben, rennen nicht mit Flausen und unerfüllbaren Idealen im Kopf herum, sondern suchen sich darin ihren Weg. Auf die widrigen Bedingungen, die ihnen aufgemacht werden, reagieren sie mit realistischer
Anpassung und zeigen sich geradezu altmodisch
, wenn sie nicht gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse rebellieren, wie ihre 68er-Großeltern das noch getan haben. Obwohl ihnen lauter Krisen das Funktionieren schwer machen, lassen sie sich nicht unterkriegen und blicken optimistisch
auf die – zugegebenermaßen sehr spärlichen – Möglichkeiten, die sich ihnen im Leben so bieten. Für die Tugend hat Professor Hurrelmann sogar einen eigenen Begriff geprägt: Die Jungen sind Egotaktiker
, was nicht zu verwechseln ist mit Egoisten
, denn sie sind zwar auch primär mit ihrem eigenen Durchkommen befasst, wissenschaftlich gesehen aber mit einer Taktik des Zurechtkommens, die Lob verdient. Nicht nur das: Bei ihren gutwilligen Bemühungen, sich in einer Welt voller Unsicherheit durchzuwursteln, leisten sie auch noch einen Beitrag zum Funktionieren des Generationenverhältnisses. Sie blicken respektvoll zu den älteren Generationen auf:
„Die alten Menschen [haben] ein ungeheures Vorurteil gegenüber den jungen Menschen, mehrheitlich. Denen kann es die junge Generation nicht recht machen. Umgekehrt haben wir genau das Gegenteil: Die jungen Leute (…) schätzen die alte Generation als Aufbaugeneration. (…) Es ist eine Wertschätzung der älteren Generation da.“
Damit ist Hurrelmann endgültig auf der Ebene des Generationenkonflikts als Nagelprobe für unsere Gesellschaft
angelangt. Und da kommt er zu dem wissenschaftlich abgewogenen Schluss: Armut hin oder her – an der Wertschätzung, die die jetzigen Alten bei den künftigen Altersarmen genießen, sollten sich Letztere ein Beispiel nehmen!
Was bei Plasberg für die Zukunft droht – ungerecht verteilter Wohlstandsverlust –, das brennt dem Manager der Millionenfrage schon heute auf den Nägeln.
Günther Jauch: Eine Frage der Gerechtigkeit: Wer kann heute noch in Wohlstand leben?
„Es ist die Geschichte einer ganzen Generation: Wer in den 40er-, den 50er- oder den 60er-Jahren aufgewachsen ist, hat sich den heutigen Lebensstandard oft hart erarbeitet. Aus eigener Kraft baute man ein Leben in Wohlstand auf: Erst kam der Fernseher, dann das Auto, schließlich der jährliche Urlaub an der Riviera oder auf Sylt – bei manchen sogar das eigene Haus. Man muss nur anpacken, so der Gedanke, dann schafft man es auch.
Für die Kinder dieser Generation war der elterliche Wohlstand bereits ein selbstverständliches Lebensgefühl: Der große Farbfernseher nicht mehr wegzudenken, das Auto zum 18. Geburtstag keine Seltenheit, und für die Urlaubsreise durfte es dann auch schon mal gerne in die USA gehen. Wohlstand für alle – im gesicherten Sozialstaat Deutschland.“
Ein interessanter Rückblick auf die sozialen Verhältnisse seit 1945, in denen „der“ Wohlstand Deutschlands an drei bis fünf Gebrauchsgütern, die in dieser Zeit nach und nach eine relativ weite Verbreitung fanden, abgelesen wird. Schnell mal Lohnarbeit und Kapital zusammengezählt, durch zwei geteilt und schon ist er fertig, der Durchschnittswohlständler. So abstrakt und gleichmacherisch geht es zu, wenn man sich vornimmt, ein Bild der Gesellschaft zu zeichnen, das alle konkreten und besonderen Lebenslagen zusammenzählt, um in der Summe eine recht schlichte Botschaft zu transportieren, nämlich dass „es“ in Sachen Fleiß und Preis in Deutschland einmal seine Ordnung hatte und „man“ deswegen nichts zu klagen hatte. So wird Wohlstand für alle
– jenseits von allen Unterschieden in Sachen Einkommen und Lebensstandard und von irgendwelchen politischen und ökonomischen Zielsetzungen, die die Nation gehabt haben mag – nicht nur als der Wahlspruch eines ehemaligen Bundeskanzlers referiert, sondern als das tatsächliche Konzept der Republik und ihr tatsächlicher Erfolg vorstellig gemacht. Die Klassengesellschaft ist in diesem Bild eine hart anpackende
Gemeinschaft von Wohlhabenden, Deutschland ein Hort der Zufriedenheit mit sich und den eigenen Lebensumständen. Dafür sind die von Jauch angeführten Gebrauchsgüter dann auch die passenden Reklamebilder: Dass es auf einmal etwas gab, was es vorher nicht gab, belegt, dass die Träume der Deutschen ohne Rest in Erfüllung gegangen sind, auch wer vom Reichtum nichts hat, partizipiert an ihm im gesicherten Sozialstaat
.
Wozu die Ausmalung der fetten Jahre taugt, liegt auf der Hand: Sie sind leider vorbei. Früher ging es bergauf, jetzt geht es bergab; früher konnten wir optimistisch sein, jetzt macht sich Pessimismus breit, Versprechen bleiben uneingelöst und Erwartungen unerfüllt: Allmählich aber weicht diese Gewissheit einem sorgenvollen Blick in die Zukunft. Talent und Fleiß sind längst kein Garant mehr für den sozialen Aufstieg. Seit Jahren versprechen alle Parteien, die Mittelschicht zu entlasten – doch Fehlanzeige: Häufig haben Facharbeiter, Handwerker und Angestellte das Gefühl, dass immer weniger im Portemonnaie bleibt. ‚Wohlstand für alle‘? Daran denkt kaum jemand mehr.
Nach der zurechtkonstruierten Fallhöhe kommt der tiefe Fall. Der Fernseher ist zwar immer noch da, sogar breiter und mit mehr Programmen denn je, aber er steht nicht mehr für Wohlstand, weil er nicht mehr für sozialen Aufstieg
steht. Das wirft Fragen auf – selbstverständlich nicht die nach den Gründen für diese neue Entwicklung, die den bis gestern wohlhabenden Durchschnittsbürger tief beunruhigt. Es geht vielmehr um eine Frage der Gerechtigkeit
, die mit einem begriffslosen „Wie geht es uns heute so?“ anfängt und mit einem kritischen „Wer ist daran schuld?“ abschließt: Wer trägt die Verantwortung für die negativen Entwicklungen: Unfähige Politiker oder eine leistungsschwache Gesellschaft?
Die Einladung, dass das ein einziger Freibrief ist, die je eigene Einschätzung der Welt auszubreiten, nehmen die geladenen Gäste gerne an – und zeichnen ihr Bild von einer Welt, die in Sachen ‚Wohlstand‘ und ‚Aufstieg‘ nach genau dem ruft, was sie in ihr sind und zu bieten haben.
*
Uli Hoeneß, im Hauptberuf Präsident des reichsten Fußballvereins Deutschlands und im Nebenberuf fränkischer Wurstfabrikant, weist den besorgten Unterton in der Frage, wer in Deutschland noch in Wohlstand leben kann, wütend zurück:
„Wir waren mit dem FC Bayern in den letzten Monaten in vielen Krisenländern in Europa. Wir haben in Spanien gespielt, in Manchester, wo die Welt auch nicht so gut aussieht und wir haben gespielt in Neapel, wo ich das Gefühl hatte, vor 20 Jahren, als wir das letzte Mal da waren, waren dieselben Pflastersteine auch schon ein Loch wie sie heute waren. Dann waren wir in Marseille. Und wenn ich dann in Deutschland so die Medien durchschaue, da hat man das Gefühl, uns geht es dreckig. Aber Deutschland im Großen und Ganzen ist ein Paradies. Und die Leute wollen es nicht begreifen.“
Das sitzt – und wird bei Jauch als ernsthafter Beitrag zum Thema „Wohlstand in Deutschland“ anerkannt: Hoeneß schaut durch die Fenster des Bayern-Vereinsbusses auf das Elend in den „echten“ Krisenländern Europas – und was sieht er da? So, wie es in anderen Ländern ausschaut, kann es hierzulande keinen Grund geben, unzufrieden zu sein! Reisen bildet eben, vor allem dann, wenn man seine vorgefertigte schlechte Meinung über die Menschen im deutschen Paradies
im Gepäck mitbringt und nur nach lauter Bestätigungen seines Vorurteils sucht. Dass es anderswo das nicht gibt, was es hierzulande gibt, liefert für Hoeneß den schlagenden Beweis dafür, wie umstandslos zufrieden die Leute hierzulande zu sein hätten. Wenn es hierzulande noch Grund zur Klage gibt, dann definitiv nicht wegen eines unbefriedigenden Defizits in Sachen Wohlstand, sondern wegen einer Wahrnehmungsstörung der Unzufriedenen. So plädiert der in der Welt herumgekommene Bayernchef und Chefhetzer für Zufriedenheit nicht etwa für erhöhte Ansprüche in den Nachbarländern, sondern für das Herunterschrauben eines unziemlichen Anspruchsniveaus dahoam:
„Das ‚immer höher!‘, ‚immer weiter!‘, das muss aufhören. Ich glaube nicht, dass wir immer noch weitere Höhen erleben, weil wir sind ja schon relativ hoch. Das Problem ist, dass der Anspruch der Leute so hoch geworden ist, dass sie das nicht mehr empfinden, wenn sie weiter kommen.“
Es ist schon ein schlechter Scherz, dass ausgerechnet Hoeneß, der seit Jahrzehnten nichts anderes predigt, als dass seine Bayern mit allen Mitteln und Millionen die Nummer eins in Europa werden müssen, die Gewinne weiter steigen sollen und seine Jungs dafür 110 % Leistung zu bringen haben, das Streben nach immer höher, immer weiter!
als Grund allen Übels identifiziert. Und um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, stellt er im Weiteren klar, an wen er dabei gedacht hat. Diese verdorbene Gesellschaft, die sich von üblen Theoretikern
wie Frau Kipping, die in der Runde mit dabei ist, Missstände herbeireden und Gründe für Unzufriedenheit suggerieren lässt, lebt in seinen Augen auf Kosten der Leistungsträger, die mit ihren Steuern den Laden überhaupt am Laufen halten.
„Und ich sage Ihnen noch einmal, ich bin total für die Leistungsgesellschaft, solange diese Spieler, und das wissen unsere Spieler, jedes Wochenende 70 000 in die Allianz- Arena bringen, solange sie jedes Jahr dem FC Bayern die Möglichkeit geben, nach Abzug von etwa 130, 140, 150 Mio. Steuern, Gewinne zu machen, dann können sie auch viel verdienen, weil ich sage Ihnen eines, unsere Spieler, aber auch Leute wie Dr. Winterkorn von VW, die tragen viel mehr für das Bruttosozialprodukt in unserem Land bei.“
So dreht sich aus der Perspektive des Bayernpräsidenten alles um: Gewinne, bei denen der FC Bayern dem Staat 150 Millionen an Steuern gönnt, belegen zwar nur, wie gut sein feiner Verein an dem Massenbedürfnis verdient, sich am Wochenende vom trostlosen Alltag abzulenken und als Fußballfan mal wirklich gefragt zu sein, und erst recht an einer Unterhaltungsmaschinerie, die das medial inszeniert und Ballspielen zu einem Riesengeschäft macht. Aber dem Herrn Präsidenten zeigen die Gewinne seines Vereins – und die der sonstigen besseren Gesellschaft gleich mit dazu – das glatte Gegenteil: Wer viel verdient, leistet auch viel – nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft. Doch anstatt seinen Spitzenverdienern diese Leistung fürs Land zu danken, plündert der Staat seine Leistungsträger aus, wodurch er nicht zuletzt – Vorsicht: Ironie! – ihren Leistungswillen schmälert:
„Zunächst einmal muss ich sagen, dass unsere Spieler ja eine Halbzeit fürs Finanzamt spielen – deswegen spielen sie ja manchmal auch eine Halbzeit schlechter.“
Das Rezept? Kick it like Hoeneß! Würden die Politiker das Land so gut führen wie er seine Bayern; würde der Staat seinen Haushalt genauso vom Festgeldkonto bezahlen wie er seine Transfers, dann käme alles ins Lot:
„Der Staat und die Länder, die müssen endlich begreifen, dass sie auch geführt werden müssen wie ein Unternehmen, und sie müssen endlich anfangen, die Ausgaben zu kürzen. Es kann nicht sein, dass in dieser Zeit, wo unser Staat Steuern kriegt, sie sprudeln wie noch nie, er immer noch Schulden macht.“
Denn bekanntlich kommen fränkische Wurstfabrikanten ganz ohne Kredit aus.
*
Eine Expertin wie Hannelore Kraft darf in einer Talkrunde zur hiesigen Wohlstandslage natürlich nicht fehlen, denn als Ministerpräsidentin von NRW kann sie machen
und als Chefin des bevölkerungsreichsten Bundeslandes kennt sie sich aus. Auch für sie liegt im Land einiges im Argen – und zwar nicht in der Anspruchshaltung der Leute, sondern in ihrem Lebensstandard. Da gibt es zum Beispiel die wachsende Schere zwischen Arm und Reich, was nicht auf eingebildete, sondern auf reale Defizite in der Gesellschaft verweist. Unzufriedenheit ist also berechtigt; und kraft der Autorität, die ihr als einer regierenden Politikerin ersten Ranges zukommt, wertet sie diese Unzufriedenheit zu einem ernsthaften Problem auf – für die Ordnung, für die sie zuständig ist:
„Das hat auf jeden Fall Grenzen! Wir brauchen ja nur in andere Länder zu schauen, wo die Schere noch weiter auseinander ist, was das dann für Folgen hat. Da geht’s dann auch bis hin zu Unruhen.“
Schon ist die Armut der Leute ein Ruf nach Politikern, sich um sie zu kümmern, und wer die Problemlage so ernst nimmt wie Kraft, erkennt sie selbstredend auch nicht erst an ihren Symptomen, sondern da, wo sie entsteht:
„Wir haben zu spät begonnen … deshalb ist noch wichtiger, dass wir noch eher anfangen und für die Eltern da sind, dass wir merken, wenn was schief läuft.“
Meint Frau Kraft damit die Armut der Eltern? Eher nicht, denn ihr Mitgefühl gilt einer durch Armut gefährdeten Funktion, deren Erfüllung sie von ihnen erwartet:
„Es gibt unheimlich viele Familien, wo einfach der Druck so hoch ist – weil die Eltern arbeitslos sind –, dass dort das so nicht mehr stattfindet, wie wir es gerne hätten und darauf müssen wir reagieren.“
Wie eine passgenaue Therapie dazu auszusehen hätte, weiß sie auch schon: Da können wir nicht einfach sagen, wir lassen die Menschen alleine
; nein, da ist vorbeugende Politik
gefragt, und das bedeutet:
„Eltern früher unterstützen, in Kitas, in Bildung investieren“, „Durchlässigkeit erhöhen“; „Strukturen so organisieren, dass nicht eine Familie, die in einer schwierigen Situation ist, acht bis neun Ansprechpartner hat, sondern einen.“
Dass Arbeitslose und Familien in ihrer Notlage nichts anderes brauchen, als von Kraft nicht allein gelassen, vielmehr ganz hautnah, persönlich und vor allem rechtzeitig betreut zu werden: Das hat die Politikerin garantiert nicht aus deren sozialer Lebenslage geschlossen. Darauf kommt sie, weil sie solche prekären Lagen von vornherein als Objekt der Sorge ihres Sozialministeriums ins Auge fasst. Sie verortet die Probleme schlicht da, wo sie sie als praktizierende Politikerin tatkräftig in Angriff nimmt, um sie in den Griff zu kriegen, und zwar ganz nach den Lösungen und Mitteln, die ihr Amt dafür bereithält. Deswegen weiß die Sozialdemokratin, wo die Leute wirklich der Schuh drückt, nämlich an exakt den Stellen, an denen sie berufsbedingt herumschustert. Genau die funktionellen Gesichtspunkte, die sie dabei beachtet, leiten sie daher auch bei ihrer theoretischen
Problemdefinition an: Wichtig und richtig findet sie eine vorbeugende Politik, die uns hilft, Ausgaben nachhaltig zu sparen.
An der Armut stört sie also das, was das Funktionieren des Gesamtladens NRW stört, das sie von Berufs wegen mit ihrem Sozialhaushalt betreut: Die perspektivlosen Kinder, die als künftige Beiträger zum Funktionieren des Ladens entfallen, wie die unnötigen Kosten, die sie dann verursachen!Die verantwortungsbewusste Landesmutti weiß genau so über die Welt Bescheid, wie sie sich praktisch um diese kümmert: Besser früh wenig Geld ausgeben, als nachher zu viel!
*
So richtig rund wird Jauchs Runde, wenn auch kritische Töne in die gemeinsame Sorge ums Allgemeinwohl einfließen. Dafür ist Katja Kipping da, die als aktuelle Spitzenpolitikerin der Linken findet, dass eine enorme Ungleichheit – und die nimmt ja zu in unserem Land – Entwicklungsbremse für das gesamte Land ist
. Ihr kritisches Augenmerk gilt dabei den Extremen der hiesigen Einkommensskala:
„Es muss nach unten hin eine Abfederung geben. Ich sehe die bei 1 000 €, das ist orientiert an der Armutsrisikogrenze. Kein Mensch sollte da drunter fallen, und nach oben hin kann man so sagen, ab dem 40fachen davon ... fließt das Mehr an Einkommen irgendwann nicht mehr in ein Mehr an Lebensgenuss.“
Sieh an, die Frau schaut beim Thema Wohlstand glatt aufs Geld! Manche haben definitiv zu wenig, andere eindeutig zu viel. Für wen ist das ein Problem? Für uns alle! Wie sollten „wir“ „uns“ gemeinsam entwickeln, wenn manche von uns so weit auseinanderliegen? Soweit die schlechte Nachricht der Linken.
Ihre Diagnose enthält aber auch eine gute: Es liegt ja gar nicht alles im Argen, denn es gibt sie schließlich, die heile Einkommenswelt zwischen 1 000 und 40 000 Euro. Man muss nur die Ausreißer an den Rändern etwas einfangen. An der Ökonomie selbst, also an der Sphäre, in der diese Unterschiede zustande kommen, muss man dafür überhaupt nichts ändern; nur deren Resultate muss man etwas anders justieren, und Kipping weiß auch wie: Da ist – wer hätte das bei einer alternativen Oppositionspolitikerin gedacht! –
Politik gefragt, sich stark zu machen für eine Umverteilung
, d.h. für eine Begrenzung nach oben durch eine Reichen- und eine Vermögenssteuer, die notwendig ist, damit wir ein weiteres Abdriften der Ärmsten verhindern können
z.B. mit einem gesetzlichen Mindestlohn von 1 000 Euro. So einfach wäre der Wohlstand für Kipping wieder ins Lot zu bringen: Nach ganz unten hin etwas absichern und dafür ganz oben etwas wegnehmen.
Dass man mit einem solchen Vorschlag hierzulande – nicht nur von Hoeneß – den Verdacht einer kommunistischen Gesinnung auf sich zieht, ist zwar äußerst ungerecht, aber wahr. Und tatsächlich sieht man der Lagebeurteilung und dem Rezept an, wie sehr es dieser Oppositionspolitikerin um den Nachweis ihrer „Politikfähigkeit“ nach den in Deutschland herrschenden Maßstäben und der total systemkonformen „Machbarkeit“ ihrer Politik geht. Sie formuliert nicht bloß Grenzen für eine Verteilung, die gilt, sie nimmt bei der Festlegung ihrer Grenzwerte auch höchste Rücksicht darauf – und das heißt: sehr bescheiden nach unten und großzügig nach oben. Und schließlich begründet sie diese Wahl mit Maßstäben, gegen die doch in dieser Gesellschaft wirklich keiner etwas haben kann: Nach unten hin kommt sie auf ein Einkommen, das sie Armutsrisikogrenze
tauft, weil es zumindest das Überleben in dieser Gesellschaft ermöglichen soll, und nach oben beim vierzigfachen davon auf eines, ab dem ein Mehr an Lebensgenuss
bestimmt nicht mehr geht.
Man sieht: Die Frau nimmt die Deutung des kapitalistischen Reichtums und der dazugehörigen massenhaften Armut als Problem der Verteilung, die die Politiker und letztlich wir alle zu verantworten hätten, so ernst, dass sie sich schon mal vorausschauend um ein objektives Verteilungskriterium kümmert. Die Ableitung eines solchen Maßstabs gerechter Geldzuteilung gelingt ihr mit einer etwas eigenwilligen Theorie des „Lebensgenusses“: In realistisch gemeinter Annäherung an die realen Einkommensverhältnisse legt sie die Summen fest, mit denen einerseits die Armen, andererseits die Reichen zufrieden zu sein hätten. Bei den einen sind das 1 000 Euro, weil darunter ein Mangel an Lebensgenuss und ein Recht auf Unzufriedenheit anfängt; die andern veranschlagt sie lebensgenussmäßig auf maximal 40 000 Euro, – da endet für sie endgültig das Recht auf Unzufriedenheit. Mit dieser Moral der zumutbaren Lebenszufriedenheit bringt die Linke den Kapitalismus zur Räson.
*
Der nächste Gast hat sich Jauchs Themenstellung buchstäblich zu Herzen genommen. Wenn Wohlstand
schon eine Frage der Gerechtigkeit
ist, dann verabschiedet sich Pastor Bernd Siggelkow gleich ganz von allen politökonomischen Überlegungen und widmet sich dem Gegenstand, dem er sein ganzes Berufsleben gewidmet hat, nämlich den wehrlosen Opfern
des schwindenden Wohlstandes:
„1995 gründete er in Berlin das christliche Kinder- und Jugendwerk ‚Die Arche‘, das mittlerweile 15 Häuser in ganz Deutschland unterhält. In den Archehäusern werden Kinder betreut und bekommen neben vielen Freizeitangeboten auch warme Mahlzeiten. Für sein soziales Engagement erhielt Siggelkow zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz. Er ist Autor und Mitautor zahlreicher Bücher zu Themen wie Kindesvernachlässigung und gesellschaftliche Verantwortung.“
Der Pastor kommt gleich zur Sache:
„Also erst mal muss ich meinen Frust ein bisschen breitmachen, weil wir haben mittlerweile den 4. Armuts- und Reichtumsbericht und wir wissen das Problem nicht erst seit letztem Mittwoch, sondern wir wissen das seit 2001 und was ist passiert? Im Sinne der Kinder gar nichts!“
Wem sonst noch in der Zwischenzeit was passiert
ist in Sachen Armut und Reichtum, interessiert den Pfarrer gleich gar nicht. Er hat die Opfer der Armut adoptiert, an denen nicht einmal Uli Hoeneß im Vereinsbus des FC Bayern vorbeifahren wollte, weil die dem moralischen Verstand schlechthin als Sinnbild unverschuldeten, deswegen zur unbedingten Anteilnahme verpflichtenden Opfers gelten: Kinder, die für das trostlose Schicksal gar nichts können, das ihnen mit der Armut ihrer Eltern beschert wird. Wie auch immer es den erwachsenen Insassen der Gesellschaft gehen mag: Für diesen Pastor bemisst sich gesellschaftliche Verantwortung
und damit die Güte der Gesellschaft an der Hilfe, die man für diese kleinen, unschuldigen Schwachen, eben wehrlosen Opfer
aufbringt. Die Verengung des Blickwinkels auf diesen moralischen Schwerpunkt hat Folgen: Die Ermittlung und Bekämpfung der Gründe, die Kinder – und nicht nur die – zu Opfern machen, ist seinem Beruf wie seiner Berufung von vornherein fremd. Der Blick des christlichen Seelsorgers auf seine kleinen Klienten ist vollkommen beherrscht von der Caritas, die er ihnen zu bieten hat – ihnen ‚etwas Gutes tun!‘, heißt der moralische Imperativ, auf den er alles, was der Staat in seiner Sozialpolitik sonst so verbricht, bezieht. Deswegen verpasst er beim Armutsbericht der Bundesregierung alles, was die Regierung bei der Schaffung wie bei der anschließenden Betreuung der Armut positiv ins Werk gesetzt hat: Wenn bei den Kindern die Armut nicht weniger, sondern tendenziell mehr wird, dann versagt in seiner Sicht die Bundesregierung vor ihrer eigentlichen Aufgabe. Also ist er gefragt, und natürlich weiß er, was Kinder in Not brauchen: Als Wesen, die ihre ganze Zukunft noch vor sich haben, brauchen sie eine Perspektive – dafür, dass sie vor sich so ewas haben wie eine Zukunft. Daran hapert es bei den halbwüchsigen Elendsgestalten, die ihm die Bude einrennen:
„Es gibt drei Berufsgruppen, die unsere Kinder in unserer Einrichtung immer wieder vorschlagen. Das erste ist natürlich Popstar, ganz klar, das sehen die ja in den Medien. Das Zweite ist, das sind so ein bisschen ihre Vorbilder, das sind Mitarbeiter der Arche. Und das Dritte, das ist erschreckend, das ist Hartz-IV-Empfänger. Viele Kinder sagen zu uns, wenn ich groß bin, dann gibt es nicht mehr Hartz IV, sondern Hartz V, dann geht es mir vielleicht noch ein bisschen besser.“
Wovor soll man jetzt erschrecken? Vor der objektiven Hoffnungslosigkeit der Lage dieser Kinder in den herrschenden Verhältnissen? – dann müsste man ja glatt die ins Visier der Kritik nehmen! Doch der gute Pastor erschrickt stellvertretend für alle guten Menschen vor der pessimistischen Haltung, die diese Kleinen erstaunlich frühreif gegenüber ihrer eigenen Zukunft an den Tag legen, und wer es sich mit seiner Empörung über das gesellschaftliche Elend derart leicht macht, ist dementsprechend schnell mit therapeutischen Rezepten bei der Hand:
„Kinder, die in Armut leben, für die ist Armut etwas, was nicht unbedingt an Finanzen festzumachen ist, sondern was mit Bildung und Chancengleichheit zu tun hat… Wir geben ja in die Familien massenweise Geld, aber wir geben es eben nicht dahin, wo es hingehört, nämlich ins Bildungssystem und ins Betreuungssystem.“
Perspektivlosigkeit heilt man mit Perspektiven, also mit Chancen und Möglichkeiten, eine Zukunft für sich in genau den Verhältnissen zu finden, in denen diese Armut so zuverlässig geschaffen wird: Geld brauchen nicht die Armen, Geld braucht ihre Zukunft im Geiste!
*
Edmund Stoiber schließlich hört aus der Fragestellung der Talkshow gleich die bedenkliche Diagnose einer wachsenden Differenz zwischen Wohlstandserwartung und Wohlstandsrealität und aus dieser Diagnose einen Anspruch an den Staat heraus, den es abzuwehren gilt: Wir haben hohe Ansprüche, aber wir sind oft nicht mehr in der Lage, die Ansprüche zu erfüllen. Und wo führt das dann hin? Es werden immer weitere Leistungen gefordert
und zwar von der Politik. Und das geht nicht. „Nur 10 Minuten“ braucht Stoiber für ein flammendes Plädoyer dagegen, den Staat mit Ansprüchen welcher Art auch immer zu behelligen. Was nicht weiter bemerkenswert wäre. Doch bei Edmund gerät dieses Plädoyer zu einem eindrucksvollen Selbstzeugnis. Dem Mann ist die professionelle Politiker-Heuchelei, stets zugleich im Namen der Herrschaft und der Regierten zu reden, dermaßen zur zweiten Natur geworden, dass er zwischen den beiden Seiten gar nicht mehr zu unterscheiden vermag. Oder wie soll man den zitierten Redebeitrag verstehen? Und erst recht den folgenden:
Wir leben in einem Europa ohne Grenzen... Wir müssen uns einstellen auf Wettbewerber, die wir gestern und vorgestern überhaupt noch nicht gehabt haben. Und deswegen stößt der Staat auch in seinem Leistungsvermögen an die Grenzen. Die Diskussionen, die wir oft führen, erwecken den Eindruck, als könne der Staat und die Politik alle Defizite beseitigen; das wird er nicht!
Dass der Glaube an die Regelungskraft des Staates ungebrochen ist,
sei ein Fehler und durch die Einsicht zu korrigieren: Der Staat muss sich im Grunde genommen auch mal ein Stück bescheiden.
Stoiber bringt die pauschale Zurückweisung der von ihm unterstellten Anspruchshaltung gegenüber dem Staat in die Form der Selbstkritik eines Wir, das mal mehr für die als gierige Anspruchssteller verdächtigten Bürger, mal mehr für den Staat selbst und dessen Sachwalter als die überforderten Adressaten solcher Gier steht, per Saldo also das Gemeinwesen als Ganzes meint, das angeblich Gefahr läuft, mit seiner Nachgiebigkeit gegenüber sich selbst als seiner Basis sich selbst zu überfordern – dabei wird in Europa nicht einmal die Hälfte des Weltwirtschaftswachstums erzielt
, was nicht etwa ziemlich viel ist, sondern ein Befund, der uns in unserer Eigenschaft als Europa ganz fraglos dazu zwingt, uns in unserer Eigenschaft als Staat alle Ansprüche abzuschminken, die wir uns in unserer Eigenschaft als wohlstandsverwöhntes Gemeinwesen nur allzu gerne erfüllen würden.
Auf seine Art sehr konsequent mündet dieser transrapide Gedankenflug in das Plädoyer für eine Anspruchshaltung, die wir in unserer Eigenschaft als Staat gegen uns in unserer Eigenschaft als Gesellschaft einzunehmen haben: Wir brauchen insgesamt die Gesellschaft, die mithilft.
Wobei? Die Antwort fasst Stoiber in die literarische Figur einer Mahnung an uns in unserer Eigenschaft als wir alle:
„Wenn wir nicht den Wunsch haben, immer wieder uns zu verbessern… uns Leistungsanreize zu geben, damit wir im Prinzip auch in dem internationalen Wettbewerb mit unseren Talenten wuchern können, dann kommen wir auf ein abschüssiges Feld.“
Der Weg zum Erfolg ist im Prinzip
mit der Tugend unermüdlicher Leistungsbereitschaft für den Staat ohne Ansprüche an und gegen den Staat gepflastert: Wenn jeder von uns seine Lebenslage als Ansporn für einen Beitrag zum internationalen Konkurrenzkampf der Nation begreift und wenn wir den gewinnen, dann geht’s uns allen gut, egal ob wir zu den Armen oder Reichen unter uns gehören!
Ein schönes Schlusswort.
Fazit
Unterschiedliche, durchaus auch gegensätzliche Ansichten zu allen wichtigen Themen des Weltgeschehens finden in Talkshows eine Gelegenheit, sich öffentlich vorzutragen und Gehör zu verschaffen. Man bekommt einen Überblick über die Meinungen, die in einer pluralistischen Öffentlichkeit das gesellschaftliche Bewusstsein in seiner ganzen Vielfalt repräsentieren. Darüber bekommt man einen Einblick, was von den die moderne Gesellschaft beherrschenden Interessengegensätzen übrig bleibt, wenn sie kompetent reflektiert und zu demokratisch vertretbaren und engagiert vertretenen Meinungen verarbeitet werden. Das Ergebnis ist nicht erfreulich. Präsentiert werden, der logischen Form nach, Varianten abstrakten Denkens, Weltanschauungen statt Anstrengungen, ein Stück „Welt“ zu begreifen. Was den Inhalt angeht, wird um nichts weiter gestritten als um Überzeugungen, die die korrekte Einstellung zur gesellschaftlichen Realität im Besonderen und im Allgemeinen, den anerkennenswerten oder verabscheuungswürdigen Umgang mit ihr, zum Gegenstand haben und um Anerkennung als allgemein zu billigende hochanständige Standpunkte konkurrieren – letzteres eben mit den geistigen Waffen des abstrakten Denkens.
a)
Was soll das heißen: ‚abstraktes Denken‘? Wer denkt da ‚abstrakt‘? Noch jede Talkshow-taugliche Stellungnahme ist doch ersichtlich und meist ganz ausdrücklich darauf aus, mit ganz konkreten Erfahrungen (die Millionäre, die ich kenne, ...
) zu überzeugen – man benennt z.B. jedermann bekannte Genussmittel wie Farbfernseher und USA-Reisen als Phänomene, an denen sich das deutsche Wohlstandsniveau der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ablesen lässt; man verweist auf real existierende Fälle sittlicher Verwahrlosung in Hartz-IV-Familien als schlagenden Beleg für ein Defizit an Aufstiegs- und Leistungswillen in diesem Milieu resp. für die Vernachlässigung ehrbarer Leute durch indolente Ämter usw. Was ist an dieser Art der Urteilsfindung im schlechten Sinn ‚abstrakt‘, was doch wohl heißen soll: ignorant gegenüber den wirklichen Bestimmungen eines gesellschaftlichen Sachverhalts und der Logik ihres Zusammenhangs?
‚Abstrakt‘ ist genau das: der ganz kurze, ganz direkte Zusammenschluss einer denkbar allgemeinen Lageeinschätzung (etwa: BRD in den 90er Jahren = Wohlstand hoch; Armut heute = Leistungsverweigerung / Amtsmissbrauch) mit Fallbeispielen, die das Generalurteil sinnfällig machen sollen (etwa: Urlaubsreise = Wohlstand; gesunde Arbeitslose = Leistungsverweigerung als Lebensprogramm; kleinliche Bürokratie = Menschenverachtung). Der Urteilende ordnet da der begutachteten Angelegenheit (BRD in der Nachkriegszeit; Massenarbeitslosigkeit heute) ein besonderes Merkmal, das ihm aus subjektiven Beweggründen wichtig erscheint (Wohlstand; Faulheit; bürokratische Schikanen), als ihren entscheidenden Inhalt zu, und erklärt es zu ihrem ‚Begriff‘; zur Begründung dient ihm ein anschaulicher Beispielsfall, wobei gar nicht auf den wirklichen Fall hingeschaut, sondern der Fall als Beispiel auf das Merkmal hinstilisiert, auf den ‚Begriff‘ verkürzt wird, der daran wahrgenommen werden soll. Argumentiert wird also mit einem Zirkelschluss zwischen ‚Begriff‘ und ‚Anschauung‘ anstelle der theoretischen Anstrengung, eine Sachlage zu analysieren, i.e. ihre objektiven Bestimmungen zu ermitteln und zu gewichten, und mit der sachlich begründeten Synthese dieser Bestimmungen zu einem – bestenfalls richtigen – Urteil zu gelangen. Geurteilt wird, anders ausgedrückt, nach dem unausgesprochenen Motto: ‚Wenn man’s weiß, sieht man’s sofort!‘ (nämlich dass der Migrant ein zufriedener Müßiggänger oder auch ein strebend bemühter Leistungserbringer ist und eine Rente über Armutsniveau der wohlverdiente Lohn für nationale Aufräumarbeit nach verlorenem Weltkrieg). Die Beteuerung, dass man „es“ wirklich selbst „gesehen“ hat, die Authentizität der geltend gemachten Erfahrung, die in Wahrheit nur das schon feststehende Generalurteil zum Inhalt hat, ersetzt – und erspart damit – das ‚konkrete‘ Argumentieren, das ‚Zusammenwachsen‘ (deutsch für den lateinischen Wortstamm von ‚konkret‘) zuvor unterschiedener Merkmale zum Begriff der Sache. Die Anerkennung des geäußerten Gedankens, um die es allemal geht, wird ausdrücklich zu einer Frage der subjektiven Glaubwürdigkeit des Urteilenden, nicht selten zu einer Sache der Sympathie.
Also: Freies Subsumieren einer Sache unter ein subjektiv bevorzugtes generelles Merkmal, das durchaus auch frei erfunden sein darf, und Werben um Anerkennung dieser Subsumtion durch entsprechend hinstilisierte Erfahrungstatsachen, so funktioniert das abstrakte Denken, das in Talkshows – und freilich nicht nur dort! – seinen Stammplatz hat.
b)
Die Art des Urteilens passt zum Inhalt. Zur Sprache kommen in solchen Show-Veranstaltungen widrige Realitäten des gesellschaftlichen Lebens in beliebiger Fülle, gegensätzliche Interessen, die Durchsetzung der einen und die Schädigung der anderen. Die Urteilsbildung zielt jedoch regelmäßig auf die eine an jede Sachlage herangetragene Bestimmung: auf den Umgang „der Leute“ – aller, einzelner oder irgendwelcher Kollektive, gegebenenfalls auch der jeweils wirklich Zuständigen – mit dieser „Lage“ unter dem Gesichtspunkt, ob Einstellung und Verhalten nach als selbstverständlich vorausgesetzten Kriterien des Anstands und nach dem Kriterium erfolgreicher Problembewältigung allgemeine Billigung finden können oder missbilligt werden müssen. Die objektiven Verhältnisse finden dabei als Lebensbedingungen Beachtung, vorzugsweise unter der Fragestellung, ob durch sie eine anständige Lebensführung womöglich erschwert wird und wer daran wieder schuld ist. In den paar Urteilskriterien, die da abgerufen werden, kennt sich jeder aus; das befreit die Meinungsbildung nicht nur von der Last, irgendetwas wissen, die Zwecke und Gründe gesellschaftlicher Tatbestände begreifen zu müssen, sondern sorgt für Gleichheit hinsichtlich der Urteilskompetenz zwischen den Talkshow-Gästen wie zwischen denen und dem Publikum, das deswegen auch nicht fürchten muss, mit neuen Einsichten behelligt zu werden. Aus der Lebenserfahrung geschöpfte, aller sonstigen Merkmale und Inhalte entkleidete Fallbeispiele sittlich hochwertigen resp. unanständigen, sachgerechten oder durch Erfolglosigkeit blamierten Verhaltens bebildern die jeweils vorgetragene und verfochtene Einschätzung des Weltlaufs nach Maßgabe geläufiger moralischer Prinzipien.
Mit ihren kontroversen Ansichten zur sittlichen Lage der Nation oder einzelner Personen oder Personengruppen – wobei die Kriterien für anständiges Verhalten sich gewöhnlich weniger unterscheiden als die damit bewerkstelligte Lageeinschätzung, die kritische Benotung „der Leute“ – tun alle Talkshow-Teilnehmer ein und dasselbe: Sie begeben sich in die Position des Anwalts einer anständigen, i.e. von anerkennenswerten Prinzipien geleiteten Bewältigung gegebener gesellschaftlicher Problemlagen. Und genau darin liegt die Leistung dieses öffentlichen Wettbewerbs der Meinungen. Streitbar werben die Gäste um ihre Sicht der Bemühung, unter die sie das Weltgeschehen subsumieren: der Bewältigung der Lebensaufgabe, in billigenswerter Weise mit Gegebenheiten zurechtzukommen, die Teilen der Menschheit das Leben schwer machen, gegebenenfalls auch für deren Verbesserung im Sinne leichteren Zurechtkommens wenigstens ideell Verantwortung zu übernehmen. Und mit diesem Wettbewerb um das überzeugendste Plädoyer für die vorgetragene Weltsicht und für die damit begründeten Imperative anständigen Verhaltens nehmen sie allesamt Partei für die Verhältnisse, mit denen so mancher sich so schwer tut. Nicht so, dass sie direkt für die willige Hinnahme der gesellschaftlichen Realitäten agitieren würden – was freilich auch vorkommt –: In der Beurteilung der Menschen nach dem Kriterium einer ordentlichen, also erfolgreichen und dabei anständigen oder auch ohne Erfolgsaussichten tapfer angegangenen Bewältigung der Aufgaben, die „das Leben“ im Allgemeinen und im Besonderen den Einzelnen, den Vielen oder überhaupt allen so stellt, im Plädoyer für angemessene Problemlösungen und richtig bemessene Weltverbesserung ist die Anerkennung der zu bewältigenden Lebensverhältnisse und der verantwortlich zu verbessernden gesellschaftlichen Realitäten als selbstverständliche Prämisse schon enthalten. Für die moralischen Prinzipien, die Maßregeln korrekten Verhaltens, die dabei in Anschlag gebracht werden, wird dabei auch nur ausnahmsweise einmal explizit geworben: Die Propaganda dafür geschieht mit ihrer selbstverständlichen Anwendung. Die besorgte Parteinahme für gelungene allseitige Anpassung, zu der die Talkshow-Teilnehmer ihre kontroversen Einschätzungen vortragen, steht als Ausgangspunkt jeglichen Nachdenkens über Gott und die Welt fest und kommt als allgemeine, allgemeingültige Maxime bei jedem anständigen Meinungsstreit heraus.
In diesem Sinn tun solche Show-Veranstaltungen Woche für Woche ihren Dienst: als Gebrauchsanweisungen für eine schon im Ansatz systemkonforme Benutzung des Verstandes, frei verfügbar für ein eher desinteressiertes Massenpublikum; als Lustbarkeiten für streitsüchtige Moralisten; und als praktische Schulung für alle, die das werden wollen.