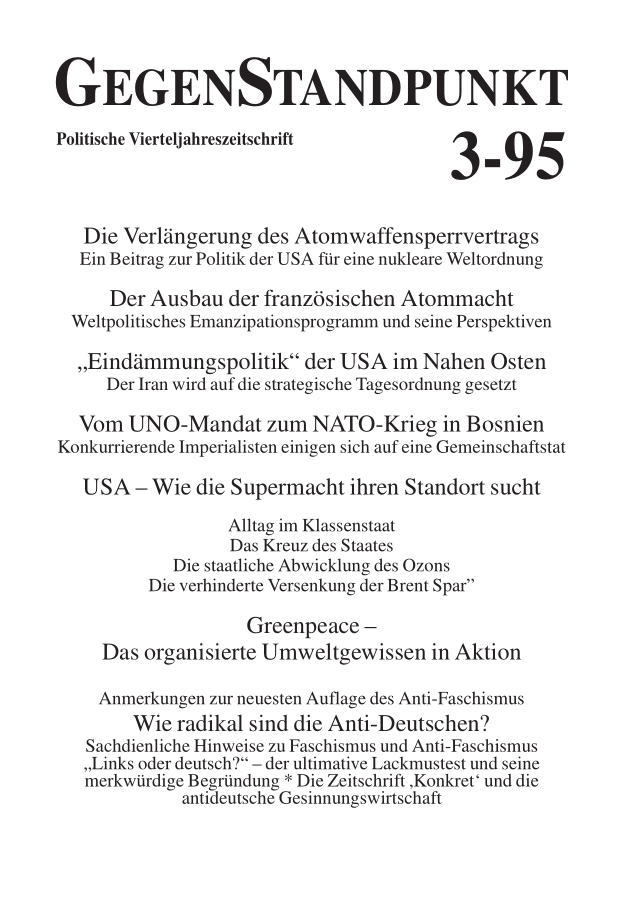Wie die Supermacht ihren Standort sucht
Die USA besinnt sich neu auf die Notwendigkeit, ihre ökonomische Übermacht gegen die ‚marktwidrig‘ zustande gekommenen weltwirtschaftlichen Erfolge ihrer Konkurrenten sicherzustellen. Die Selbstverständlichkeit, dass ein wachsender Weltmarkt mit dem Wachstum amerikanischen Kapitals identisch ist, existiert nicht mehr. Die Krise des Weltgeschäfts übersetzt sich für die USA in den Standpunkt, dass sich andere Nationen unrechtmäßig am freien, ‚also‘ den USA nützlichen Weltmarkt bereichert haben. Sie fordert daher neue Dienste der anderen Souveräne an amerikanischen Erträgen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- A. Eine neue Strategie der USA
- B. Die Internationalisierung des amerikanischen Kapitals
- C. Die USA in der Krisenkonkurrenz
Wie die Supermacht ihren Standort sucht
A. Eine neue Strategie der USA
1. Neue Priorität, neue Lage, neue Pflichten
Die USA haben in Sachen Ökonomie Aufrüstungsbedarf entdeckt. Die US-Politik räumt dem wirtschaftlichen Erfolg in der nationalen Prioritätenliste einen oberen Rang ein – behauptet wird sogar, mit ihm stehe auch die nationale Sicherheit auf dem Spiel[1]: Nicht mehr waffenstarrende Systemgegner bedrohen die USA, sondern kapitalstarke Systemfreunde. Diese Sicht der Dinge mag man für ziemlich übertrieben halten. Aber dieser Zusammenschluß zeigt erstens, wie sehr den Amerikanern das Thema an die Nieren geht und wie entschlossen sie sind, da für nachhaltige Besserung zu sorgen. Zweitens stellen sie klar, daß sie sich ein Leben unter Gleichen oder gar Überlegenen nicht vorstellen können, daß die nationale Sicherheit nur gewährleistet ist, wenn die Position als Weltvormacht steht. Drittens sind damit Anspruch und Gefahr der „post-Cold War era“ benannt: Wenn es den USA nicht gelingt, auch die ökonomische Übermacht wiederzuerringen, dann ist überhaupt ihr Status völlig ungewiß. Die USA müssen ihre allemal noch vorhandene außergewöhnliche Macht jetzt dafür einsetzen, eben diese Macht in jeder Hinsicht zu komplettieren. Und die Konkurrenz soll sich nichts vormachen, denn man werde mit bislang ungekannter Härte zu Werke gehen.
a) Der Staat als Handelsbeauftragter des amerikanischen Kapitals
Die Frage ist jedoch: Härte bei was? Was soll der Inhalt dieser neuen Strategie sein? Amerikanische Kommentatoren zeigen sich beeindruckt von der „erdbebenartigen Verschiebung des Machtgefüges in Washington“ – neue Köpfe, neue Machtbefugnisse, neue Günstlinge des Präsidenten etc. Das ist auch kein Wunder, wenn dem Außenministerium eine Neusetzung der Prioritäten verordnet wird, und zwar in doppelter Weise. Einerseits soll diese Repräsentanz und Durchsetzungsinstitution amerikanischer Interessen in aller Welt ihre „klassischen Aufgaben“, sprich: Eingriffstitel und -mittel wie „Waffenkontrolle“, „Menschenrechte“, „Demokratie und Stabilität“ nicht mehr als die allein Entscheidenden begreifen; es wird sogar konstatiert, daß da eine gewisse Entwertung eingetreten sei und Amerika nicht mehr in gewohnter Art auf Freund und Feind einwirken könne. Andererseits hat dem ein neudefiniertes Außenministerium dem sehr wohl ein Gegengewicht entgegenzusetzen; es erfährt auch eine Aufwertung, wenn es nun zum Hauptträger dieser neuen Strategie bestimmt wird. Außenminister Warren Christopher bekennt sich zum Richtungswechsel:
„Lange Zeit hielten amerikanische Außenminister die Wirtschaft für eine nachrangige politische Angelegenheit (‚low policy‘). Von mir werden Sie jedoch keine Entschuldigungen hören, wenn ich nun die Wirtschaft auf den Spitzenplatz der Aufgabenliste unserer Außenpolitik setze.“
Neue, zentrale Aufgabe des Außenministeriums soll es sein, amerikanischen Unternehmen auf den Märkten der Welt zu Erfolgen zu verhelfen. Amerika schickt seine höchsten Diplomaten als „salesmen“ durch die Welt,[2] und zwar aufgrund einer Lageanalyse, die da heißt: Präsenz verloren auf den Märkten dieser Welt. Damit paart sich jedoch keineswegs ein nach innen gerichteter Zweifel, ob diese Unternehmen vielleicht in Sachen Preis und Qualität, Lieferpünktlichkeit und Service, ihren Konkurrenten unterlegen sind. „Marktfähigkeit“ und „competitiveness“ sind nicht staatliche Schlachtrufe nach Kostensenkung, Rationalisierung, „Innovation“ und dergleichen, denen dann überlegene Ware entspringt; der Staat kündigt auch kein Subventionsprogramm zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit auf der produktiven Seite an. An eine „Binnen“-Förderung seiner Wirtschaft denkt der US-Staat nicht, das würde ihm un-amerikanisch, nämlich als staatliche Verfälschung der Konkurrenz vorkommen.[3] Unterstellt ist, daß die US-Wirtschaft in jeder Hinsicht wettbewerbsfähig ist. Die mangelnde Präsenz des amerikanischen Kapitals auf dem Weltmarkt konstatiert die US-Politik vielmehr als eigenes Versäumnis: Der Staat hat sich nicht genügend für „seine“ Unternehmen in aller Welt eingesetzt, er hat nicht – so die tautologische Umkehrung der verlorenen Präsenz –, nachdrücklich genug auf die Existenz seiner Unternehmen hingewiesen.[4] Der gelassene Glaube, daß die USA in ihrem Kapital über eine weltweit unwiderstehliche Waffe verfüge, zeigt sich zwar erschüttert; dieses soll aber dadurch wettgemacht werden, daß sich der riesige Apparat der Außenpolitik in den Dienst der Wirtschaft zu stellen und als deren internationaler Gesamtlobbyist zu fungieren hat[5]:
„Die Förderung des Exportgeschäftes ist eines der Hauptanliegen der US-Außenwirtschaftspolitik geworden. Diese Politik werde unabhängig von der Bewertung des Dollars betrieben. ‚Wir sehen das als langfristigen Prozeß, denn wir sind der Auffassung, daß die USA ihr Export-Potential nicht ausschöpfen‘, erklärt der stellvertretende US-Handelsminister… Unsere Wettbewerbsfähigkeit beruht auf fundamentalen Faktoren, der Stärke der Unternehmen, der aggressiven Politik der US-Regierung und der Neuausrichtung der US-Wirtschaft auf Auslandsmärkte.“ (Handelsblatt, 28.4.1995)
„Stärke der Unternehmen“ und „Exportpotential“ sind vorhanden und müssen nur ausgeschöpft werden; der „Faktor“, der die Möglichkeit in Wirklichkeit verwandelt, ist die „aggressive Politik der US-Regierung“. Auf diese „Aggressivität“ legen US-Politiker großen Wert. Hochrangige Diplomaten werden nicht müde, diese neue Entschlossenheit herauszukehren; sie bedienen sich einer explizit undiplomatischen Redeweise und tun glatt so, als hätten sie mit dieser Art mentalem Training auch schon einen entschiedenen Schritt nach vorn getan. Die US-Politik legt geradezu Wert auf die Demonstration, nun ganz „egoistisch“, ausschließlich im nationalen Interesse vorzugehen; sie will ihre Konkurrenten vor den Kopf stoßen; zum Weglegen der „Samthandschuhe“ gehört auch die ungeniert veröffentlichte Anweisung an die CIA, sich auf die Wirtschaftsspionage zu konzentrieren.
b) Der Adressat: Fremder Wirtschaftsnationalismus
Mit dieser „Aggressivität“ will die Regierung zweierlei ausdrücken:
- Die neue Strategie ist nicht mißzuverstehen als ein Anpreisen von amerikanischer Leistungskraft in Form von Waren, Dienstleistungen, Produktionsansiedlungen etc., vielmehr nimmt sich der US-Staat selbst in die Pflicht, nachweisbare Resultate zu erzielen. Schon auf der ideologischen Ebene wird deutlich, daß es hier nicht um einen Versuch, sondern um die Sicherstellung des Erfolgs geht.
- Diese Sicherstellung erfolgt durch das Handeln des amerikanischen Staates auf dem Felde der Handelsdiplomatie. Die Umdefinition von Staatsbeamten zu „salesmen“ darf nicht täuschen, sind sie doch – wie Ron Brown sich ausdrückt – als Advokaten des Rechts amerikanischer Unternehmen auf auswärtigen Geschäftserfolg unterwegs. Sie sinken nicht ins Privatgeschäft zurück, sondern ihre ersten „Kontaktpersonen“ sind die Staaten. Diese werden genau so betrachtet, wie der US-Staat sich jetzt selbst aufführt: als Agenturen ihres Kapitals, die sich amerikanische Wünsche nicht nur anhören müssen, sondern auch einiges für deren Umsetzung zu leisten haben.
Solche Gedankengänge ergeben sich aus einer Kritik der „Partner“/Konkurrenten. Sein Ungenügen mit dem nationalen Ertrag des weltweiten Wirkens der US-Kapitale übersetzt der US-Staat sich darein, daß ihnen trotz aller Tüchtigkeit ihr Recht auf Erfolg verwehrt wurde. Dies sei zurückzuführen auf ein weltmarktwidriges Verhalten der Konkurrenten. Gerade das, was die USA jetzt weltöffentlich ankündigen, nämlich die Resultate der Konkurrenz politisch korrigieren zu wollen, werfen sie ihren Konkurrenten als ein von vornherein angenommenes Verhalten vor, das sie bis zum heutigen Tage nicht aufgegeben hätten. Sich selbst bezichtigen die USA viel zu großer, einer Führungsmacht unangemessener Rücksichtnahme auf die nationalegoistischen Machenschaften der Emporkömmlinge. Die Erosion der ökonomischen Potenzen der USA verdankt sich nach dieser Lesart einem gebremsten Gebrauch der (vorhandenen) Macht – dann geht es aber auch nur noch um den richtigen Einsatz der Macht.[6]
Soweit die streng ideologische, aus der eigenen Unzufriedenheit abgeleitete Behauptung, fremdes Staatshandeln habe die Konkurrenz verfälscht und/also die amerikanische Nation benachteiligt; sie hat sich vorzuwerfen, daß sie sich das gefallen ließ. Umso mehr sieht sich Amerika – eigentlich gegen seine eigene Überzeugung, deswegen aber umso berechtigter – in der Pflicht, der schädlichen Wirtschaftspolitik anderer Staaten Einhalt zu gebieten. Der Nachteil Amerikas ist herbeiregiert worden, also kann und muß man ihn auch wegregieren:
„Nach meiner Überzeugung befanden wir uns vier Jahrzehnte lang in einer ideologischen Zeitschleife (time warp) – in eine fruchtlose Debatte darüber verwickelt, welche Rolle die Regierung spielen solle. Unsere Konkurrenten haben diese Rolle schon vor langer Zeit ausfindig gemacht. Und darum, so denke ich, kommen sie besser voran auf dem Weltmarkt, als sie sollten (!), und darum kommen wir nicht so voran, wie wir sollten. Wir haben vor, das zu ändern.“ (Ron Brown)
c) „Liberalisierung des Weltmarkts“ – mit eindeutiger Stoßrichtung
Das letzte Zitat könnte einen auf den Gedanken bringen, die Amis wollten nun Gleiches mit Gleichem vergelten – das ist aber Ami-Sache nicht. Selbst wenn sie Maßnahmen ergreifen, die wie abgekupfert aus dem wirtschaftspolitischen Arsenal ihrer japanischen und europäischen Konkurrenz daherkommen, handelt es sich nach Selbstverständnis und Absicht doch um ganz einmalige Dinge. Amerikanische Drohungen, Erpressungen und Strafen stehen immer exemplarisch für etwas Höheres: Nämlich für das Anliegen, eine neue, wieder für alle Beteiligten fruchtbare Ordnung herbeiregieren zu wollen.
Die neue, alte „Vision“ der USA heißt „freie Konkurrenz“: Die ist nur dann wirklich frei, wenn kein Staat den Versuch unternimmt, auf Geschäftsanbahnung, Kapitalbildung, Maßnahmen der Produktivitätssteigerung und Zugang zu Kredit Einfluß zu nehmen. So ein Einfluß mag zwar dem einzelnen Kapital oder einer Branche Vorteile verschaffen, aber er hindert das „Ganze“ der kapitalistischen Entwicklung, wird mit einem insgesamt größeren Schaden bezahlt. Somit gibt es eine gute und eine schlechte Konkurrenz: Die gute ist die der Privaten, die ihr Eigentum ganz frei dorthin lenken, wo die größte Vermehrung zu erzielen ist; die schlechte ist die der Staaten, die Erträge gegen andere und gegen die eigentliche Berufung der Privaten für sich festhalten wollen. Sie zwingen sie damit in eine nicht-optimale Form bzw. Anlage, denn wenn sich Staaten die Not dieser Einflußnahme aufdrängt, dann finden sich die Erträge auch nicht wie von selbst bei ihnen ein; dann haben sie sie nicht nur nicht verdient, sondern halten sie von besserer Verwendung ab.
Diese Apotheose der freien Konkurrenz ist wirklich nicht geistiges Eigentum der Amerikaner. Daß sie sich in ihrer Nationalideologie als herausragenden Repräsentanten und Durchfechter dieser „freien Konkurrenz“ sehen, ist aber passend, weil Reflex des eigenen imperialistischen Erfolgs; diese Nation hat sich das Arsenal an bei den Nachholer-Staaten verbreiteten Ideologien wie „Soziale Marktwirtschaft“, „Industriepolitik“ oder „Interventionismus“ schon immer erspart. Ein wenig weit gehen die USA aber schon, wenn sie anderen Staaten nahelegen wollen, sich dem freien Gang des Kapitals, der „fairen“ Konkurrenz, so wie sie sie sich vorstellen, freiwillig zu unterwerfen. Daß hier lauter kapitalistische Staaten aufeinandertreffen, setzen die USA glatt damit gleich, daß sie deshalb auch alle für den „freien Weltmarkt“ als Gemeinschaftswerk sein müßten. Die USA konservieren den Systemgedanken ganz ohne den Feind; und die neuen Systemfeinde sind all diejenigen, die sich nach amerikanischer Auffassung nicht der freien Konkurrenz vorbehaltlos stellen, also den von Amerika als verbindlich behaupteten Idealismus des Gemeinschaftswerks nicht teilen – tendenziell also alle. Es braucht den absoluten Verstoß des kommunistischen Lagers überhaupt nicht, um sozialistische Verbrechen an Freiheit und Marktwirtschaft anzuprangern; davon gibt es, in allen Schattierungen, genug im eigenen Lager – von Cuba bis Japan. Ihren hervorragenden Beitrag für das Gemeinschaftswerk, dessen Aufseher und Bewahrer sie sind, leisten die USA, indem sie den Systemfeinden auf die Finger klopfen. Das darf man ihnen nicht als Feindseligkeit auslegen. Schließlich geht es ihnen nur um das wohlverstandene Eigeninteresse jeder Nation, denn dem Dienst am Weltmarkt winkt Belohnung: Er wird – endlich von den Staaten in sein Recht gesetzt und nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des nationalen Nutzens gemustert – seine eigentliche Ertragskraft entfalten und eine ungeahnte Masse an Erträgen hervorbringen. Die entstehen zwar in unterschiedlichem Umfange in unterschiedlichen Nationen, werden dann aber locker als Eigentum des Systems zusammenaddiert. Dieser „Topf“ wird größer sein als die Summe dessen, was die Nationen bislang einzeln zustandegebracht haben. Bleibt nur noch das Problem der korrekten Aufteilung – die wird dann doch wohl damit zu tun haben, was jeder einzelnen Nation als Beitrag zuzumessen ist. Unterschiede müssen also sein – aber wenn jeder dabei irgendwie besser fährt…
Die Absicht schaut aus allen Knopflöchern heraus. Das Beschwören des gemeinsamen Ertrags betont die Unterschiedlichkeit der Erträge – und daß Amerika mit seinem Einkommen nicht zufrieden ist. Die Anrufung eines unerhörten Wachstumspotentials bei einsichtigem Verhalten aller Beteiligten kennt einen erstrangigen Nutznießer dieses Potentials, nämlich den, der mit dem jetzt „unterdrückten“ Potential für seine Begriffe zu kurz gekommen ist. „Freiheit des Kapitals“ resp. Rücknahme nationaler Einflußnahme will für US-Kapitalisten bevorzugte Behandlung in aller Welt. Wenn die USA so sehr auf dem Gemeinschaftsideal herumreiten, dann geht es ihnen um den Verlust gewohnter Einseitigkeiten, den sie rückgängig machen wollen.
Unter dem Titel „Unser System“ wollen die USA die Konkurrenten zum Zurückstecken bewegen. Daß sie dies als notwendige Reaktion auf Fehlverhalten der Konkurrenten ausdrücken, ist nicht einfach eine dumme Gerechtigkeitsvorstellung, sondern macht praktischen Sinn. Wenn die USA nämlich „das System“ in seiner ganzen Idealität beschwören, dann reden sie darüber, daß der Weltmarkt, dessen „Erfinder“ sie sind, nicht in dessen Sinne funktioniert. Wenn dieses System für die USA die wesentliche Qualität verliert, ihren Vorrang zu reproduzieren, dann ist es höchste Zeit, alle anderen daran zu erinnern, wie es gemeint ist. Die Ausbreitung einer möglichen Harmonie zwischen kapitalistischen Staaten im Dienste eines Gemeinschaftswachstums ist die der „Supermacht“ angemessene Art und Weise, die direkt angrenzende, einzige Alternative aufzuweisen: Sie kann jeden Systemzusammenhalt angreifen, sie kennt dann nur den Gegensatz zu den anderen Nationen – und den auszutragen traut sie sich zu. Noch aber – wollen die USA sagen – ist es nicht so weit und es braucht nicht dahin zu kommen. Die anderen brauchen ja „bloß“ anzuerkennen, daß sie den Systemzusammenhalt, von dem sie profitiert haben, aufkündigen, wenn sie so weitermachen. Das ist endgültig keine ideologische Veranstaltung mehr und wird auch von niemandem so verstanden, denn diese „Anerkennung“ muß natürlich in praktischem Entgegenkommen bestehen: Den USA müssen die besonderen Leistungen ihres Weltmarkts wieder verschafft werden.
2. Die USA im Streit um nationale Erträge aus dem Weltmarkt
In diesem Sinne überziehen die USA die Staatenwelt seit einiger Zeit mit einer Flut immer neuer handelspolitischer Forderungen. Diese sind nach folgendem Muster gestrickt: Erstens soll der jeweils angesprochene Staat mehr dafür tun, daß unter seiner Hoheit Wachstum zustandekomme. Zweitens solle er dafür vorrangig das Mittel der Marktöffnung in Anschlag bringen. Drittens solle er dafür sorgen, daß beides: Wachstum und Marktöffnung, amerikanischem Kapital und amerikanischen Bilanzen zugutekomme.
a) Der europäische Binnenmarkt als Zielscheibe einer „aggressiven Handelspolitik“
Diesen Dreischritt hat der Staatssekretär für Welthandel, Garten, neulich bei einem Besuch bei der EU erläutert. Unter Hinweis auf den Umfang des Handels, der schon zwischen der EG und den USA läuft, und auf die Bedeutung der EG als Standort amerikanischen Kapitals – US-amerikanische Unternehmen machen „55% ihres Auslandsumsatzes in Europa“ – propagierte er einen gemeinsamen Nutzen, der aus der Erweiterung dieser Geschäftsbeziehungen zu ziehen sei:
„Wichtig ist, daß Europa die weitere Öffnung der Weltmärkte und der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen auch künftig als in seinem Interesse betrachtet und sich sogar noch weiter öffnet, als seine Verpflichtungen in der WTO und dem Binnenmarkt vorsehen. Dies ist der Weg zu höherem Lebensstandard, stärkerem Wirtschaftswachstum und mehr Beschäftigung in Europa“. Das wiederum könne nur den Nutzen der USA aus dem Handel erhöhen: „Amerikanische Exporte nach Europa sind stark vom europäischen Wirtschaftswachstum abhängig… man kann annehmen, daß ein durchschnittliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3% in der EU im Verlauf der kommenden 10 Jahre zu einem Anstieg amerikanischer Exporte im Wert von über 120 Mrd. $ führen würde – mehr als das Doppelte der heutigen amerikanischen Exporte in die EU.“ (AD 3.5.95)
Garten beschwört einen Automatismus, der bislang europäisches Wachstum zu amerikanischem Nutzen habe ausschlagen lassen; zugleich will er sich darauf ebensowenig verlassen wie auf eine Einsicht seiner Ansprechpartner in Sachen „Marktöffnung“. Hier und jetzt, so Garten, soll Europa mehr Nutzen für amerikanisches Kapital hergeben, ganz unabhängig davon, wie es dort gerade mit dem vielbeschworenen „Wachstum“ steht. In dem Sinne will er
„erstens in Europa auf die Bedeutung gleicher Wettbewerbsbedingungen für amerikanische Unternehmen in verschiedenen Sektoren und bei unterschiedlichen Projekten hinweisen. Zweitens legen wir letzte Hand an eine neue Wirtschaftsstrategie für unsere Botschaften in Europa, die wir ‚showcase Europe‘ nennen“ (ebd.)
und die amerikanischen Unternehmen „bei der Expansion auf allen europäischen Märkten“ helfen soll. Dazu sollen „neue Partnerschaften zwischen Botschaften und amerikanischen Unternehmen gebildet“ und ein „wesentlich verstärktes Förderprogramm zur Unterstützung amerikanischer Unternehmen bei staatlichen Beschaffungen oder großen Projekten unter staatlicher Kontrolle oder mit Regierungsbeteiligung“ anlaufen. Einen konkreten Programmpunkt hatte Garten schon im Gepäck: Deutschland soll
„seinen lukrativen Markt für Energieerzeugungsanlagen öffnen… Garten sagte, er habe immer noch keine Zusicherung erhalten, daß dieses strittige Problem in naher Zukunft gelöst würde. Wo Mrd. Dollar Investitionen auf dem Spiel stünden, würden die USA ohne eine für sie günstige Entscheidung nicht lockerlassen. Das Fortbestehen einer Lage, in der nahezu alle Aufträge für Energieerzeugungsanlagen an deutsche Firmen gingen, wäre eine großes Problem für die USA… Das System (der Ausschreibungen) sei so konstruiert, daß im wesentlichen nur deutsche Firmen gewinnen können. Seit 15 Jahren hat keine US-Firma einen derartigen Auftrag erhalten.“ (IHT 29.4.95)
Die Beschwörung des Umfangs, in dem amerikanische Firmen mit Absatz und Investitionen schon am Geschäft in Europa mitverdienen, und des gemeinsamen Interesses, das beide Seiten an mehr Wachstum hätten, löst sich in die Beschwerde darüber auf, europäische Regierungen kämen ihrer Pflicht zur Beteiligung des US-Kapitals an den Erträgen nicht nach, die – Wachstum hin oder her – derzeit gerade zu machen sind.
b) Der amerikanisch-japanische Handelsstreit
Gegen Japan fechten die USA diesen Standpunkt schon seit längerem in einer rüderen Tonart durch: Erstens empört sie das wachsende Handelsdefizit mit Japan, zweitens meinen sie, sich gegenüber Japan härtere Bandagen leisten zu können. Zwecks Wachstum
verlangen die USA von Japan immer wieder „Konjunkturprogramme“, d.h. mehr Staatskredit für’s Geschäft. Zwecks Beteiligung des US-Kapitals an einem solchen Wachstum verlangen sie mehr Markt: An Japan ergeht der Vorwurf, es habe seine innere Geschäftssphäre für seine Kapitalisten reserviert. Zwecks Sicherstellung dieser Beteiligung verlangen die USA, die japanische Regierung solle US-Firmen auf diesem Markt mehr Absatz zuweisen.[7]
In diesem Sinne sind die USA im letzten Handelsstreit auf den japanischen Autoexport losgegangen. Ausgangspunkt war die Feststellung, daß das amerikanische Handelsdefizit mit Japan sich zu 60% dem Export von Autos und Zulieferteilen von Japan in die USA verdankt. Dagegen haben die USA die Forderung nach mehr Import amerikanischer Autos durch Japan und nach dem Kauf von mehr amerikanischen Teilen durch in den USA produzierende japanische Firmen gesetzt; und sie haben diese Forderung mit dem Verlangen nach „numerischen Zielen“, d.h. danach verknüpft, daß die japanische Regierung solche Käufe fest zusagt und durchsetzt. Im Falle japanischer Weigerung haben die USA mit einer 100%igen Importsteuer auf japanische Luxusautos gedroht, d.h. mit deren Ausschluß vom US-Markt. Am Ende ist ein Abkommen herausgekommen, in dem weder „numerische Ziele“ festgelegt sind noch die japanische Regierung auf feste Zusagen zur Importförderung verpflichtet worden ist. Die Vereinbarung besteht im wesentlichen darin, daß die japanischen Autofirmen selbst zugesagt haben, mehr Autoteile in den USA zu kaufen und mehr amerikanische Autos in ihr Verkaufsangebot aufzunehmen; darüberhinaus haben sie angekündigt, mehr in den USA zu investieren. Die japanische Regierung hat sich zur „Deregulierung“ des Handels mit Ersatzteilen bereiterklärt, d.h. zur Reduktion der Auflagen für Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Diese Runde hat also eher mit „unentschieden“ geendet. Die amerikanische Regierung wollte die Sache allerdings als ihren Sieg interpretieren:
„Der Präsident wertete die Verhandlungslösung als Sieg für die amerikanische Bevölkerung, aber auch für die japanischen Konsumenten und pries den Verhandlungsausgang als wichtigen Schritt für freien Handel auf der ganzen Welt… Die künstlichen Handelsschranken in Japan, insbesondere im Autosektor, seien eines der größten Hindernisse für freien und fairen Welthandel gewesen, über 20 Jahre hätten amerikanische Präsidenten erfolglos versucht, dieses Problem zu lösen. Die jetzige Administration habe mit Beharrlichkeit an ihren handelspolitischen Prinzipien festgehalten.. . Für die Amerikaner bedeute dies neue Arbeitsplätze, für die Japaner tiefere Preise und mehr Wahlmöglichkeiten.“ (NZZ 29.6.95)
Dem Wachstum in Amerika soll es zugutekommen, wenn japanisches Kapital auf dem US-Markt verstärkt einsteigt und US-Exporteure statt japanischer Zulieferer Umsatz und Gewinne in Japan machen. Diesen Erfolg soll sich das geschätzte Publikum zugleich als Beitrag zur allseitigen Geschäftsförderung sowohl in Japan als auch in den USA vorstellen. So beharrt der US-Präsident auf der Sichtweise, nach der sich in der Expansion japanischer Autoexporte in die USA und dem wachsenden US-Handelsbilanzdefizit eine japanische Politik ausdrückt, die mit der einseitigen Förderung japanischer Erträge ein allseitiges Wachstum behindere, weshalb in Umdrehung dieser Logik eine Befreiung der Handels zur „Zweibahnstraße“ als Wachstumsschub wirken müsse. Dafür spricht nach Auffassung der amerikanischen Regierung gerade der Umstand, daß die japanischen Firmen sich zu entsprechenden Kaufzusagen bereiterklärt haben, die kapitalistische Vernunft also auf der Seite ihrer Marktöffnungspolitik sei: Angeblich haben auch die Japaner „einsehen“ müssen, daß ihnen ein Wachstum, das durch einseitige Ausnutzung des amerikanischen Marktes zustandegekommen ist, letztendlich gar nichts nützt.
Trauen darf man ihnen deshalb noch lange nicht. In diesem Sinne hat die US-Regierung noch eine diplomatische Runde eingeläutet und vor Vertragsunterzeichnung ein „Hintergrundpapier“ veröffentlicht, in dem sie behauptet, der Vertrag enthalte doch eine Verpflichtung auf „numerische Ziele“. Die Japaner waren entsprechend empört, zumal „die US-Regierung einen neuen Mechanismus zur Überwachung des endgültigen Abkommens einsetzen will.“ (SZ 22.8.95) Kaum ist ein zweiseitiges Abkommen erreicht, stellen die USA klar, daß sie die Interpretationshoheit über es beanspruchen, und unterstreichen so noch einmal ihren Anspruch auf Unterordnung des anderen Vertragspartners.[8]
c) „Freihandel“ = politische Beschlagnahme von Erträgen
Die USA drehen die Beweislast um: Daß amerikanische Bilanzen im Minus sind, liegt daran, daß ihr Kapital auswärts nicht zum Zuge komme.[9] Besonders korrekturbedürftig erscheint ihnen dies dort, wo ihre staatlichen Ansprechpartner selbst die unmittelbaren Auftraggeber sind:
„Die USA wollen künftig gegenüber Tokio auf eine vermehrte Berücksichtigung amerikanischer Unternehmen bei der Durchführung von Entwicklungshilfeprojekten drängen, welche von Japan finanziert werden… Japans Entwicklungshilfe sei zu 90% – 95% angebunden, bislang entfalle aber auf amerikanische Unternehmen lediglich ein Anteil von 5% an dem insgesamt vergebenen Auftragsvolumen. Garten lehnte es zwar ab, konkrete Angaben darüber zu machen, welchen Anteil am Gesamtauftragsvolumen für amerikanische Unternehmen er als adäquat ansieht, betonte jedoch, die Intransparenz des japanischen Vergabeverfahrens stelle ein großes Problem dar.“ (NZZ 2.8.95)
Der Feststellung, daß Japan eigene schlagkräftige Mittel einsetzt, um auswärtige Märkte zu „besetzen“, und dem Vorwurf, damit würden sie den USA Einkünfte bestreiten, folgt die bei Lichte besehen ziemlich kontradiktorische Forderung, Japan solle seine imperialistischen Projekte als eine Art Dienst an US-Interessen begreifen und US-Unternehmen am Ertrag solcher Geschäfte beteiligen. Ihren eigenen Kredit wollen oder können die USA für solche Unterfangen nicht strapazieren; also soll der Kredit der Konkurrenz die Märkte hergeben, die der Dollar nicht stiftet.
Von diesem Ansinnen ist es nur ein kleiner Schritt zu dem Anwurf, überhaupt würden andere Regierungen Erträge, die den USA zustehen, unrechtmäßig in ihre Taschen lenken. Die US-Regierung verlangt seit einigen Jahren, die auswärtigen Töchter amerikanischer „Muttergesellschaften“ seien ins US-amerikanische Steuerrecht einzubeziehen. Damit greifen sie die auswärtige Rechtshoheit unmittelbar an: Dort, wo fremde Souveräne sich per Staatsmacht Einkünfte aus bei ihnen angelegtem „amerikanischen“ Kapital holen, halten die USA daran fest, daß dies doch „ihr“ Kapital sei, also auch ihren Gesetzen unterworfen sein müsse. Diese Forderung kommt der Vorstellung einer Tributpflichtigkeit fremder Staatsgewalten an die USA durchaus nahe.
3. Amerikanische Handelsdiplomatie
a) Die Methode: Erpressung zwecks Verständigung
Die USA haben den Weltmarkt zu einer Frage der richtigen Aufteilung von Erträgen ernannt, die anderen Nationen zu Schädigern amerikanischer Einkünfte, und die eigene Außenpolitik zum Mittel, nationale Bilanzen zu korrigieren. Dieses Anliegen will allerdings nicht nur angemeldet, sondern auch durchgesetzt sein; fragt sich also, wie die USA das schaffen. Die Unterordnung, auf die das amerikanische Projekt zielt, soll ja als Wille und Einsicht genau der Nationen zustandekommen, deren ökonomische Machtmittel bevorzugte Quelle amerikanischer Unzufriedenheit sind. Die USA wollen Staatsgewalten für sich einspannen, deren Macht sie Einiges zutrauen, auf deren Kooperation es gerade wegen dieser Macht ankommt. Deshalb mögen sie auch noch so ultimativ auftreten: Am Ende jeden Streits muß und soll ein Abkommen stehen, das es beiden Seiten erlaubt, zum business as usual zurückzukehren. Den gegensätzlichen Interessen der Konkurrenz muß Rechnung getragen werden, wenn man sie für sich instrumentalisieren möchte.[10]
b) Das Mittel: Drohungen mit Markt und Dollar
Als Mittel, zur Durchsetzung ihres Anliegens erproben die USA gegen die Konkurrenz ein gewaltiges Erpressungsprogramm. In diesem kommen ihr Markt und ihr Kredit nicht als positive Angebote ans Interesse von Nationen und Kapitalisten, sondern negativ, als politische Druck- und Drohmittel zum Einsatz. Die USA setzen die Abhängigkeit der Erträge anderer Nationen von der Benutzung des US-Markts und vom Zustand des amerikanischen Kredits ein, um vorzuführen, was sie ihnen alles vorenthalten könnten, wenn sie sich nicht amerikanischen Interessen fügen. Diese Taktik enthält den Übergang zur offenen Drohung, ihren Konkurrenten den Nutzen aus dem US-Markt zu entziehen und ihnen Geschäft kaputtmachen. Dies „Argument“ soll die Partner nicht nur zum Einlenken bewegen, sondern bei ihnen die Bereitschaft zu neuen, kooperativeren Wirtschaftsbeziehungen stiften. Als Erpressung zieht das durchaus; eine neue Ära freundschaftlicher Zusammenarbeit entsteht darüber nicht gerade.
Dementsprechend sehen amerikanische Angebote zur „Marktöffnung“ aus:
„Die Clinton-Regierung will im internationalen Luftverkehr die Weichen neu stellen. Transportminister Pena hatte 1994 erklärt, daß Washington langfristig eine Politik des „offenen Himmels“ anstrebt. Mit sechs europäischen Staaten ist dies nun gelungen. Wie ein enger Mitarbeiter Penas erklärte, handele es sich um den ‚einzigen Weg, auch den Deutschen und Engländern die Pistole auf die Brust zu setzen.‘ … Daß die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und Großbritannien nun wieder aufgenommen wurden, wertete Pena schon als Zeichen, daß die Strategie Wirkung zeigt.“ (SZ 12.4.95)
Die Absicht ist klar: Die USA wollen ihren Fluggesellschaften Geschäft in ganz Europa sichern und damit zugleich die EG als Ganzes unter Druck setzen, zu ihren Konditionen ein Abkommen abzuschließen. Daß der Druck wirkt, heißt noch lange nicht, daß die USA so ihr Ziel erreichen. Als Gegenmaßnahme hat die EG-Kommission erst einmal den entsprechenden Ländern mit einem Gerichtsverfahren gedroht, weil deren Sondervereinbarungen mit den USA die Vereinheitlichung des europäischen Luftverkehrs gefährdeten und die Position Europas gegenüber den USA in dieser Frage schwächten, und haben den USA gleichzeitig ein Angebot zu zweiseitigen Verhandlungen gemacht. Seitdem gibt es darüber in der EG Streit, und transatlantisch schwelt der Konflikt vor sich hin.
In anderen Zusammenhängen drohen die USA gleich mit ihrer Macht, ihren Markt gegen fremde Geschäftstätigkeit abzuriegeln: Sanktionen. Die Japan angedrohten „Strafzölle“ waren nicht auf Erschwerung der Konkurrenz in einem Sektor berechnet; um die Bedingungen des Imports von Luxusautos ging es in den Verhandlungen auch gar nicht. Die Drohung mit Ausschluß der betroffenen Autos vom US-Markt war ausdrücklich als erpresserisches Mittel gedacht, um der japanischen Regierung zu demonstrieren, was sie insgesamt auf dem amerikanischen Markt zu verlieren hat, wenn sie nicht klein beigibt. Zwar behaupten die USA weiterhin, ein gemeinsamer Nutzen werde sich schon einstellen, wenn sich die Gegenseite hinsichtlich der Bedingungen des Handels kompromißbereit zeige. Was sie aber tatsächlich fordern, ist das Gegenteil, Verzicht. Der Verweis auf die Abhängigkeit Japans vom Geschäft mit den USA, die Aussicht auf noch größeren Schaden soll es zwingen, den von den USA verlangten hinzunehmen.
Auch der Dollar dient den USA zunehmend darüber als nationale Waffe, daß sie bei der ganzen Welt verschuldet sind und ihre Gläubiger von den negativen Wirkungen der Dollarentwertung mehr betroffen sind als die USA selbst. Während der Dollar vordem dadurch politisches Instrument der USA war, daß andere Nationen ihn als Weltgeld benötigten und verdienen wollten, rührt die erpresserische Macht des amerikanischen Kredits heutzutage wesentlich aus seiner Existenz als riesiger Schuldenberg, der überall auf der Welt bei Kreditinstituten und in Regierungsbilanzen aufgetürmt ist, mit seinen erratischen Kursbewegungen Märkte und Bilanzen durcheinanderbringt und die ökonomischen Kalkulationen von Kapitalisten und Nationen durchkreuzt. Diese „Macht“ des Dollar ist zwar insofern ein etwas seltsames Erpressungsmittel, als dessen Einsatz den USA selbst keinen rechten ökonomischen Ertrag bringt. Die USA können zwar die Welt mit immer mehr Dollars überschwemmen und anderen die Sorge um dessen „Stabilität“ aufhalsen; ihr eigener Kredit wird für sie dadurch aber gar nicht nützlicher. Als politisches Erpressungsmittel ist der Dollar deswegen nicht weniger wirkungsvoll: An dessen „Turbulenzen“ bemerkt die Konkurrenz nämlich, wie sehr ihr eigener Kredit von dem der USA abhängt. Das gilt auf jeden Fall für Japan, das vom Dollar nicht loskommt. Es bekommt dessen Verfall als Dauer-Krise des eigenen Kreditwesens mit, dessen Bilanzen durch die Entwertung der Dollartitel ruiniert werden. Darüber ist das gesamte Wirtschaftslebens Japans nachhaltig geschädigt und in eine Art Dauer-Depression getrieben worden. Der Entschluß Japans, in Fragen der Marktöffnung nachzugeben, verdankt sich mindestens ebenso dem Eingeständnis, daß es als Gläubiger der USA von ihnen abhängig ist und deshalb einen weiteren Dollarverfall nicht wollen kann, wie der amerikanischen Sanktionsdrohung. Die EU dagegen hat ihren Kredit schon weitgehend aus dieser Abhängigkeit vom Dollar befreit; was nicht heißt, daß sein Verfall nicht auch auf den europäischen Kreditmärkten Schäden anrichtet. Daß auch europäische Zentralbanken sich an Stützungsaktionen für den Dollar beteiligen und europäische Regierungen Mexikopakete schmollend „mittragen“, beweist eben immer beides: Ohne sie geht eine „Stabilisierung“ des Weltkredits nicht; aber auch sie können sich der Notwendigkeit zur Zusammenarbeit mit den USA nicht entziehen. Daß sie angesichts dessen an der forcierten Fertigstellung ihrer „DM-Zone“ arbeiten, ist nur konsequent.
c) „Bilateralismus“ und „Supranationalismus“ I: Wie die USA die WTO aushebeln
„Bilaterale“ Verhandlungen verkünden die USA als passende Strategie, um andere Staaten auf neue Dienste am US-Wachstum zu verpflichten. Das hat Konsequenzen für die neue Welthandelsorganisation WTO.[11] Kaum gegründet, wird diese Einrichtung von den USA inzwischen nach folgendem Muster behandelt: Nützlich, sofern sich mit ihr gegen andere etwas erzwingen läßt; zu ignorieren, wenn man alleine mehr erreicht; schädlich, wenn sie sich in Streitigkeiten einmischt, die die USA lieber auf ihre, „bilaterale“ Weise führen wollen.
Den Handelsstreit mit Japan haben die USA mit dem offenherzigen Argument nicht vor die WTO gebracht, daß nach deren Bestimmungen sie wohl mit ihrem Anliegen keine Chance hätten. Der japanischen Klage sind sie dann zwar mit einer Gegenklage begegnet, haben das aber gleich als diplomatisches Manöver offenbart, mit dem sie die handelsdiplomatische Form wahren, aber keineswegs den zweiseitigen Streit an die WTO abtreten wollten. Nach Beendigung des Streits haben die Japaner ihre Klage zurückgezogen, und dem WTO-Chef blieb nur die etwas matte Stellungnahme, natürlich sei es ihm genauso recht, wenn Nationen sich gleich untereinander einigten. Gleich bei dem ersten großen Streitfall zwischen den Weltwirtschaftsmächten hat sich erwiesen, daß die USA die WTO nicht als Forum akzeptieren, dessen Entscheidungsprozeduren sie ihre handelspolitischen Interessen unterwerfen. Als Aufsichtsinstanz, deren Vorschriften die Gegensätze zwischen den Wirtschaftsmächten in die Gestalt eines „Regimes“ von Erlaubnissen, Verboten und Ausnahmen kleiden, ist die WTO gleich nach ihrer Gründung prinzipiell entwertet.
Kürzlich haben die USA die Staatenwelt mit der Ankündigung schockiert, sie würden den neu ausgehandelten Vertrag über Finanzdienstleistungen einfach nicht mitunterzeichnen[12], weil die Angebote der anderen Nationen sie nicht befriedigen. Zugleich haben sie beschlossen, ab sofort Neuankömmlingen auf dem US-financial-service-market den umfassenden Meistbegünstigungsstatus[13] zu verweigern. Welche Nation bei ihnen in dieser Abteilung wieviel „darf“, entscheiden die USA jetzt selektiv danach, welche Rechte amerikanische Banken, Brokerhäuser und Versicherungskonzerne auf dem jeweils anderen Markt eingeräumt bekommen, ganz im Sinne ihrer Finanzbranche,
„die glaubt, bei zweiseitigen Verträgen schneller Zugang zu den Märkten der Entwicklungsländer zu erhalten… Andererseits scheut sich Washington, die Verhandlungen mutwillig zu sprengen. Die US-Vertreter haben nicht versucht, einen Abschluß der Dienstleistungsgespräche zu verhindern, wie dies formal möglich gewesen wäre.“ (HB 26.7.95)
Die anderen Nationen daran zu hindern, ohne sie zu einer Vereinbarung zu kommen, haben die USA offenbar nicht für nötig gehalten. Die EG hat sich daraufhin zur neuen handelsdiplomatischen Führungsmacht aufgeschwungen und dafür gesorgt, daß doch noch ein „Interimsabkommen“ auf 2 Jahre zustandegekommen ist. In dieser Sphäre herrscht also jetzt die ziemlich einmalige Lage, daß es einerseits ein WTO-Abkommen über Finanzdienstleistungen auf Grundlage des Meistbegünstigungsprinzips gibt, andererseits die größe und kapitalkräftigste Nation der Welt sich an diesem Abkommen nicht nur nicht beteiligt, sondern ankündigt, nach Gusto mit anderen Staaten ihre privaten Regelungen auszumachen; mit denen können sie die WTO dann nach 2 Jahren als vollendete Tatsachen konfrontieren, die dann in einem Gesamtabkommen zu berücksichtigen seien. Eine gewisse Unübersichtlichkeit kommt eben schon heraus, wenn die größte Weltwirtschaftsmacht sich anschickt, für mehr „fairness“ im Welthandel zu sorgen.
d) „Bilateralismus“ und „Supranationalismus“ II: Die „neue wirtschaftliche Architektur“
Mit den Resultaten dieses ganzen Theaters sind die USA nicht recht zufrieden. Ihnen entgeht nicht, daß sie mit ihrer Erpressungsmacht zwar hier und dort einiges erzwingen können, dabei aber wichtige „Partner“-Nationen gegen sich aufbringen und ihrem Ideal eines einseitig nützlichen Welthandels nicht recht näherkommen. Lockerlassen wollen die USA in ihrem Projekt nicht; an den Reaktionen ihrer Partner / Gegner bemerken sie aber den Widerspruch, der in dem Vorhaben liegt, diese mittels angedrohter Schädigung zur Kooperation zu bewegen. Daraus erwächst ihr Bedürfnis, diese Auseinandersetzungen in eine neue, verläßliche diplomatische Form zu überführen, einen neuen „Ort“ zu schaffen, wo „über alles“ gesprochen werden, Streitigkeiten „im Vorfeld“ ausgeräumt werden oder zumindest die Reaktion der Kontrahenten berechenbarer gemacht werden könnten. Mit „vertrauensbildende Maßnahmen“ sollen Gegensätze in den Griff gekriegt und diplomatisch entschärft werden, gerade weil mit ihrem Aufbrechen gerechnet wird.
In diesem Sinne propagiert die US-Politik, die Wirtschaftsbeziehungen mit Japan auf ein „neues Niveau“ zu heben:
„Die USA lehnen den bisherigen bilateralen Mechanismus bei der Ausräumung von Handelshindernissen ab, da es neben der Belastung der Gesamtbeziehungen zu Erschütterungen im Welthandelssystem kommen könne. Gleichzeitig sei aber eine Behandlung im multilateralen Rahmen nicht möglich, da die WTO hierzu kompetenzmäßig noch nicht in der Lage sei und die Entscheidungsfindung aufgrund ihre diversen Mitgliederkreises zu zeitaufwendig sei. Neuer Ansatz einer strategisch angelegten Handelspartnerschaft mit Regelungen im bilateralen, regionalen und multilateralen Kontext sei eine Vorgehensweise, bei der Japan und die USA sich regelmäßig über ihre langfristigen Ziele im Welthandelssystem abstimmen… Voraussetzung hierfür sei eine wirkungsvolle Deregulierung in Japan und die Entschlossenheit auf beiden Seiten, die bestehenden Abkommen in die Tat umzusetzen und die auch gemeinsam zu überwachen.“ (HB 31.7.95)
Eine ziemlich ehrliche Auskunft: An den Handelsstreitigkeiten, die die USA vom Zaun brechen, gefällt ihnen die Nebenwirkung nicht, daß sie Unfrieden stiften. Der WTO unterwerfen wollen sich die USA aber auch nicht, weil sich da zuviele Interessenten in ihre Angelegenheiten einmischen. Die Lösung: Erstens müßten sich die Japaner in wirtschaftsdiplomatische Dauerverhandlungen „einbinden“ lassen, in denen sie den USA immer sagen, was sie vorhaben, damit die USA ihnen sagen können, ob sie das dürfen. Zweitens müßten die Japaner sich zu einer gemeinsamen Dauerüberwachung ihrer eigenen Vertragstreue bereitfinden. Dann gäbe es keinen Streit mehr und die Welt des Handels wäre wieder geordnet. Ob da gewisse Erinnerungen an die erfolgreiche amerikanische Rüstungsdiplomatie Pate gestanden haben?
Das amerikanische Ideal einer „neuen Weltwirtschaftsordnung“ besteht in dem ziemlich banalen Verlangen nach einer „Struktur“, die sicherstellt, daß der Rest der Welt sich nach ihren Interessen richtet. Keineswegs wollen die USA zurück zu dem Supranationalismus von IWF und GATT; diese Institutionen beurteilen sie als zunehmend unbrauchbare Mittel für’s US-Interesse, weil die Konkurrenten in ihnen zuviel zu sagen haben. Zurückhaben wollen sie die Leistung, für die sie einst IWF und GATT erfunden haben. In diesen Institutionen war der Führungsanspruch der USA als internationales Recht allgemein gültig gemacht – was sich allerdings weniger den Institutionen als der praktischen Gültigkeit dieses Führungsanspruchs verdankte. Jetzt möchten sich die USA gerne als Zentrum eines neuen Systems bi- und multilateraler „Zonen“ wieder in den Mittelpunkt des Welthandels rücken. In diesem Sinne bieten sie Europa einen neuen „transatlantischen Dialog“ an:
„Wir wollen den Vorschlag eines transatlantischen Wirtschaftsdialogs fördern – Gesprächen zwischen amerikanischen und europäischen Unternehmen sowie den Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks über die Gestalt und Tagesordnung der zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten… Politiker in Amerika und Europa haben in der Erkenntnis, daß die transatlantischen Beziehungen ein Fundament haben müssen, neue Bande vorgeschlagen… Es scheint klar zu sein, daß wir uns auseinanderzuentwickeln drohen, wenn wir keine Architektur zur Unterstützung unserer Beziehungen haben. Das wäre eine Tragödie – nicht nur, weil Europa unser getreuer Freund und Verbündeter ist, sondern auch wegen der daraus resultierenden wirtschaftlichen Rückschläge.“ (Garten, AD 3.5.95)
Das ist im Ausgang schon ein etwas anderes Projekt als vormals IWF und GATT. Hier bietet nicht die einzige Supermacht anderen Staaten ihren Weltmarkt an; vielmehr warnt die noch relativ mächtigste Weltwirtschaftsmacht, was passieren könnte, wenn die andere, wichtige Weltwirtschaftsnation es mit ihrem „Auseinanderdriften“ auf einem gemeinsamen Weltmarkt zu weit treibt. Daraus spricht einerseits der Realismus der USA, die wissen, daß sie gegenüber der Wirtschaftsmacht EU nicht so ultimativ auftreten können wie gegenüber Japan, ohne sich selbst zu schaden; andererseits das Ansinnen, ihren prinzipiellen Standpunkt von der EG anerkannt zu bekommen. In den Wirtschaftsbeziehungen mit dem „partner in leadership“ hätten sie eben gerne so etwas wie eine fundamentale Verläßlichkeit – nicht nur aus ökonomischen Gründen.
B. Die Internationalisierung des amerikanischen Kapitals
1. USA und Weltmarkt: Identitätsverlust
a) Die Not der USA: Der Weltmarkt versagt seine Dienste
Das Pochen des US-Staates auf die feststehende Konkurrenzfähigkeit, ja, Konkurrenzüberlegenheit „seines“ Kapitals, die Umsetzung dieser Überzeugung in ein Recht „amerikanischen“ Kapitals auf ausgezeichnete Geschäfte, das staatsanwaltliche Deuten auf andere Staaten, die dieses Recht aushebeln würden, der Aktionismus der „neuen Strategie“, der unzulässige Hindernisse aus dem Weg räumen soll – all das erwähnt den banalen Grund der Unzufriedenheit des US-Staates nur, um ihn sogleich in dieser Dialektik von (staatlichen) Untaten und Taten verschwinden zu lassen: Das Kapital, das der amerikanische Staat so zuversichtlich das seine nennt, bringt der Nation nicht die Erträge ein, die sie braucht. Sie hat sich, wie jede andere kapitalistische Nation auch, von diesen Erträgen abhängig gemacht und ist nun mit der problematischen Seite dieser Abhängigkeit konfrontiert. Ihr Lebensstandard – daß man den nicht mit dem Wohlergehen der Einwohner verwechseln kann, dafür bietet gerade Amerika Anschauungsmaterial genug – ist in Gefahr: Dem Staat fließen nicht die Mittel zu, die er für die Aufrechterhaltung seines Ordnungsrahmens, daheim und weltweit, in finanzieller und in militärischer Hinsicht, für notwendig hält, also auch benötigt.
Die Abhängigkeit dahingehend zu akzeptieren, daß Ansprüche und Ziele der Nation entlang einer ernüchterten Einnahmen-Ausgaben-Rechnung niedriger gehängt werden müssen, kommt einerseits nicht in Frage, eigentlich für keine „führende Industrienation“, für die Weltführungsmacht gleich gar nicht. Und sie haben ja auch Vorsorge getroffen: Unter „Mitteln“ rangieren schon längst nicht mehr bloß Steuern und Gebühren, „echte“ Einnahmen, sondern ebenso die eigenen Mittel des Staates, die er routinemäßig in Gestalt seiner (wachsenden) Verschuldung Geldanlegern in aller Welt anbietet. Damit verschafft er sich insoweit Unabhängigkeit von seinen laufenden Einnahmen, als er nicht dauernd Programmänderungen aufgrund konjunktureller Aufs und Abs vornehmen muß, sondern im Gegenteil sozusagen vorpreschend Maßnahmen für das „langfristige Wachstum der Volkswirtschaft“ erbringen kann; und dieser finanzielle Einsatz für seine Wirtschaft, dieser Stabilitätsvorschuß auf ihre nicht zuletzt dadurch wachsende Zukunft wird von seinen Geldgebern, den (Geld)kapitalisten als funktional akzeptiert und mitfinanziert. Womit schon klar ist, daß dies doch keine Methode ist, die Abhängigkeit des Staates von „seinem“ Kapital wieder aufzuheben; denn gewährt wird ihm diese Verschuldung ja nur insoweit, als seine Schuldzettel als Kapital wirken, d.h. sich als Mittel der privaten Geldvermehrung seiner Gläubiger bewähren.
Es ist also andererseits auch klar, daß Bescheidenheit die Probleme der USA gar nicht lösen würde. Deren große Kampagne ist ein einziger Beweis dafür, daß das mit den fehlenden Mitteln ernster aufzufassen ist. Von einer Finanzklemme kann nicht die Rede sein, vielmehr ist überhaupt das gewohnte Maß der staatlichen Finanzkraft (incl. Verschuldung), also auch Wucht und Reichweite seines Ordnungsrahmens grundsätzlich verschoben; das gewohnte, „organische“ Verhältnis von kapitalistischen Erträgen und darauf aufbauenden staatlichen Finanzfreiheiten ist nicht mehr gegeben.[14] Der Sache nach liegt – entgegen allem demonstrativem Stolz auf die große Klasse des „american business“ – eine Beschwerde über mangelhafte Ertragskraft des Kapitals für die Nation vor. Und zwar in diesem abstrakten Sinne: Nicht Maschinenbau oder Landwirtschaft, Banken oder Exporteure, bringen es nicht, sondern „amerikanisches“ Kapital in all seinen Existenzweisen liefert die Erträge nicht, auf die Bedürfnisse und Notwendigkeiten von Staat und Nation bauen. Umgekehrt – an den Clinton’schen „Lernprozeß“ erinnernd – sind alle unternehmens- oder branchenbezogenen Maßnahmen zur Wiedererlangung kapitalistischer Ertragkraft letztlich ungenügend, wären – in der ideologischen Ausdrucksweise Ron Browns – das falsche „picking winners“.
b) Der Weltmarkt als Lebensmittel der USA
Das Aufschlußreiche und Ironische liegt in dem, daß die USA hier auf etwas rekurrieren, was sie jahrzehntelang als un-amerikanisch, ja, un-kapitalistisch zurückgewiesen haben, nämlich den nationalen Bezug des Kapitals. Was darunter zu verstehen ist, erschließt sich aus einem Blick darauf, wie sie ihren nationalen Erfolg bewerkstelligten, wie sie die Abhängigkeit des nationalen Erfolgs von der Geschäftstätigkeit des Kapitals für sich organisierten:
Die einmal unschlagbare Güte amerikanischen Wachstums beruhte auf der Nicht-Trennung von innerem und äußerem Markt. Es waren ja zuerst bloß die US-Unternehmen, die die Kapitalkraft aufbrachten, den Warenverkehr über die Grenzen hinweg in Gang zu setzen und Produktionen auf fremden Märkten aufzuziehen. Was unter „Freiheit des Kapitals“ zu verstehen war, konnte man dem entnehmen, was sie sich, die Maßstäbe der Konkurrenz setzend, dabei zutrauten und welche Freiheiten sie sich dabei herausnahmen. Im Zuge ihrer Ausdehnung entstand der Weltmarkt und von ihrem eigenen Staat verlangten sie im wesentlichen, für die Gültigkeit ihrer profitlichen „Freiheit“ in aller Welt zu sorgen. Diese internationale Tätigkeit „seines“ Kapitals brachte dem US-Staat die gewünschten Erträge ein, die wiederum keiner besonderen staatlichen Beobachtung und Förderung bedurften. „Nationaler Ertrag“ war im Falle der USA nämlich weitaus ausgreifender zu verstehen denn als Handelsbilanzüberschuß oder Gewinntransfers. Dieser „Ertrag“ bestand in der Qualität des Dollars, der die Geschäfte des sich erweiternden Weltmarkts an allererster Stelle initiierte und der dann folgerichtig aus eben dieser Erweiterung seine immer neue Bestätigung und Vermehrung erfuhr – und dieser „Ertrag“ stattete wiederum die Geburtsnation der „Multis“ mit einer im kapitalistischen Lager unerhörten Finanzkraft aus, die es ihr jahrzehntelang erlaubte, ein sogenanntes „chronisches Zahlungsbilanzdefizit“ zu ignorieren. Für die amerikanische Nation war dieses Defizit ja nichts anderes als das weiterhin stattfindende Verschmelzen aller Märkte unter US-kapitalistischer Anleitung, war nur der Ausweis für den weltweiten Aus- und Siegeszug „ihres“ Kapitals. Daß es so etwas wie ein Auseinandertreten von Internationalisierung des Kapitals und nationalem Ertrag geben könne, schien dieser Nation, deren Erfolgsweg doch die Internationalisierung war, undenkbar. Ihre Abhängigkeit vom Wirken „ihres“ Kapitals hatte sie optimiert, indem sie es zum Kapital der Welt machte, es also auch aller Welt zur Verfügung stellte. Darunter war dann nicht mehr nur das Kapital distinkter amerikanischer Unternehmen zu verstehen, sondern überhaupt das amerikanische (Welt-)Geld in all seinen Spielarten von der Banknote bis zum Staatskredit; dieses Geld war seinerzeit die exklusiv gültige Materie und Darstellung der Kapitalvermehrung.
Offenkundig ist diese Identität von Wachstum des Weltmarktes und Dollar gebrochen: Das „chronische Defizit“ der USA ist jetzt ein Defizit, ist Reduktion ihrer Finanzkraft. Die Lösung des Problems eines den Lebensstandard der Nation angreifenden Mangels an Erträgen können die USA umgekehrt nur in der Wiederherstellung dieser Identität sehen. Als „Analyse“ für die schlechte Lage bietet die „neue Strategie“ an: Staaten lassen amerikanische Unternehmen auswärts nicht zum Zuge kommen; diese „Analyse“ ist zugleich die „Lösung“: Amerikanischem Kapital wird in aller Welt mehr Geschäft erschlossen – und die klare Unterstellung ist, daß die Erträge daraus Amerika zugutekommen. Jetzt hat aber doch amerikanisches Kapital sich die Welt erschlossen – und der amerikanische Staat führt Beschwerde über ausbleibende Erträge, über gebrochene Identität. Dieses „Mehr“ kann weder Analyse noch Lösung sein. Und wenn der US-Staat in neuer Weise den nationalen Bezug herstellen und „amerikanische“ Erträge für sich dingfest machen will, stellt sich die Frage: ‚Was ist eigentlich „amerikanisches“ Kapital‘? Oder anders gefragt: Gibt es denn eine ökonomische Rationalität in der politisch geforderten Gleichung ‚Mehr Geschäftsmöglichkeiten für US-Kapitale = Mehr Erträge für US-Kapitale = Mehr Erträge für den US-Staat‘?
2. Kapitalfreiheit und Staatenkonkurrenz
a) Inter-nationaler Handel…
Der moderne Weltmarkt ist frei: Das Wirtschaftsleben aller Nationen ist inzwischen „Teil“ eines alle Nationen übergreifenden Welt-Geschäfts. Außenhandel und grenzüberschreitende Kapitalanlage sind nicht mehr bloße Ergänzungen und nützliche Beiträge zu nationalen Märkten, das Verhältnis hat sich umgedreht: Umfang, Verlauf, Auf und Ab der nationalen Produktion bestimmen sich wesentlich vom Verlauf und den Konjunkturen des internationalisierten Geschäfts her. Die „ungeheure Warensammlung“ die den kapitalistischen Reichtum ausmacht, läßt sich deshalb auch nicht mehr nach lokaler Herkunft auseinanderdividieren. Für die Produzenten und Händler sind nationale Grenzen keine Abschottungen mehr, die einen inneren Markt von auswärtigen Geschäftsgelegenheiten trennen; deshalb bieten sie auch keinen Schutz mehr vor unliebsamer Konkurrenz. Für die Geschäftswelt sind die nationalen Wirtschaften nurmehr „Standorte“: Die Innenverhältnisse aller Nationen sind als Bedingungen und Mittel des Geschäfts prinzipiell im Angebot und werden nach diesem Maßstab praktisch verglichen. Nationale Besonderheiten aller Art zählen dabei als „Faktoren“ einer Kostenrechnung, in der ganz BWL-mäßig neben Preisen, Löhnen, Kreditleichtigkeit und Transportkosten auch Größen wie Steuern, Subventionen, Infrastruktur, „sozialer Frieden“ als „Aufwand“ für zu erwartenden Ertrag bewertet und zum Argument für und gegen Export- und Anlageentscheidungen gemacht werden.
Der Weltmarkt ist also auch fair: Insofern, als sich alle nationalen Wirtschaften am gleichen Maßstab, nämlich als Gelegenheiten zum Geldverdienen für weltweit agierende Unternehmen vergleichen lassen müssen. Auf den Märkten anderer Nationen haben amerikanische Konzerne in Gestalt europäischer und japanischer Multis einerseits Konkurrenz bekommen, haben sich andererseits mit ihnen zu Konglomeraten verschmolzen, deren nationale Zuordnung nur noch eine Erinnerung daran ist, wo sie einmal herkamen. Im Zuge dessen hat auch das einmal einzigartige Weltgeld Dollar Konkurrenz bekommen: Kapitalisten und Finanzer können beim Zugriff auf Ressourcen, Anlagegelegenheiten und Kredit zwischen drei „Weltgeldern“ wählen; der Nationalkredit der USA muß sich als Mittel der Reichtumsvermehrung mit dem von Deutschland/Europa und Japan vergleichen lassen. Und die US-Konzerne nehmen die Gelegenheit zweier konkurrierender Weltgelder, in denen sich die „Freiheit des Kapitals“ ebenbürtig abwickeln läßt, selbstverständlich wie alle anderen wahr. Sie haben eine Art Landesverrat begangen, nämlich ihre internationale Tätigkeit dahingehend zu „überspannen“, daß sie in ihrem Geschäftstreiben den Dollar zunehmend weniger berücksichtigen – anderes Geld entsprechend mehr. Im Ergebnis ist dann eben – das ist in „Freiheit“ und „Fairness“ eingeschlossen, ist das Resultat von Durchmischung und Durchrassung – endgültig nicht mehr auszumachen, welches einzelne Geschäft welchem Land und welcher Währung nützt. Nur im Durchschnitt und Gesamtresultat geben die Veränderungen der Währungsverhältnisse Auskunft darüber, wo es das Kapital in seiner Masse hinzieht; was am schlagendsten in der Tautologie ausgedrückt ist, daß eine Währung „stark“ ist, weil „man“ sie für „stark“ hält.
Auch darüber sind den neuen Weltwirtschaftsnationen in ihrem Nationalkredit souveräne Mittel erwachsen, um auf auswärtigen Reichtum zuzugreifen und die restliche Staatenwelt auf ihre Interessen zu verpflichten. Sie müssen nicht mehr eine nationale Geschäftswelt anhalten und ausrüsten, um Dollar zu verdienen; sondern verfügen in ihrem eigenen Kredit über ein attraktives Angebot, das das internationale Kapital gerne nutzt.
Für das „amerikanische“ Kapital heißt das: Seine gewinnträchtige Leistung, den Weltmarkt anzupacken, zu erweitern und mit seinen Standards zu versehen, mündet zum einen in seine Normalisierung, insofern es Kapitale anderer Herkunft vor sich hat, die in Sachen Größe und Produktivität zumindest aufgeholt haben. Zum anderen ist es überhaupt jetzt erst internationalisiert, wenn sein früher quasi automatischer Rückbezug auf bzw. in den Dollar durchschnitten ist und wenn es sorgfältig gute Beziehungen zu verschiedenen politischen Herren pflegt. Man kann es auch so sagen: Das amerikanische Kapital hat die Internationalisierung betrieben, es hat sich darüber internationalisiert – und jetzt stellt der US-Staat an den Wirkungen fest, daß dieses internationalisierte Kapital nicht mehr automatisch „seines“ ist.
b) …politisch organisiert, beaufsichtigt und betreut
Mit Ausmischung der Staaten aus dem Welthandel hat diese Freiheit des Weltmarkts nichts zu tun – im Gegenteil. Das Bedürfnis nach freiem Zugriff auf alle nationalen Ressourcen geht vom Kapital aus; diesem Bedürfnis Rechnung zu tragen und für seine weltweite Durchsetzung zu sorgen, war und ist Sache der Nationen. Diese nehmen ihren Grenzen das Trennende, indem sie ihre Erlaubnisse und Verbote, den grenzüberschreitenden Handel und das Wirtschaften auf ihrem Territorium betreffend, unter dem Gesichtspunkt des Handelshemmnisses und der Förderung internationalen Geschäfts besichtigen und ihre Gesetzeswerke in der Absicht neu fassen, dem Kapital mehr Freiheiten zum grenzüberschreitenden Geschäftemachen zu schaffen. Von diesem Standpunkt aus unterliegen sämtliche hoheitlichen Regelungen, angefangen von Zöllen und Einfuhrvorschriften bis hin zum nationalen Rechtssystem und der Wirtschaftsgesetzgebung, dem prüfenden Blick des Staates, was er durch Neufassung dieser Vorschriften dafür leisten kann, um sie zu funktionalen Mitteln der Ingangsetzung und Beförderung grenzüberschreitenden Geschäfts umzumodeln.
Auch in den nationalen Debatten ist dem Ruf nach „mehr Markt, weniger Staat“ unschwer zu entnehmen, wofür er steht. Er löst sich stets auf in den Antrag auf eine alternative Wirtschaftspolitik und bildet die ideologische Begleitmusik zu Forderungen, die eine andere staatliche Betreuung des Geschäfts mit rechtlichen Regelungen, Steuern und Kredit verlangen. In Welthandelsaffären sind die Souveräne gleich selbst die Anwälte der „Freiheit des Marktes“, und ihr Auftreten ist nie mit dem Beschluß des Staates zu verwechseln, sich als Politik aus „der Wirtschaft“ herauszuhalten. Vielmehr erweitern da politische Mächte ihre Zuständigkeit für den Gang der Geschäfte auf das Ausland, dessen nationale Vertretungen mit mehr oder minder erpresserischen Angeboten auf eine Wirtschaftspolitik verpflichtet werden müssen, die den eigenen Bilanzen dient. Den Staaten ist es nur deshalb und insofern um die Freisetzung des Kapitals zu tun, als sie mit ihren nationalen Einkünften aus dem internationalen Geschäft profitieren wollen; also wollen sie die Rechte, die sie fremdem Kapital bei sich gewähren, auch als Pflichten der anderen Nation gegenüber der eigenen Geschäftswelt verankert wissen. Den Handelspartner, dessen Geschäftsgelegenheiten ausgenutzt werden sollen, beäugen sie als Konkurrenten, dessen Vorteile aus dem gemeinsam neu und frei organisierten Geschäftsleben nicht als eigene Beschränkung zu Buche schlagen sollen. Das Hin und Her von Waren und Kapital über die Grenzen, das sie freisetzen, besichtigen alle Nationen laufend unter dem Gesichtspunkt, wie gut oder schlecht sie sich dabei stellen. Unter diesem Gesichtspunkt modifizieren sie laufend ihr eigenes Vorschriftenwesen; sie schaffen Geschäftsgelegenheiten, verändern Konkurrenzbedingungen und drängen auf neue oder veränderte internationale Vereinbarungen, die ihnen nützen. Die Staaten mischen sich im Zuge der Internationalisierung des Kapitals nicht nur nicht aus dem Weltmarkt aus, sondern entwickeln im Gegenteil ständig neue Verfahren und Regelwerke zu dessen Organisation, Betreuung und Beaufsichtigung. Sie sind daheim wie auswärts die unerläßlichen Garanten der Gültigkeit der neuen Freiheiten des Kapitals – und zugleich diejenigen, die deren Gültigkeit zugleich dauernd im Interesse des nationalen Vorteils bestreiten, wo immer sie die Macht und die Mittel dazu haben.[15]
Staaten, die sich so zum Geschäft des Kapital stellen, haben sich zum Standort umdefiniert: Die Attraktion des internationalen Kapitals ist ihr Lebensmittel. Also orientieren sie ihre ganze Wirtschaftspolitik an diesem Mittel: Sie unterwerfen sich dem Standortvergleich des Kapitals, den sie wollen, indem sie ihre Machtmittel zum Einsatz bringen, um ihn zum eigenen Vorteil zu beeinflussen.
c) Der fertige Weltmarkt: Ein Gemeinschaftswerk
Auf dieses „System“ haben sich die USA – auch wenn sie heute gerne über eigene „Rücksichten“ schimpfen – nicht eingelassen, sondern sie haben es überhaupt eingerichtet und vorangetrieben. Den anderen Staaten waren sie insofern ein verpflichtendes Vorbild, als die neuen Zugangsrechte, die dem Kapital zu den Märkten aller Nationen geschaffen wurden, von Anfang an ihr Kapital freisetzten[16]; da war es leicht, den Anwalt des „Niederreißens“ von Zöllen und anderen Handelsbarrieren zu machen – mit viel Freiheitspathos, versteht sich. Anders die „Partnerstaaten“, die als Mit-Träger einer weltweiten Kapitalisierung vorgesehen und selber ebenso entschlossen waren, sich in der damit eröffneten weltweiten Konkurrenz nach vorne zu bringen: Diese konnten sich den allumfassenden amerikanischen Freiheits-Standard anfangs schlicht und einfach nicht erlauben. Sie brauchten für ihre rückständigen Volkswirtschaften Schutz und „Ausnahmen“, eine bevorzugte Förderung des nationalen Kapitals. Nur so konnte es ihnen gelingen, das zu ihnen hereinströmende amerikanische Kapital national dingfest zu machen, indem man ihm nämlich nationale Sonderangebote unterbreitete, sich an der Aufrüstung des nationalen Kapitals hinsichtlich Größe und Produktivität zu beteiligen – damit dieses international aktionsfähig werde!
Die nationale Wirtschaftspolitik der aufstrebenden Konkurrenz, ihre Pflege von nationalem Kapital und Export war den USA lange Zeit durchaus recht. Nicht, weil es ihnen etwa altruistisch um „gleiche Konkurrenzbedingungen“ gegangen wäre oder aus höherer Einsicht in die Abhängigkeit amerikanischen Wachstums vom Wachstum auswärtiger Märkte. Sondern aus dem schlichten Grund, daß dieses auswärtige Wachstum den USA tatsächlich zugutekam und das amerikanisches Kapital sich mit deren Benutzung zugleich seine kapitalistische Überlegenheit sicherte. Deshalb waren die USA auch in aller Regel durchaus einsichtig und kompromißbereit, wenn die neuaufstrebenden kapitalistischen Mächte in GATT, IWF und Weltbank auf Konkurrenznachteile verwiesen und auf Ausnahmen und Sonderregelungen, auf das Recht zur schrittweisen Akkomodation ihrer Wirtschaft an die neuen Freiheiten drängten. Damals sahen die USA in solchen Anträgen noch den Beleg dafür, daß die anderen Nationen mit der Wucht ihres Reichtums eben nie würden mithalten können.
Die USA haben die Internationalisierung des Kapitals als Projekt in die Welt gebracht; die anderen Wirtschaftsmächte haben sich dem angeschlossen und unter Einsatz ihrer nationalen Mittel das Beste für sich daraus gemacht. Gemeinsam haben sie der Geschäftswelt neue Verdienstchancen und -gelegenheiten eröffnet, diese hat sie ergriffen und tatsächlich ein weltweites Wachstum des Kapitals zustandegebracht. So konnten sich die USA lange Zeit glatt einbilden, sie als Aufsichtsmacht und Hauptnutznießer dieses „ihres“ Systems hätten ein unschlagbares Erfolgsrezept für ihren, nationalen Ertrag aus diesem Weltmarkt geschaffen.
C. Die USA in der Krisenkonkurrenz
Daß das Funktionieren des Weltmarkts nicht mehr mit Wachstum von amerikanischem Kapital zusammenfällt, ist den Funktionären der Weltmacht Nr. 1 klar geworden – und unerträglich dazu. Bei ihrer Schuldzuweisung an die Konkurrenz übersehen sie freilich eine Hauptsache: Mit dem Wachstum ist es derzeit auf dem gesamten Weltmarkt nicht so weit her. Es ist Krise.
Es ist die vollzogene Internationalisierung des Kapitals – das US-Kapital vorneweg –, die den Weltmarkt fertiggemacht und überfüllt hat: mit Ansprüchen auf Kapitalverwertung, die nicht erfüllt werden können. Ironisch: Das System des freien Welthandels hat den Nachweis seiner Leistungsfähigkeit erbracht, es hat nicht nur nationale Handelshindernisse beseitigt, sondern auch die Schranken der Akkumulation internationalisiert; die USA sind mit dem kapital-logischen Resultat der von ihnen betriebenen Befreiung der nationalen Wirtschaften zur Weltwirtschaft konfrontiert. Wenn Expansion des Weltmarktgeschäfts derzeit einfach nicht zustandekommen will, hat das nichts damit zu tun, daß dem Kapital irgendwelche nationalen Märkte verschlossen wären bzw. vorenthalten würden – ganz im Gegenteil. Daß das Kapital derzeit nicht noch mehr Akkumulation zustandebringt, hat weder geographische noch politische Gründe, sondern liegt in dem Zweck begründet, dem sich dieses Wachstum verdankt, und den Mitteln, die das Kapital dafür einsetzt. Gerade, indem Kapitalisten aller Nationen alle Standorte nutzen – als Rohstofflieferanten, Produktionsstandorte, neue Märkte – produzieren sie die Schranken rentierlicher Anlage mit, an die sie dann stoßen. Unter Ausnutzung des Kredits führen sie einen kostensenkenden Kampf um wachsende Marktanteile, stellen die Welt mit Fabriken voll und überschwemmen sie mit Warenmassen. Damit türmen alle Kapitalisten gemeinsam einerseits immer neue Ansprüche auf Ertrag aufeinander und beschränken zugleich die zahlungsfähige Nachfrage derer, deren Arbeitskraft sie als Mittel ihrer Überschüsse beanspruchen. So bringen sie es periodisch so weit, daß der „letzte Grund aller Krisen, die beschränkte Konsumtionskraft der Massen“ (Das Kapital, Bd. III, 501) zutagetritt und die „Massenkaufkraft“, die sie als Lohn beschneiden, ihren Dienst an der Realisierung wachsender Gewinne versagt. Am Ende ist dann periodisch zuviel Kapital angelegt, als daß es sich insgesamt noch lohnend verwerten ließe.
Die Kapitalisten aller Nationen führen ihren Konkurrenzkampf derzeit darum, wessen Kapitaleigentum die fällige Entwertung auszubaden hat. Neue „Wachstumsmärkte“ und Geschäftsgelegenheiten lassen sich nur noch auf Kosten der Konkurrenz auftun und eingefahrene Erträge dienen wesentlich der Kompensation von Verlusten, die an anderen Fronten verbucht werden.
Die Staaten ziehen daraus den zwingenden Schluß: Wenn ihnen der Weltmarkt die Erträge, deretwegen sie ihn ausgebaut haben, verweigert, dann haben sie die Verpflichtung des weltweit tätigen Kapitals darauf, zugunsten ihrer Bilanzen zu wirtschaften, vernachlässigt. Sie nehmen Partei für das von ihrem Territorium aus agierende Kapital, stiften in Privatisierungskampagnen solches mit erheblichem Aufwand an öffentlichem Kredit, suchen – mit den Waffen von Steuer- und Kreditpolitik – dessen weltweite Expansion auf Kosten anderer zu befördern, und kennen sich aus bezüglich der Konkurrenz, die es zu verdrängen gilt, weltweit. Sie entdecken und produzieren am internationalisierten Kapital zunehmend nationale Qualitäten.[17]
Es handelt sich also um ein Ausschlußverfahren, in dem Staaten, denen das Kapital nicht genug hergibt, nicht kapitalkritisch werden, sondern gegeneinander losgehen. Es geht ihnen mehr oder minder offen um Umverteilung, wobei sie sich ideologisch als Protagonisten eines „neuen“ Wachstums anpreisen. Waren früher die Eingriffe der Staaten in den freien Waren- und Kapitalverkehr darauf gerichtet, sich bei der Erweiterung des Weltmarktes (wachsende) Anteile an Land zu ziehen, so geht es nun darum, sich gegenseitig die Anteile zu beschränken. Die Maßnahmen, die sie zur Förderung ihres Kapitals, zur Sicherstellung nationaler Erträge, einleiten, sind kein Beitrag zum Wachstum mehr, sondern Abzug an anderer Stelle. Das geht reihum, also sind sie sich alle gegenseitig Ärgernis.
Dieser neuen Lage tragen die USA auf ihre, supermachtmäßige Weise Rechnung. In der Krise halten sie daran fest, daß allseitiges Niederreißen nationaler Handelsbeschränkungen erstens das Erfolgsrezept für eine allseitig wachsenden Weltmarkt war, und daß zweitens sie als Protagonist dieses Programms lange Zeit gut damit gefahren sind. Diese historische Wahrheit verfechten die USA jetzt, da die Überakkumulation ihnen Schäden zufügt, als Ideologie und als besonderes nationales Erfolgsrezept, indem sie den Zusammenhang erstens umdrehen – Nicht-Wachstum = zuviele Marktschranken – und zweitens offensiv, als nationales Ausschlußprogramm gegen ihre Konkurrenten richten.
Wenn sie heutzutage energisch ihr Postulat „Freiheit der Märkte“ vertreten, dann sorgen sie, so umfassend wie sie ihren nationalen Zugriff auf Weltmarkterträge definieren, an erster Stelle für eine Revision der erreichten Freiheiten: Fremde Kapitalisten haben in den USA zu kaufen, auswärtige Märkte haben ihre Umsätze und Gewinne bei amerikanischem Kapital abzuliefern, deren politische Hüter haben dies in amerikanischem Auftrag durchzusetzen. Die amerikanische Forderung nach freiem, vom Staat unregulierten Handel löst sich auf in die Forderung nach Diensten fremder Souveräne an amerikanischen Erträgen, nach dem Einsatz von deren Macht im US-amerikanischen Interesse.
Ihr Verlangen, andere Nationen hätten ihnen Erträge abzutreten – als ob Japan und EG da etwas übrig hätten –, dokumentiert, daß sie von Schranken, die ihnen ihr ökonomisches Lebensmittel setzt, nichts wissen wollen; und es dementiert jede Objektivität der Schranke, an die sie stoßen. Es stellt sich damit auch ignorant zu dem Umstand, daß das den Konkurrenten abverlangte Mehr nur durch deren weitere Schädigung zu haben ist, also auch bedeutet, daß diese auch als Käufer und Anlagesphären für amerikanisches Kapital noch weiter ausfallen. In dem Maße, wie die USA mit ihrem Projekt Erfolg haben, machen sie die Erträge aller Nationen aus dem Weltmarktgeschäft noch weiter unsicher.
Das zeigt sich am Ergebnis des letzten Handelsstreits mit Japan. Als erstes erscheint es ja unmittelbar absurd, ausgerechnet einer Nation, die gerade unter einer Kreditkrise und einer Rezession leidet, mit dem Anwurf zu kommen, sie würde zuviel verdienen und solle gefälligst etwas hergeben. Die USA interessieren sich – aus den ausgeführten Gründen – überhaupt nicht dafür, ob Japan etwas herzugeben hat; ebensowenig, wie sie sich dafür interessieren, daß nationale europäische Fluggesellschaften derzeit eine nach der anderen pleitegehen und zusätzliche amerikanische Konkurrenz wohl kaum gebrauchen können. Sie sehen die Sache ganz borniert so, daß da überhaupt Geschäft läuft, an dem sich verdienen läßt, von dem andere Nationen also wohl auch profitieren – und sie nicht.
Das Entscheidende ist aber: Diese Absurdität hat einen harten ökonomischen Inhalt. Blöderweise ist der Weltmarkt nämlich gar kein Topf, dessen Gesamtinhalt sich, ohne Schaden zu nehmen, bei etwas gutem Willen aller Beteiligten auch anders auf die Nationen verteilen ließe. Vielmehr begeben sich die Staaten über den Weltmarkt in die Abhängigkeit von auswärtigem Wachstum, auf das sie sich bei der Pflege ihres Binnenmarktes verlassen. Hinzugehen und anderswo Geschäft wegzunehmen, um es für sich selbst zu verwenden, zerstört den nützlichen Zwangszusammenhang der aufeinander angewiesenen Profitmacherei. Das amerikanische Starren auf japanische Handelsbilanzüberschüsse als Abzug an der amerikanischen Bilanz sieht erstens großzügig darüber hinweg, daß diese Überschüsse lange Zeit den amerikanischen Bilanzen genutzt haben, als Quelle produktiver Kapitalanlage in den USA und der Finanzierung der amerikanische Staatsschuld. Es will zweitens nicht zur Kenntnis nehmen, daß diese Überschüsse derzeit auch den japanischen Bilanzen nicht nützen, also recht besehen auch gar keine Überschüsse sind – nämlich in dem einzigen, kapitalistischen Sinne, in dem es auf Überschüsse ankommt, daß sie zur Wiederanlage taugen würden. Viel teure Yen – in Fernost kracht gerade das Bankensystem – stellen gar kein Mehr japanischen Kredits dar, der sich zu Kapital machen ließe; daran ändert sich im übrigen auch nichts, wenn der Yen wieder fällt.
Einer anderen Nation mit dem Verlangen zu kommen, sie solle politisch für die „Umleitung“ von Kauf und Verkauf auf die Orderbücher der eigenen Kapitalisten kommen, könnte ja zu Zeiten eines allseits wachsenden Weltmarkts noch angehen: Dann geht vielleicht das eine oder andere Geschäft kaputt, dafür profitiert ein anderes. Wenn die Überakkumulation von Kapital eingetreten ist, fügt die Beschädigung privater Geschäfte der bereits bestehenden Beschränkung des Marktes eine weitere hinzu, verschärft sie also. Dann sind amerikanische Exporte eben kein Beitrag zu einem expandierenden japanischen Markt, dessen Produzenten sich dann mithilfe von Kredit, Rationalisierung etc. auf neue Konkurrenzbedingungen einstellen müssen und dies auch tun, sondern treten unmittelbar an die Stelle bisherigen japanischen Geschäfts auf einem beschränkten Markt, erzeugen bei japanischen Kapitalisten bloß weitere rote Zahlen und unterminieren noch zusätzlich zuerst den japanischen, dann den internationalen Kredit.
Es ist also nicht nur so, daß die USA mit ihrem Dringen auf eine politische Korrektur ihrer Bilanzen nicht recht vorankommen. Sie tragen – gerade wegen ihrer ökonomischen Macht und der Allseitigkeit, mit der sie ihr Anliegen vortragen – nicht unmaßgeblich dazu bei, die Krise des Weltmarkts zu verschärfen. Wahrgenommen wird dies vor allem in der Sphäre der Handelsdiplomatie: Die US-Regierung sieht sich in der eigenen Öffentlichkeit zunehmend mit dem Vorwurf konfrontiert; weniger als Führer denn als als Störenfried des Welthandels aufzutreten, der andere Nationen unnötig gegen sich aufbringt.[18] Dabei bezwecken die USA auch in den Methoden, mit denen sie auf ihre Konkurrenten losgehen, nicht den Abbruch von Geschäft. Ihre Sanktionsdrohungen sind als Demonstration gemeint; sie sollen plastisch vorführen, was alles an Schaden eintreten könnte, wenn amerikanischen Wünschen nicht Genüge getan wird. Auch die amerikanische Politik hat ja ein Bewußtsein davon, daß die US-Wirtschaft den Schaden, den die USA anderen Nationen mit der Verweigerung von Marktzugang androhen, selbst gar nicht gebrauchen kann, Sanktionsdrohungen also eine ziemlich zweischneidige Waffe sind. Es ist nur so, daß sie über andere nicht recht verfügen.
Der Schaden, den die US-Politik mit solchen Sanktionsdrohungen anrichtet, liegt nicht nur in den unmittelbaren ökonomischen Wirkungen, die deren Durchsetzung auf Produktion und Märkte in beiden Nationen hätte. Er betrifft die zwischenstaatlich geregelten, verläßlichen Bedingungen für das Kaufen, Verkaufen und Investieren auf dem Weltmarkt. Mit der Drohung, zwecks politischem Druck auf eine andere Regierung eine ganze Geschäftssphäre außer Existenz zu setzen, konfrontieren die USA die internationale Geschäftswelt mit einer „Standortbedingung“ etwas neuer Art. Sie darf sich fragen, ob „so etwas“ zur üblichen Praxis einer Nation werden könnte, die ebenso unzufrieden mit dem Verlauf des Weltmarkts wie mächtig genug ist, da ziemlich viel zu unterbinden. Mit ihren politischen Diktaten, aber auch schon mit deren Androhung bringt die größte Weltwirtschaftsnation ein Moment politischer Unberechenbarkeit ins Geschäftsleben, auf das sich Kapitalisten nun einzustellen haben.[19] Dieser auf die Geschäfte des gesamten Weltmarkts gerichtete Protektionismus
, der sich mit der Ertragslage der kapitalistischen Firmenwelt nicht abfinden will und mit nationalökonomischen Strategien das Recht auf weltweite Reichtumsquellen anmeldet, befördert keineswegs das „Wachstum“. Eher schon den Willen, der konkurrierenden Staaten bzw. Blöcke, mit demselben Vorgehen dagegenzuhalten. Insofern als sich dabei die Mitglieder des Vereins „freier Westen“ auch über ihren nationalen Bedarf in Sachen „Lohn, Preis und Profit“ hochoffiziell in die Quere kommen, beleben sie von den Niederungen des Geldmachens her die Streitkultur, die mit der schönen Losung „Neue Weltordnung“ in Aufsichtsfragen in Bezug auf den Gewalthaushalt der Nationen, längst herrscht.
[1] Das Handelsministerium hat ein ‚advocacy center‘ eingerichtet, das allgemein ‚Kriegszimmer‘ genannt wird…‚Kriegszimmer‘ mag nach Adventure Games klingen, aber der Name ist nicht bloß so dahingesagt. ‚Unsere nationale Sicherheit ist so eng verwoben mit unserer ökonomischen Sicherheit, daß wir das betrachten müssen wie einen Krieg,‘ sagt ein hoher Beamter.
(Newsweek, 6.3.1995)
[2] Schaut man nach, wie sich die „new strategic vision“ hier niederschlägt, ist man geneigt, einen Anflug von Lächerlichkeit zu entdecken. Der US-Konsul in Hongkong schafft es, den Chinesen die Füße und Flügelenden amerikanischer Hähnchen zu verkaufen, die sonst zu Tierfutter verarbeitet würden; der Botschafter in Südkorea veranstaltet eine Autoverkaufsschau auf dem Rasen seiner Botschaft; eine hoher Diplomat in Indien gewinnt einen Vertrag für ein amerikanisches Kraftwerksunternehmen, indem er sich mit „Küßchen und Umarmungen“ an die dortigen Verantwortlichen ranwirft; der Botschafter in Japan macht zwei Jahre hauptsächlich Werbung für Motorola usw. An ihrer Ausbildungsakademie müssen sich amerikanische Botschafter neuerdings einem Programm namens „Diplomacy for Global Competitiveness“ unterziehen, wobei sie von Managern belehrt werden, Unterricht in Verkaufsstrategien erhalten und Rollenspiele durchexerzieren, die den Handelsgesprächen mit Japan nachgestellt sind.
[3] Mit dieser Neudefinition außenpolitischer Prioritäten ist das Projekt „Reformen für Amerika“, mit dem Clinton noch vor 3 Jahren sein Volk betörte, endgültig passé. Dieses Programm war ziemlich widersprüchlich.Einerseits meldete es den Zweifel an, ob Amerika bei Entwicklung und Ausbeutung seiner nationalen Potenzen nicht einige Nachlässigkeiten unterlaufen seien; die Frage wurde aufgeworfen, ob Amerika nicht ein paar notwendige Fortschrittstechniken vernachlässigt habe. Andererseits sollte das keineswegs mit einer Kritik am „american way of (economic) life“ verwechselt werden, sondern ganz im Gegenteil dessen feststehende Einmaligkeit und Überlegenheit bloß aufpolieren. Eher halbherzig aufgetischte Reformversuche scheiterten an der sinnvollen demokratischen Vorkehrung, daß sich keine Mehrheiten dafür fanden: Dem größeren Teil der Repräsentanten des amerikanischen Volkes wollte einfach nicht einleuchten, warum Amerika an sich herumdoktern solle, wenn es doch sowieso unvergleichlich ist; oder umgekehrt: die reformerischen Eingriffe in die amerikanische Manier der freien Konkurrenz wären deren Verhunzung und der sichere Weg ins unerträgliche Mittelmaß – „big government“ heißt das von den Republikanern aufgebrachte und dem Volk sehr einleuchtende Haßwort. Diese Kritiker treibt das schlichte Ärgernis, daß in drei Jahren „Reformpräsident“ Amerikas Führungsrolle nicht stabiler geworden ist; sie müssen nur noch dazusagen, das wäre Ergebnis dieser „Reformen“ bzw. allein schon eines un-amerikanischen Denkens in diese Richtung. Dadurch ist die Umkehrung nicht richtig, aber als politische „Schlußfolgerung“ zwingend: Worauf sich Amerika nur verlassen kann, ist: der souveräne Gebrauch seiner Macht. Der Präsident hat also selbst diese Lehre aus seinen innenpolitischen Niederlagen und der wachsenden Intransigenz seiner auswärtigen Gegenüber gezogen und beschlossen, an der ökonomischen Waffe der Nation nicht herumzureformieren, sondern sie gegen die Konkurrenten durchzusetzen. Vgl. GegenStandpunkt 4-92, S.121, Die USA in der Krise
[4] Ich kann mich an eine nicht sehr weit zurückliegende Zeit erinnern, als man als Geschäftsmann das Gefühl haben mußte, nicht nur keine Hilfe vom Außenministerium zu bekommen, sondern sogar nach dem Motto behandelt zu werden ‚Wir machen uns die Hände nicht mit geschäftlichen Angelegenheiten schmutzig. Wenn Sie ins Gefängnis wandern, rufen Sie uns an.‘
(Commerce Secretary Ron Brown, ebd.)
[5] Ron Brown drückt das folgendermaßen aus: „(Frage:) Wie steht es mit ‚Industriepolitik‘? Betrachten wir mal den Modebegriff ‚picking winners‘ (etwa: einzelne Unternehmen staatlich bevorzugen, herauspflücken), ein Begriff, den die Republikaner immer benutzten, um eine solche Politik anzugreifen. Sie suchen doch gewisse Industriezweige heraus und empfehlen sie. Das kann man doch nur als ‚picking winners‘ bezeichnen. Brown: ‚Picking winners‘ meint, man nimmt zum Beispiel ein Unternehmen her und tut dies oder jenes, um es zum ‚winner‘ zu machen. Wir vertreten (we advocate) jedoch die Interessen eines jeden amerikanischen Unternehmens, das zu einem ausländischen Wettbewerber in Konkurrenz steht. Ich glaube nicht, daß damit Gewinner und Verlierer ‚herausgepflückt‘ werden, außer: amerikanische Gewinner gegenüber ausländischen Verlierern.“ (Newsweek, ebd.)
[6] Dieser Widerstreit ist dem amerikanischen Anliegen immanent: Ist das Einräumen von Rechten und Mitteln die Erweiterung der eigenen Macht oder ihr Teilen? Also meldet sich jetzt auch wieder die die Fraktion, die am „Partner“ immer schon die niederzuhaltende Seite des Konkurrenten bedauerte und befürchtete, mit ihrem „Immer schon gewußt“ zu Wort. Sie sieht die Sache so, daß ihre 40-jährigen Kritik am falschen Gebrauch der Macht nun recht bekommt: Wenn man so lange die Gefahr unterschätzt hat, darf man sich nicht wundern, wenn sie schließlich Wirklichkeit wird und leistet damit ihren nützlichen Beitrag zur nationalen Nabelschau: Wie geht der richtige Gebrauch der Macht? Nämlich in Form des immer schon vorliegenden und nun einzulösenden Rezepts: Diesen Fehler nicht mehr machen, dann geht die Gefahr auch weg.
[7] Vgl. GegenStandpunkt 2-94, S.40: Die amerikanisch-japanische Partnerschaft – So frei ist der Welthandel
[8] Die USA verpflichten ihre Autoproduzenten per Gesetz, auf jedem Autoteil dessen „nationale“ Herkunft kleinlichst zu vermerken – von wegen „japanische Bürokratie“. Das führte bei der Interpretation des neuen Abkommens schon wieder zu einem Streit um nationale Wertschöpfung… Die japanische Regierung lehnt die amerikanische Formel ab, die in Wagen aus Japan den US-Gehalt an Teilen messen soll… So dürfen Teile aus kanadischer Fertigung als amerikanische Produkte bezeichnet werden. Weil aber japanische Unternehmen auch Teile aus Kanada beziehen oder dort produzieren, wollen sie gegenüber amerikanischen Produzenten eine Gleichbehandlung.
(HB 8.8.95)
[9] Der Streit, den Kodak gegen Fuji vom Zaun gebrochen hat, ist für diesen Standpunkt höchst aufschlußreich. Ausgangspunkt ist die Feststellung, daß Kodak in allen maßgeblichen Teilen der Welt bei Filmen ca. 40% Marktanteil hat – nur in Japan nicht. Der „Schluß“ aus dieser Feststellung heißt: Dann muß der Konkurrent Fuji im Verein mit der japanischen Politik mit unlauteren Machenschaften verhindert haben, daß wir da den gleichen Anteil erringen wie sonst überall. „40% Marktanteil“ erscheint so als das quasi naturhaft gegebene Resultat einer existenten Weltmarkt-Konkurrenzfähigkeit, für deren Nichtgelten Japan haftbar zu machen ist. Diese Argumentation beschwert sich gar nicht darüber, daß man in einen Markt nicht hineinkommt, sondern setzt Marktzugang mit dem Erfolg auf ihm gleich und reflektiert damit haargenau den Standpunkt der amerikanischen Politik.
[10] Darum geht’s beim Streit zwischen „Internationalisten“ und „Isolationisten“. Einigkeit herrscht im Ziel: Das Kommando über die Kontrahenten muß erhalten bleiben, umso zwingender, je mächtiger sie sind. Die „Isolationisten“ sind seit jeher der Auffassung, daß man es gar nicht soweit kommen lassen darf, daß man fremden Interessen Rechnung tragen muß; das halten sie schon für den tendenziellen Verlust des Kommandos. Ihr Rezept heißt: Keine Umstände – die Kommandogewalt sichern, indem man sie umstandslos anwendet. Dieses Handling halten die „Internationalisten“ für ungeschickt, da man damit Widerstand provoziert, den man zwar sicherlich überwinden kann, der aber unnötige Reibungsverluste bewirkt. Sie halten es damit, den „Partnern“ die Vorteile der Unterwerfung unter Amerika vor Augen zu halten. Bei einem rücksichtslosen, ideell „isolationistischen“ Gebrauch amerikanischer Macht muß man auch mit großen Schäden für Amerika rechnen – will man das? Zur Demonstration dieses Vorteil sind „isolationistische“, dezidiert einseitige Aktionen dann wiederum durchaus nützlich…
[11] Vgl. GegenStandpunkt 2-94, S.26: Vom GATT zur WTO
[12] Diese Abteilung des Weltgeschäfts war bei Gründung der WTO aus deren Regelungen zunächst ausgeklammert worden, weil man sich nicht auf gemeinsame Prinzipien einigen konnte. Das ist insofern nicht verwunderlich, als es sich bei diesen „Dienstleistungen“ über die Sphäre des nationalen Kreditgewerbes handelt, dessen bedingungslose Öffnung für auswärtige Kapitalanlage den Kredit der Nationen endgültig zum bloßen Spielball der internationalen Spekulation herabsetzt. Dagegen kennt jede Nation ihre mehr oder weniger wirksamen Schutzmechanismen: Staatsbanken, Beteiligungsvorschriften, Festlegungen, welche Institute welche Geldgeschäfte tätigen dürfen, Bedingungen des Zugangs zu Zentralbankmitteln, Regelungen für die Ablieferungspflicht für Devisen, des Ab- und Zuflusses von Geldkapital etc. etc. Dennoch hatten die WTO-Mitglieder sich auch hier prinzipiell zur „Liberalisierung“ verpflichtet. Bis Mitte 1995 sollte eine ergänzende Vereinbarung abgeschlossen werden; zu diesem Behufe legten die Nationen Angebote vor, auf wieviel „Liberalisierung“ ihres Banken- und Versicherungswesens sie sich einlassen würden.
[13] Das Prinzip der „Meistbegünstigung“ ist ein Kernprinzip des modernen freien Weltmarkts: In ihm verpflichten sich alle GATT- bzw. WTO-Mitglieder, alle Rechte, die sie einer Nation auf ihrem Markt einräumen, allen anderen WTO-Mitgliedern ebenfalls zu gewähren.
[14] Die Republikaner, positiv denkend, mögen zwar mit ihrem Gesetz zum automatischen Abbau der Staatsschulden die Stärkung der Finanzkraft im Visier haben, tatsächlich geben sie aber erst mal nur diesen negativen Tatbestand zu Protokoll.
[15] Das Beispiel EWG-EG-EU zeigt anschaulich, erstens, wieviel staatlichen Aufwand es braucht, um das Handelshemmnis „Staat“ Stück für Stück wegzuräumen; zweitens, wie sehr der „staatsfreie“ Binnenmarkt des darin partiell geeinten Gesamtstaats Europa staatliches Werk ist; der ist gar nicht „zurückgetreten“, sondern hat sich mit dieser Außengrenze umso wuchtiger aufgebaut.
[16] Nicht nur in Deutschland, auch in den USA wurde es als kleine Sensation empfunden, als der deutsche Konzern VW das erste Mal den „Sprung über den Ozean“ schaffte.
[17] Der kürzlich unter Federführung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Schröder veranstaltete „Autogipfel“ hat es soweit getrieben, die sogenannten „amerikanischen“ Firmen Opel und Ford aus dem „deutschen“ Auto auszuschließen. Unbekümmert darum, daß es sich um durchaus standorttreue und in der DM eingehauste Kapitale handelt!
[18] Sofern das Argument von der Konkurrenz kommt, ist es Heuchelei: Die hätte gerne weiter die Leistungen der amerikanischen „Führung“ für den Weltmarkt, ohne sich ihr unterordnen zu müssen.
[19] Wie das geht, zeigt die Reaktion japanischer Firmen auf die Sanktionsdrohung. Da die USA Anfang Mai angekündigt hatten, den Strafzoll rückwirkend zum 20. 5. zu erheben, wenn bis Ende Juni kein Abkommen zustandekäme, haben einige Firmen bis zum 20.5. soviel importiert wie irgend möglich und danach bis Vertragsabschluß nichts mehr. Bereits das hat zum Rückgang der Gesamtimporte japanischer „Luxusautos“ geführt.