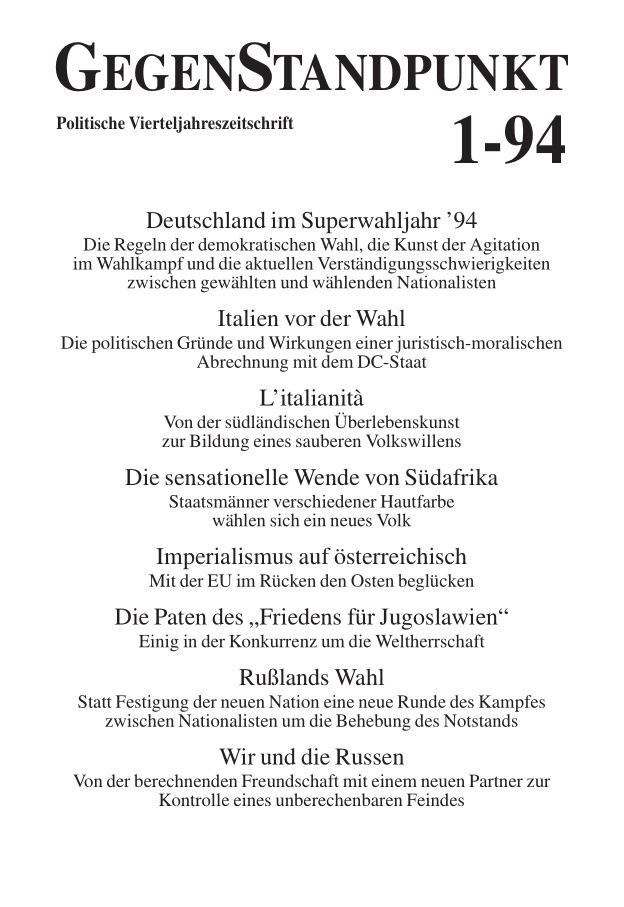Die sensationelle Wende von Südafrika
Staatsmänner verschiedener Hautfarbe wählen sich ein neues Volk
Die Wahrheit der Demokratisierung Südafrikas: Eine Revolution von oben hebt die bisherige Staatsraison auf; der Rassistenstaat schafft seine bisherige völkische Basis ab, gibt sich ein neues Volk und macht aus den ehemaligen Terroristen vom ANC eine staatstragende Kraft. Die sehen das auch so, dass das jetzt für den Kapstaat ansteht nach dem Verschwinden des Ost-West-Gegensatzes und dessen Auswirkungen auf Südafrika bis hin zum Boykott durch die imperialistischen Staaten und der folgenden ökonomischen Krise. Also wird aus dem vom ANC versprochenen Nutzen einer politischen Änderung für die unterdrückten Schwarzen die Freiheit zur Unterordnung unter die Notwendigkeiten einer jetzt auch von ihnen gewollten marktwirtschaftlichen Eigentumsordnung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Apartheid – Organisationsweise und Erfolg des rassistischen Staats
- II. Das System der Apartheid hat sich seinen Feind geschaffen, den African National Congress
- III. Ausbau und Reform der Apartheid
- IV. Die krisenhafte Wende: Das Auseinandertreten von rassistischem Staatsprogramm und imperialistischer Erfolgslage
- V. Idealismus und Realismus einer staatlichen Neugründung
- Das geplante Programm
- Die Wirklichkeit der Demokratisierung: Eine Revolution von oben und eine neue Bürgerkriegslage
- Die Verwandlung von Trägern des alten Staates in Terroristen und Problemfälle
- Die Verwandlung der Terroristen von gestern in eine staatstragende Kraft
- Die politische Vernunft des ANC
- Das Problem des neuen schwarzen Staatsvolks
- Absolut unvereinbare Anliegen
- Die Konsequenzen: Von Wahlprozeß zur neuen Bürgerkriegslage
Die sensationelle Wende von
Südafrika
Staatsmänner verschiedener Hautfarbe
wählen sich ein neues Volk
Die Weltöffentlichkeit hat einen einfachen und klaren Begriff von dem, was am Kap vor sich geht: Demokratisierung. Das soll erstens eine gute und zweitens eine notwendige Sache sein. Alle Welt sieht einen Fortschritt an Zivilisation, wenn sich die „verkrampften“ Buren mit ihren Schwarzen endlich an einen Tisch setzen und das Menschenrecht aufs freie und geheime Wählen auf die schwarze Bevölkerungsmehrheit ausdehnen. Die Gewährung des allgemeinen Wahlrechts gilt als so unbestreitbar gut, daß dem lebenslangen Funktionär der Apartheidpolitik de Klerk alle Sünden des Regimes, dem er diente, verziehen sind. Die Weltöffentlichkeit findet nichts dabei, daß ihm gemeinsam mit dem jahrelangen Opfer der Apartheid, dem ANC-Chef Nelson Mandela, der Friedensnobelpreis verliehen worden ist.
Was am Wahlrecht für die Schwarzen so gut sein soll, will die freie Welt gar nicht wissen, der mit dem Ende des Ostblocks die Unwiderstehlichkeit des demokratischen Ladens endgültig zu Kopfe gestiegen ist. Daß sich die materielle Lage der im Elend lebenden Schwarzen durch Wahlen und durch die Besetzung von Staatsämtern mit schwarzen Politikern bessern würde, wird von den Befürwortern von „Normalisierung“ und „Modernisierung“ dieses Staates jedenfalls erst gar nicht behauptet. Demokratie ist selbst der Wert, um den es zu gehen hat – egal, ob sie sonst noch für etwas gut ist.
Auch die Gründe dafür, daß die weißen Rassisten an der Staatsspitze auf einmal Demokraten werden und weiße Privilegien aufgeben, sind Demokraten kein Rätsel: Unrecht Gut gedeiht nicht! Der Ausschluß der Schwarzen von der politischen Mitsprache konnte nicht gut gehen, wenigstens nicht auf Dauer und nicht länger als hundert Jahre. Der Wende in Südafrika entnimmt der politische Betrachter die Lehre von der Unausweichlichkeit der Demokratie, der er ohnehin anhängt. Das gefällt ihm. Er hält die Entwicklung trotz des Terrors, der sie begleitet, und der Opfer, die sie kostet – 18000 Tote in den ersten 9 Monaten des Jahres 1993 –, eben einfach für gut, notwendig und normal.
Nichts davon stimmt. Es stimmt nicht, daß sich die rassistische Unterdrückung der Schwarzen nicht hätte fortsetzen lassen; immerhin erlebt man ja keinen Umsturz durch das Volk, keine Machtübernahme von siegreichen Aufständischen. Die „Verfassungsreform“ ist aber auch nicht nur der Austausch einer Regierungsform durch eine zeitgemäßere, wie es der Titel „Demokratisierung“ nahelegt. In Südafrika geschieht vielmehr etwas Unerhörtes: Eine Revolution von oben hebt die bisherige Staatsraison auf; der Rassistenstaat schafft seine bisherige völkische Basis ab und gibt sich ein neues Volk.
Daß daran nichts „normal“ ist, daß die Einführung des allgemeinen Wahlrechts nichts mit einem gewöhnlichen demokratischen Machtwechsel zu tun hat, beweist schon das Ausmaß an Gewalttätigkeit, das der Übergang zu den nobelpreiswürdigen Zuständen hervorruft. Wegen des „Demokratisierungsprozesses“ geraten die politischen Kräfte Südafrikas jetzt mindestens ebenso heftig aneinander wie bisher wegen der „rassischen Diskriminierung“. Die Abschaffung der Apartheid, die den jahrzehntelangen Bürgerkrieg beenden sollte, hat nichts dergleichen bewirkt, sondern einen neuen Bürgerkrieg mit neuen Koalitionen und neuen Fronten auf die Tagesordnung gesetzt. Wenn jetzt ein Großteil der Nation um jeden Preis die politische Reform verhindern will, die die anderen für absolut unabdingbar halten, dann verrät dies, daß die Grundlagen eines ganzen Staates auf dem Spiel stehen.
Der Gegenstand der Auseinandersetzung, die Apartheid, beinhaltet ja auch mehr als nur die Frage des allgemeinen und freien Wahlrechts für alle Bürger. Sie ist das Organisationsprinzip einer Herrschaft, die einem Teil der Bevölkerung den Status des Staatsvolks versagt, ihm prinzipiell alle daraus sich ergebenden Rechte und Pflichten vorenthält und diese ausschließlich für einen anderen Bevölkerungsteil reserviert.
I. Apartheid – Organisationsweise und Erfolg des rassistischen Staats
Die Sortierung in ein weißes Staatsvolk und ein schwarzes Unvolk
Südafrika war das erste Land Afrikas, in dem die koloniale Herrschaft zu Ende ging. Jedoch haben nicht die kolonisierten Eingeborenen die Fremdherrschaft des britischen „Mutterlands“ abgeschüttelt; dies entließ vielmehr schon 1910 die erst ein paar Jahre zuvor unterworfenen Burenrepubliken Transvaal und Oranjefreistaat zusammen mit der schon früher eroberten Kapkolonie und Natal in die von den weißen Kolonisten selbst regierte Südafrikanische Union. In ihrem Rahmen setzten die Buren, die die Mehrheit der weißen Bevölkerung stellten, den Kolonialismus auf eigene Rechnung fort. Die Apartheid – „getrennte Entwicklung“ – war die Antwort der seit 1948 herrschenden burischen Nationalpartei auf die Entkolonialisierung, die nach dem zweiten Weltkrieg in Afrika selbständige Staaten mit schwarzen Führern und einem schwarzen Staatsvolk entstehen ließ. Während der ganzen Kolonialzeit waren die Neger rechtlos gehalten und als ein Menschenmaterial behandelt worden, das den europäischen Kolonialmächten und ihren Statthaltern, Pflanzern und Bergwerksbesitzern entweder zur Verfügung oder im Wege steht und weggeräumt wird. Die Apartheid gab der Ausgrenzung der schwarzen Bevölkerung aus dem weißen Siedlerstaat die Form und Verbindlichkeit gültigen Staatsrechts. Die Trennung der Rassen reproduzierte die Scheidung von Kolonie und Mutterland im Inneren der zum Staat gewordenen Kolonien im Süden Afrikas, nun jedoch anders als bei der Kolonialherrschaft explizit rassistisch. Während in der Kapkolonie das Wahlrecht an Mindestvermögen und Mindesteinkommen geknüpft war und die große Mehrheit der Schwarzen wegen ihrer Armut, nicht wegen ihrer Hautfarbe von den Bürgerrechten ausgeschlossen war, wurde mit der Einführung der Apartheid die Rechtsstellung von Kolonialherren und den Objekten ihrer Herrschaft an politisch definierten Rassen festgemacht und die gesamte Bevölkerung Südafrikas danach sortiert. Der „Population Registration Act“ von 1950 unterwarf alle Individuen des Landes dem Rechtsstatus Weißer, Coloured (Mischling), Asiate oder Schwarzer.
Nur die Weißen bildeten das eigentliche Staatsvolk; die politische Gewalt, die sich auf die ihnen vorbehaltene Wahl- und Wehrpflicht gründete, war ihr Instrument zur Beherrschung der nichtweißen Bevölkerung. Das Herrenvolk beschränkte die bürgerlichen Rechte auf seine etwa 5 Millionen Mitglieder, die fast 35 Millionen Schwarzen, Farbigen und Asiaten waren ihre Untertanen und Knechte. Als Herren des Landes reservierten die Weißen für sich zu allererst das Recht auf Grund und Boden: Sie teilten das nationale Territorium in 87% weißes und in 13% schwarzes Land. In den Homelands genannten Schwarzengebieten pferchten sie die vom weißen Land vertriebenen und dort weder als Domestiken noch als Arbeiter gebrauchten Schwarzen zusammen:
„Von den [1985] ca. 22 Mio Schwarzen des Landes besitzen heute nur noch ca. 1,7 Mio eine Daueraufenthaltsberechtigung für eng begrenzte Zonen in den 87% ‚weißen‘ Gebietes, ca. 2/3 haben früher dort gelebt. Daueraufenthaltsberechtigt ist, wer entweder von Geburt an legal in solchen Zonen lebt oder seit 10 Jahren bei einem Arbeitgeber beschäftigt ist und angemessenen Wohnraum nachweisen kann. Daneben leben ca. 1,3 Mio südafrikanische Wanderarbeiter mit Verträgen über jeweils ein Jahr.“ (Südafrika, KB-Sonderheft 1985)
Die der schwarzen Bevölkerung vorbehaltenen durch „weißes“ Gebiet voneinander getrennten „schwarzen“ Landflecken waren im Wortsinn Reservate: Damit sie ihre Funktion der kontrollierten Aufbewahrung von Schwarzen erfüllen konnten, finanzierte ihnen Pretoria eine eigene Polizei und Verwaltung. Das für die Aufbewahrung der Neger bestimmte Reservatsland wurde zu Gemeineigentum erklärt, auf dem sich nur Schwarze niederlassen durften, das für geschäftliche Kalkulationen nicht zur Verfügung stand und daher von den Homelandstatthaltern an Geschäftsleute weder verpachtet, noch verkauft werden durfte. Weil diese teils unfruchtbaren, teils durch Überbevölkerung ausgelaugten Böden den zusammengeschobenen schwarzen Massen keine Existenzgrundlage boten, wurde die polizeiliche Ordnung durch die ordnungspolitische Maßnahme Hungerhilfe ergänzt. Damit Neger, die aus dem weißen Gebiet ferngehalten werden sollen, dennoch als Arbeitskräfte-Reservoir verfügbar waren, wurde die Anwerbung direkt im Homeland organisiert. Der Schein der den unterschiedlichen Rassen angeblich gemäßen, „aparten“ Entwicklung wurde durch die Fiktion perfektioniert, es handle sich bei den Homelands um Territorien, die von den zu unterschiedlichen schwarzen Nationen erklärten Stämmen selbst verwaltet und sich nach und nach zu souveränen Staaten entwickeln würden.
Diesen Homelands wurden auch die Schwarzen zugeordnet, die vorübergehend oder auf Dauer im „weißen“ Südafrika arbeiteten. Der Entzug der RSA-Staatsbürgerschaft und die gleichzeitige Verleihung des Bürgerrechts in einem der 9 Homelands vollendete die Rechtlosigkeit als Rechtszustand: Formell waren auch die Schwarzen Bürger mit allen Staatsbürgerrechten, aber nicht in der Republik Südafrika, sondern in einer der zum Ausland erklärten „Bantu-Republiken“. Die rassistischen Buren waren also gelehrige Schüler der zivilisierten Ausländergesetzgebung Europas; wie hierzulande die ausländischen Arbeiter hatten die Schwarzen im weißen Homeland nur „Gastarbeiter“-Status, waren also nur so lange geduldet, wie sie von weißen Geschäftsleuten und Farmern als Arbeitskräfte, von weißen Haushalten als Hausangestellte oder vom weißen Staat als Ordnungskräfte gegen ihresgleichen in Armee und Polizei beschäftigt wurden.
Die politische Rassenherrschaft als Instrument einer besonderen kapitalistischen Klassenherrschaft
Mit ihrer politischen Sortierung der Bevölkerung spielten die weißen Inhaber und Anhänger der politischen Macht nicht den kolonialen „Baas“ und betrieben nicht nur koloniale Exportwirtschaft mit Südfrüchten und Bodenschätzen, sondern zogen den einzigen erfolgreichen nationalen Kapitalismus in Afrika auf – und das ist nicht ganz dasselbe wie das rücksichtslose Ausschlachten des lebendigen und toten Inventars einer Kolonie für die Reichtumsbedürfnisse des Mutterlandes. Erstens hatten die südafrikanischen Staatsverwalter ein Interesse an der Mehrung des Reichtums für Südafrika, behandelten also Land und Leute als Quelle einer dauerhaften nationalen Akkumulation. Zweitens waren die großen Eigentümer und nationalen Kapitalisten weiß, aber deshalb waren nicht auch schon alle Weißen Kapitalisten. Die ökonomische Bedeutung der politischen Sortierung nach Rassen war also die Scheidung innerhalb derer, die als Lohnarbeiter dem Wachstum des Kapitals dienten; auf dieser Scheidung beruhte der südafrikanische Kapitalismus.
Der weiße Staat hat nämlich nicht dem Arbeitsmarkt und dem Bodenpreis die Entscheidung überlassen, welcher Bewerber zum Zuge kommt und wer es wie weit bringt. Er hat diese Konkurrenz gar nicht erst zugelassen und die Schwarzen staatsrechtlich, d.h. durch Gewalt auf die Rolle von Lohnsklaven festgelegt und sie der Heimat- und Bürgerrechte beraubt. Einer privilegierten Schicht weißer Lohnarbeiter stand das Heer schwarzer Lohnsklaven gegenüber. Der Status des freien Lohnarbeiters war ein Sonderrecht für die Weißen. Die Staatsgewalt unterschied ihre proletarischen Volksgenossen also auch da von den Schwarzen, wo sie die Klassenlage mit ihnen teilten; sie wurden mit einer politischen Vorentscheidung der ökonomischen Konkurrenz beglückt: Nur ihnen wurde ein Recht darauf zuerkannt, sich in Gewerkschaften zu organisieren und mit dem Kapital über den Preis der Arbeit zu streiten; nur ihnen war es vorbehalten, um die besseren Jobs in der Hierarchie der Arbeitswelt zu konkurrieren (job reservation); Weiße mußten sich keinen Nichtweißen als Vorgesetzten vorsetzen lassen; sie genossen eine bessere Ausbildung; sozialstaatliche Einrichtungen waren ihnen vorbehalten etc. Die Schwarzen dagegen verfügten über keine Vertragsfreiheit, kein Streikrecht; Arbeitsverweigerung, d.h. Vertragsbruch war bei Schwarzen keine zivilrechtliche Streitsache mit dem Vertragspartner, sondern ein Kriminaldelikt. Die Schwarzen durften sich im weißen Gebiet, wo ein wechselnder Teil von ihnen für Dienst am Profit gebraucht wurde, überhaupt nur mit staatlicher Sondergenehmigung um Arbeit bewerben. Sie bekamen Jahreslizenzen und wurden in ihr Homeland zurückverfrachtet, wenn kein Bedarf nach ihnen vorlag, wenn sie krank oder alt waren oder sich etwas zuschulden kommen ließen. In jedem Fall ihrer Unbrauchbarkeit wurden sie also einfach abgeschoben und das mit der Lohnarbeit notwendig verbundene Elend – Arbeitslosigkeit, Alter, Krankheit – so dem weißen Unternehmer und dem südafrikanischen Staat vom Leib gehalten. Unkosten dafür fielen nicht an, der Lohn war nicht darauf berechnet, irgendeine Vorsorge für diese Fälle treffen zu können. Das Entgelt, das an Wanderarbeiter fern der Heimat gezahlt wurde, mußte noch nicht einmal dafür reichen, Familie und Nachwuchs zu finanzieren (die lebten ja im Homeland) oder den Lohnempfänger selbst langfristig arbeitsfähig zu halten. Der Nachschub an Wanderarbeitern wurde nämlich auch durch die ruinöse Benutzung der Schwarzen und ihre Unterbezahlung nicht bedroht: Nicht nur aus den Reservaten Südafrikas, auch aus allen Nachbarstaaten standen stets sehr viel mehr Elendsgestalten um die Erlaubnis nach Arbeit an, als nachgefragt wurden. Der Kapitalismus der weißen Rassisten war und ist ja nach wie vor ein Magnet für das ganze südliche Afrika: Nur hier gab und gibt es überhaupt Arbeit und Geld für entwurzelte Massen.
Die rassistische Sortierung innerhalb der Arbeiterklasse bescherte dem Land ein europäisches Lohnniveau für die den Weißen reservierten höheren Posten und daneben ein Drittweltniveau der Bezahlung für die schwarzen Lohnsklaven. Die grundlegende Vorsortierung des Lohnverhältnisses entlang der Hautfarbe macht die Schwarzen nicht nur zum schlechter bezahlten Teil einer nationalen Arbeiterklasse, sondern definiert für sie einen eigenen, minderen Lohnarbeiterstatus. Umgekehrt erscheint das Lohnarbeitsverhältnis der Weißen mit seinen eingerichteten Konkurrenzprivilegien wie ein Stück Teilhabe der weißen Arbeiter am Ertrag, den weiße Unternehmen mit der Ausbeutung der Schwarzen erzielen.
II. Das System der Apartheid hat sich seinen Feind geschaffen, den African National Congress
Die rassistische Sortierung hat die Schwarzen politisiert und ihre Vertreter politisch gespalten. Die einen haben als Homelandverwalter und Schwarzenaufseher die Funktionen übernommen, die der Rassistenstaat für die Einsortierung seiner Neger vorgesehen hatte. Sie haben sich – gleichgültig gegen das Elend der schwarzen Massen – an der Macht der Weißen beteiligen lassen und dafür überkommene Stammesführerschaften produktiv gemacht. Die anderen haben gegenüber der weißen Staatsgewalt die unterdrückten Rechte der Neger vertreten und ihren Anspruch als vollwertiges Volk eingeklagt. Sie haben also der Vertreibung und Ausbeutung der Schwarzen den Auftrag entnommen, sich vor allem anderen gegen den politischen Ausschluß von der Macht zur Wehr zu setzen, und sich im ANC als politische Bewegung gegen das weiße Unrecht organisiert.
Als der ANC in den 50er Jahren gegen die Durchsetzung der Apartheidpolitik mit Bürgerrechts-Kampagnen nach dem Vorbild Ghandis protestierte, zerschlug der Staat die Demonstrationen zivilen Ungehorsams unerbittlich mit Waffengewalt und verbot den ANC als terroristische Vereinigung. Diese Verfolgung durch die weiße Staatsgewalt beantwortete der ANC mit der Ausrufung des gewaltsamen Untergrundkampfes. Damit war die Unversöhnlichkeit der südafrikanischen Staatsraison mit dem Verlangen der Schwarzen nach Bürgerrechten und einer von ihnen getragenen Herrschaft programmatisch von beiden Seiten festgestellt. Egal, ob der ANC vom Ausgangspunkt her mehr sein wollte als eine Bürgerrechtsorganisation der Schwarzen; er war es, weil – anders als zum Beispiel in den USA – die prinzipielle rechtliche und politische Gleichstellung aller Bürger in der Staatskonstruktion überhaupt nicht vorgesehen war, im Gegenteil: gerade ausgeschlossen werden sollte. Der ANC war mit seinem Programm deswegen staatsumstürzlerisch, bekam dies von der Staatsgewalt zu spüren und verstand sich umgekehrt von daher auch selber als antikoloniale Befreiungsbewegung, die, wie im übrigen Afrika auch, in der Weißenhochburg die Schwarzen an die Macht bringen wollte.[1]
Der ANC blieb mit seinem Bürgerkrieg gegen die weiße Herrschaft nicht ohne Wirkung, auch wenn er nie entfernt dahin gekommen ist, sie zu entmachten. Er hat der weißen Herrschaft ein dauerndes elementares und umfassendes inneres Ordnungsproblem beschert, dem sich der Staat stellen mußte. Daß die Schwarzen im Grunde gar nicht zur weißen Republik gehören, war ja nur die Lebenslüge der Burenrepublik, derzufolge beide Rassen sich getrennt, angeblich rassisch bedingten Eigentümlichkeiten entsprechend – eben apart – entwickeln sollten und könnten. In Wirklichkeit beruhte jedoch der Reichtum des Staates der Weißen auf der Benutzung der rechtlich Ausgegrenzten. Wirtschaft und Staat der Weißen waren also auch abhängig von den schwarzen Lohnsklaven, denen sie die Bürgerrechte verweigerten; sie waren darauf angewiesen, daß die Schwarzen für die Bedürfnisse des Geschäfts verläßlich verfügbar waren und den Bestand der fürs Geschäftsleben unabdingbaren inneren Ordnung nicht nachhaltig störten. Immerzu die Schwarzen gewaltsam wegräumen und von den Stätten der Macht fernhalten, das ging zwar, aber es ging eben um mehr. Deswegen war der ANC auch mit seinen ständigen Protesten und mit seinen Aufrufen zur Verweigerung eine staatsgefährdende politische Kraft und hat deswegen von Staats wegen laufend bürgerkriegsmäßige Reaktionen provoziert, aber auch die Überlegungen nie erlahmen lassen, wie man die Apartheid am reibungslosesten gemäß den Interessen an einer von allen Rücksichten freien Benutzung und gleichzeitigen Kontrolle der schwarzen Massen ausgestalten könnte.
III. Ausbau und Reform der Apartheid
Deswegen ist die Geschichte der Apartheid die Geschichte ihres fortwährenden Ausbaus und ihrer fortwährenden Reform: Da der weiße Staat die Schwarzen, die er in Reservate zusammengepfercht und unter Kontrolle hatte, gar nicht sich selber überlassen, sondern seinen Kapitalisten als billige Profitquelle zur Verfügung stellen wollte, erlaubte und organisierte er die Anwerbung und Ansiedlung von immer mehr Negern auf „weißem“ Gebiet. Zugleich sollten sie dort genauso zuverlässig von den Weißen getrennt und unter verläßlicher Kuratel leben, weshalb er die Millionen schwarzer Arbeiter, die in die „weiße“ Wirtschaft einbezogen waren, in besonderen Arealen innerhalb der weißen Gebiete, den townships, mehr oder weniger einkasernierte. Da die Schwarzen zur Verrichtung ihrer gewünschten Dienste nicht umhinkamen, sich auch in den Städten aufzuhalten, die den Weißen vorbehalten waren, verfeinerte der Staat die „große Apartheid“ getrennter „Staaten“ und die „mittlere Apartheid“ getrennter Wohngebiete um die „kleine Apartheid“ getrennt zu benutzender Restaurants, Busse, Parkbänke usw. Damit und mit dem Verbot der „Rassenmischung“ machte er die Apartheid bis ins Privatleben seiner verschiedenfarbigen Bürger hinein zur moralischen Pflicht, ohne daß dies für die politökonomische Funktion der Apartheid unabdingbar war.[2]
Die Kapitalisten in Südafrika wie ihre ausländischen Klassenbrüder wußten die Gelegenheit, Löhne und Arbeitsbedingungen ohne Rücksicht auf Gewerkschaften festzusetzen, als Sonderangebot zu schätzen, das ihnen der südafrikanische Staat durch seine rassistische Sortierung sicherte. Solange die Gewalt des südafrikanischen Staates die schwarzen Lohnsklaven niederhielt, vermißten die Kapitalisten keine Gewerkschaften, und solange die Zahl weißer Vorzugsarbeiter für die Besetzung der ihnen reservierten Jobs ausreichte, hielten sie sich an die job reservation. Erst als die Unruhen in den Fabriken und Bergwerken so zunahmen, daß die Geschäfte bedroht waren, erinnerten sie sich an den aus Europa und USA bekannten Vorteil von Gewerkschaften als Instrument kontrollierter, geschäftsschonender Abwicklung von Arbeitskämpfen.[3] Von da an scherten sie sich wenig um rechtliche Schranken wie die job reservation und das Verbot schwarzer Arbeitervertreter, wenn es ihre geschäftlichen Interessen geboten. Sie durchbrachen gegen den Widerstand der weißen Arbeiter die job reservation und sie erkannten schwarze Gewerkschaften zu einem Zeitpunkt als Verhandlungspartner an, an dem sie vom Staat noch als Unterabteilungen der „terroristischen Vereinigungen“ ANC, PAC usw. verfolgt wurden. So bestand auch auf dem Gebiet des Arbeitsrechts dauerhafter Reformbedarf, da die sofortige Auswechslung streikender Arbeiter zwar gelegentlich als Abschreckungsmaßnahme wirken mochte, zugleich jedoch die Rentabilität südafrikanischer Fabriken behelligte und die beständige Unruhe unter den schwarzen Arbeitern Südafrika insgesamt als Anlagesphäre von Auslandskapital in Frage stellte.
Jede neue Form der Trennung der Schwarzen von der weißen Herrenrasse, jede neue Form der kontrollierten Benutzung der Andersfarbigen schaffte dem Staat immer neue Aufgaben und Kosten in seinem Dauerkrieg um die Ausgrenzung der großen Mehrheit der Bevölkerung auf seinem Territorium und gab der Unzufriedenheit der Schwarzen und ihrem politischen Kampf neue Nahrung. Die Antwort des weißen Staates auf den Kampf gegen die weiße Alleinherrschaft war erstens die Verfolgung des ANC und anderer „gebannter“ Organisationen als Vereinigungen von Terroristen und Staatsverbrechern und die Einordnung der Bekämpfung ihres inneren Feindes in die weltweite Front gegen den Kommunismus. Durch die Kriminalisierung und Niederschlagung jeglichen Protests und Widerstands der Aussortierten wurden umgekehrt die Schwarzen so richtig zu dem, was sie in den Augen der Weißen sowieso waren: Feinde der weißen Ordnung und ein einziger bedrohlicher Unruheherd.
Zweitens versuchte der Staat, den Gegensatz zwischen den politischen Vertretungen der Schwarzen auszunutzen und ihren Kampf zu spalten, indem er „Entgegenkommen“ bei politischer „Mäßigung“ in Aussicht stellte, sowie die Selbstverwaltung in den townships und die Zulassung von sozial-friedlichen und unpolitischen Gewerkschaften anbot. Die kleine Apartheid wurde partiell abgebaut, um die große haltbar zu machen.
So mußte die RSA zwar stets einen Teil des Reichtums und des Gewaltapparats der Nation für die Durchsetzung der Apartheid aufwenden. Aber was heißt das schon, wenn die Organisation der nationalen Reichtumsproduktion und die ganze Staatsraison auf dem Ausschluß der Schwarzen beruht. Daß zur Kontrolle der ausgebeuteten Neger Unterdrückung nötig war, das war deshalb das unerschütterliche politische Grunddogma der weißen Herrschaft. In der Feier der großen Vernichtungsschlachten der „Voortrekker“ vergangener Jahrhunderte gegen die „Kaffern“ führte sich die Buren-Nation alljährlich, angeführt von den Pfaffen ihrer reinrassig-weißen Kirche, vor Augen, daß ihr kalvinistischer Gott ein’ feste Wagenburg sei und ihre Feinde in ihre Hände gegeben habe. Hindernisse auf dem Erfolgsweg der Nation hatten die Buren noch immer weggeräumt; mit Stolz benannten sie Stadt, Land, Fluß nach Blutbädern, die ihre Vorfahren bei dem Zug in das ihnen von ihrem weißen Gott verheißene, „menschenleere“ Land unter den „Kaffern“ angerichtet hatten.
Und die Regierenden hatten auch gar keine Veranlassung, an diesem Weg der Nation zu zweifeln, weil der nationale Erfolg unübersehbar war. Der Rassismus der Apartheid und der antikommunistische Kampf gegen schwarze Befreiungsbestrebungen, dem sich die verkrampften Buren verschrieben hatten, waren das passende Programm, mit dem Südafrika zu einem vollwertigen Staat und anerkannten Partner im westlichen Lager geworden ist: Mit ihrer durch politische Gewalt gestifteten nahezu schrankenlosen Verfügung über schwarze Billigarbeiter errichtete die Republik Südafrika eine kapitalistische Nationalökonomie von ansehnlichem Umfang, mit einem geschäftsfähigen nationalen Geld, internationalen Konzernen besonders im Bereich der Rohstoff-, Gold- und Diamantenproduktion, einer entwickelten nationalen Geschäftswelt, einer exportfähigen Landwirtschaft und – nicht zuletzt – einer funktionierenden Rüstungsproduktion. Sie stieg darüberhinaus durch ihre Potenzen zur unumschränkten regionalen Vormacht auf und machte alle afrikanischen Länder südlich des Äquators zu ihrem Hinterland: einerseits mit wirtschaftlichen Mitteln, solange sie Kolonien waren und soweit sie sich dann als in die „Unabhängigkeit entlassene“ Länder entschieden zum Westen orientiert und an ihren ökonomischen und politischen Abhängigkeiten nicht gerüttelt haben; andererseits durch entschiedene Gegnerschaft mit der schlagfähigsten Armee Afrikas – samt Atombombenpotential –, soweit Schwarzafrika ins falsche Lager zu geraten drohte. Von 1960 bis 1990 hat die RSA die Entkolonialisierung des südlichen Afrika maßgeblich mitbestimmt und vor allem an Namibia, Angola und Mosambik blutige Exempel ihrer Macht und ihrer Zuständigkeit für die richtige Einsortierung der Staaten in ihrem Einflußbereich statuiert.
IV. Die krisenhafte Wende: Das Auseinandertreten von rassistischem Staatsprogramm und imperialistischer Erfolgslage
Dieser Erfolgsweg Südafrikas ist allerdings zunehmend in die Krise geraten. Das Ende des Kalten Krieges – nicht erst der Untergang der Sowjetunion 1991, sondern schon ihr Rückzug aus der Weltpolitik in den 80er Jahren – brachte eine Bedingung des südafrikanischen Erfolgs ans Licht, über die sich die RSA in den Jahren ihres Erfolgs leicht hinwegtäuschen konnte. Die Rolle dieses Landes, das nie ein Drittweltland war, sondern regionale, wenn nicht gleich kontinentale Vormacht sein wollte, kam zwar zustande durch den Einsatz südafrikanischer Mittel und Militärmacht; der imperialistische Erfolg Südafrikas aber beruhte gar nicht allein darauf. Er war ein von seiten der wirklichen Weltmächte erlaubter und geduldeter Erfolg, und das wurde deutlich, sobald diese Duldung, die Gleichgerichtetheit der Interessen, die nie identisch waren, entfiel. Ganz anders als es das Triumphgeschrei vom weltweiten Sieg der Demokratie meint, der jetzt auch die Südspitze Afrikas erreicht haben soll, ist die rassistische Burenrepublik tatsächlich ein Opfer des westlichen Sieges über die Sowjetunion und der Beendigung seines weltweiten Ringens um eine antikommunistische Front. Solange es darum gegangen war, der Sowjetunion überall, also auch in Afrika, Einfluß zu entringen und Partner, die sie gefunden hatte, für die falsche Wahl zu bestrafen, ließen sich die Vormächte der NATO die Gleichsetzung der rassistischen Unterdrückung und des südafrikanischen Kampfes gegen die eigenen Schwarzen sowie gegen die entkolonialisierten „Frontstaaten“, die sich dem ANC als Rückzugsgebiet zur Verfügung stellten, mit ihrem „Kampf gegen den Kommunismus“ gerne gefallen. Die „Frontstaaten“, die aus antikolonialen Befreiungsbewegungen hervorgegangen waren, hatten sich ja tatsächlich an Moskau und Kuba um Hilfe gegen die alten Kolonialmächte gewandt, hatten ihre politischen Eliten im Osten ausgebildet bekommen und hatten sich zum Aufbau eines „afrikanischen Sozialismus“ und in der Außenpolitik zur Unterstützung des ANC-Kampfs gegen den inneren Kolonialismus der RSA bekannt. Je mehr sich aber die Sowjetunion aus Afrika zurückzog und der Ostblock zerfiel, desto mehr erschienen den USA und Europa die Kriegsaktionen der RSA als Eigenmächtigkeiten und als störende Konkurrenz gegenüber dem Einfluß der dazu eigentlich berechtigten Weltmächte.
In dem Maß, in dem der südafrikanische Regionalimperialimus kein Dienst an der westlichen Weltherrschaft mehr war, machten die Hüter von Freiheit, Gleichheit und Privateigentum Ernst mit dem Vorbehalt, den es vom Standpunkt der Demokratie aus schon immer gegen die innere Verfassung ihres südafrikanischen Partners gab und der das diplomatische Material für die Ausgestaltung der offiziellen Beziehungen zu Südafrika und zu den schwarzen Staaten abgab: Die moderne Herrschaft, die die USA nach ihrem Sieg im Zweiten Weltkrieg über den Globus verbreitet haben, bekennt sich zur Gleichheit der Menschen und zum Recht auf Selbstregierung der Völker. Mit dem inneren und äußeren südafrikanischen Verstoß dagegen konnte der Westen prima leben, solange er seinen Interessen diente. Wirklich bestritten wurde dieses Staatsprogramm, sobald südafrikanische Ambitionen der Kontrolle der westlichen Hauptmächte über Afrika in die Quere kamen. Die Hauptmächte des Westens machten auf einmal Ernst mit einem uralten Handelsboykott der UNO gegen den rassistischen Staat, der bis dahin wenig bewirkt hatte, kündigten die militärpolitische Zusammenarbeit, verhängten einen Rüstungsboykott etc.
Das hat Südafrika nachhaltig geschädigt, seine Industrie und Landwirtschaft verloren Absatzmärkte, Auslandskapital zog sich aus dem Lande zurück – die USA zwangen nationale Firmen sogar per Gesetz zur Trennung von südafrikanischen Partnern oder Tochterfirmen. Den Ausschluß vom Weltmarkt verträgt kein Kapitalismus – ein halb-kolonialer schon gleich nicht. Die RSA stürzte in die tiefste Wirtschaftskrise ihrer Geschichte und ist bis heute – ein Jahrzehnt später – nicht mehr aus ihr herausgekommen. Und nicht nur das: Was den Imperialismus dieses Landes betrifft, so konnte Südafrika die Früchte seiner militärischen Durchsetzung in der Region nicht ernten: Anstatt sich die lange bekriegten Nachbarn gefügig und untertan zu machen oder, wie bei Namibia lange versucht, sich einzuverleiben, verlor es den Einfluß auf die Frontstaaten, die sich nach dem Verlust östlicher Unterstützung an die Hauptmächte des Westens um Hilfe gegen die RSA wandten. Diese konnte die Nachbarn zwar in die Arme des Westens bomben, aber militärisch nicht dauerhaft auf sich orientieren. Der destabilisierende Einfluß Südafrikas, der zur Verhinderung der Konsolidierung linker Regime früher gerne gesehen war, wurde von den Vormächten des Westens endgültig als feindseliger Akt genommen, als er sich störend gegen Befriedungsversuche richtete, mit denen die Westmächte die Aufständischen, die sie einst gegen linke Regierungen aufgebaut und aufgeputscht hatten, nun zur Aufgabe ihres weltpolitisch sinnlos gewordenen Bürgerkriegs zu bewegen und politisch einzugliedern versuchten (Angola, Mosambik).
Erst zusammen mit dem außenpolitischen Mißerfolg – dem Verlust der Partner im Westen, dem Verlust der afrikanischen Einflußzone und ihrer ökonomischen Nutzung – addierten sich der nicht abzustellende Bürgerkrieg und die ökonomischen Einbrüche zu einer umfassenden Krisenlage der Nation, die den Dogmatismus des alten nationalen Erfolgswegs erschütterte. Kein schlechtes Gewissen über die menschenrechtswidrige Behandlung der Neger und keine antirassistische UN-Resolution haben die weißen Staatsmänner in Pretoria zum Umdenken bewegt, sondern der Mißerfolg Südafrikas als immer weiter aufstrebende, immer mehr Nationalreichtum akkumulierende und ausgreifende imperialistische Regionalmacht im Kreis der westlichen Weltmarktsnationen und Weltmächte: also das Auseinanderfallen ihres rassistischen Staatsprogramms und der imperialistischen Vorgaben und Perspektiven angesichts einer gewandelten Weltlage. Davon haben sich die angeblich so unbelehrbaren Buren belehren lassen. Außer moralischen Minderheiten oder weltwirtschaftlich orientierten Multis wollte und konnte niemand zwischen dem Nutzen, den die rassistische Ordnung den weißen Herren sicherte, und dem Erfolg des südafrikanischen Staates unterscheiden. Die Nationalpartei, die in den „guten Jahren“ für die Ununterscheidbarkeit beider Gesichtspunkte stand, wurde durch die nationale Krise – das stockende Kapitalwachstum und die außenpolitischen Mißerfolge – mit dem Unterschied konfrontiert. Die Buren waren schließlich mit all ihrem Rassismus Vertreter eines staatlichen Aufbruchs, der sich nie mehr in das Programm privater Bereicherung einer privilegierten Kaste und der Sicherung der Kolonialmacht weißer Herren zurückübersetzen ließ. Sie waren Nationalisten genug, daß ihnen in der Krise die Gleichung zwischen rassistischer Staatsverfassung und ökonomischem Erfolg, staatlicher Macht und Einfluß nach außen fragwürdig wurde, auf der die RSA beruht hatte – und Nationalisten genug, um von der Perspektive einer neuerlich und weiter aufstrebenden Macht auch innerhalb der neuen Weltordnung keine Abstriche zu machen. Lieber haben sie von ihrem rassistischen Dogmatismus Abstand genommen und sich radikal dem Programm verschrieben, den Gleichklang mit den imperialistischen Mächten wiederherzustellen und dadurch die Freiheit zur weltpolitischen Betätigung zurückzugewinnen. Im Interesse der Nation haben sie deswegen der Krise die Notwendigkeit entnommen, das Programm ‚Herrschaft durch und für die Weißen‘ auf seine Tauglichkeit für den Staat zu befragen und damit zwischen beiden erstmals zu trennen: Nicht, was die Weißen von der Apartheid haben, sondern, was die Macht des Staates davon hat, zählt. Zum ersten Mal betrachteten sie die innere Organisation, die den Burenstaat ausgemacht hat, als ein Mittel seines Erfolgs und zogen wegen der Krise seine Tauglichkeit für den davon unterschiedenen Zweck der Nation in Zweifel. Der alte Rassismus brachte nichts mehr für die imperialistischen Ambitionen der Nation – dann wollten ihre weißen Staatsmänner lieber ihre innere Staatsordnung drangeben als den auswärtigen Einfluß.
De Klerk und seine Reformer haben also Maß genommen an der Dimension von Regionalmacht, die die RSA im Kalten Krieg erreicht hat, und haben sich gerade deswegen dazu durchgerungen, umgekehrt wie früher und ebenso dogmatisch die gesamte innere Ordnung des Staates jetzt als Hindernis des äußeren Erfolgs zu betrachten. So sehr, daß sie ein Begründungsverhältnis zwischen Apartheid und den außenpolitischen Rückschlägen aufgemacht haben: So dogmatisch wie sie bis gestern alle Erfolge auf die besondere Verfassung Südafrikas und die erfolgreiche Selbstbehauptung seines Staatsvolks an der Macht zurückgeführt haben, also auch den Kampf gegen die Schwarzen für unverzichtbar hielten, so sehr erscheint ihnen jetzt umgekehrt dieser Kampf als der entscheidende Grund dafür, daß Südafrika überhaupt in die Krise geraten ist.
V. Idealismus und Realismus einer staatlichen Neugründung
Das geplante Programm
Seitdem ist Südafrikas Weißenherrschaft auch in den Augen seiner bisherigen Obervertreter nicht mehr das Gütesiegel eines zwar ständig zum Abwehrkampf gezwungenen aber darin doch erfolgreichen und sich fortentwickelnden machtvollen Landes, sondern das große Problem einer noch unfertigen Nation, weil Hemmnis bei der Bewältigung der schwierigen nationalen Lage, bei der Sammlung ihrer eigentlich vorhandenen Kräfte nach innen und der Rückgewinnung ihrer Stellung nach außen – kurz: der alles entscheidende Hinderungsgrund ihres fälligen Fortschritts. Seitdem verwirft de Klerk die „getrennte Entwicklung der Rassen“ als eine „Sackgasse der Isolation“ und will mit der Verfassungsreform einer „drohenden Marginalisierung Südafrikas“ zuvorkommen – als ob die westlichen Weltmächte wirklich nur die RSA wegen innerer Unsitten bestrafen wollten und nicht als konkurrierende Imperialisten deren Einfluß im südlichen Afrika zurückgedrängt hätten, weil sie selbst die Kontrolle darüber beanspruchen. Die coolen Rassisten, die über die Moralappelle der UNO immer nur lächeln konnten, wollen imperialistische Interessen und moralische Rechtstitel nun überhaupt nicht mehr unterscheiden und geben den ausländischen Vorwürfen Recht. Sie glauben nämlich selber an den nationalen Vorteil, der aus – nach den Maßstäben der erfolgreichen Nationen – normalen demokratischen Verhältnissen entspringt. Deswegen begreifen sie Südafrika nun als unfertige Nation und wollen sie zu einem nach innen geschlossenen und damit nach außen wieder handlungsfähigen Land zurechtreformieren.
De Klerk und seine Reformer haben sich das so schön gedacht, daß sie rückblickend überhaupt nicht mehr verstehen, wie sie es jemals vorteilhaft finden konnten, die Schwarzen zu vertreiben, zu unterdrücken und von der Mitwirkung am Staat auszuschließen. Als ob die Monopolisierung des Landes, seiner Bodenschätze und agrarischen Nutzbarkeit, die Entrechtung der Schwarzen und ihre Benutzung als nahezu kostenlose Arbeitssklaven nicht das Erfolgsgeheimnis des weißen Fortschritts vom Kolonisten zum Kapitalisten gewesen wäre, gilt die Apartheid den Reformern nun überhaupt nicht mehr als nationales Konzept sondern nur noch als partikulares Interesse der Weißen – eines, das unnötigerweise „die Schwarzen der Nation entfremdet“ hat. Die Reformer stehen auf dem Standpunkt, sie müßten den Schwarzen nur das Wahlrecht geben, und schon wären diese mit der Nation nicht nur versöhnt, also kein ständiges Ordnungsproblem mehr, sondern mit ihrer rechtlich gleichgestellten, billigen Arbeit eine mindestens ebenso profitable ökonomische Grundlage des südafrikanischen Kapitalismus wie sie es mittels der Apartheid gewesen sind. Sie ernennen „Demokratie“ zur nationalen Produktivkraft:
„Auf die Frage nach seiner Vision von Südafrika in drei oder fünf Jahren antwortete Präsident de Klerk: ‚Daß es ein blühendes Land sein wird, daß es ein stabiles Land sein wird, … daß es eine gute Verfassung haben wird, die sich auf die demokratischen und wirtschaftlichen Werte gründet, auf die die erfolgreichen Demokratien und die erfolgreichen Wirtschaftssysteme auf der ganzen Welt gebaut sind.‘“ (RSA 2000 – Weg in die Zukunft, 3/92)
Die Bereinigung der inneren Front, und die Beendigung des nicht zum Umsturz fähigen, aber auch nicht totzukriegenden inneren Aufstands und Bürgerkriegs soll die Potenzen der Nation wieder auf den wirtschaftlichen Fortschritt lenken und zweitens den Hinderungsgrund für gedeihliche Beziehungen zum näheren und ferneren Ausland aus dem Weg räumen. Durch die Beseitigung des Feindschaftsgrundes soll Südafrikas Attraktivität als entwickelte kapitalistische Wirtschaft auf die Nachbarn zur Wirkung kommen und die Vormacht auf neue Weise, nicht konfrontativ, sondern kooperativ verläßlichen Einfluß gewinnen. Gedacht ist nicht nur an eine Normalisierung der Beziehungen zu den afrikanischen Staaten, sondern an ganz neue politische Geschäftsverbindungen überregionaler Größenordnung:
„In Indien hat Außenminister Botha nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Verhandlungen über die Schaffung eines Handelsblocks am Indischen Ozean aufgenommen, der der Europäischen Union und der nordamerikanischen Freihandelszone nachgebildet werden soll.“ (FAZ, 21.11.1993)
Das sind die Aufbruchsperspektiven, für die de Klerk die Basis des Staates erweitern, d.h. die übergroße Mehrheit der Schwarzen zu Staatsbürgern machen und sich dadurch ihrer Loyalität versichern will. Dafür setzt er auf die staatsmännischen Qualitäten des alten Staatsfeinds Nummer 1: des ANC unter Führung Nelson Mandelas. Ihm und seinen Anhänger überantworten die bisherigen weißen Staatsmacher mit der Veranstaltung von demokratischen Wahlen nach den Gesetzen der Mehrheit die Macht im Staat. Der ANC erreicht damit, was er 40 Jahre lang erreichen wollte, die Staatsmacht in schwarzer Hand. Die regierenden Buren aber, die das bisherige weiße Machtmonopol aufgeben, wollen damit alle Verhältnisse, die diese Macht begründen und von ihr geregelt worden sind, endgültig unwidersprechlich, dauerhaft solide und damit ein für alle Mal funktionsfähig machen. Damit es auch so etwas wird wie der in Demokratien übliche Wechsel der Repräsentanten der Macht und nicht ein Umsturz – das fürchten die Reformer nicht zu Unrecht –, versucht de Klerk die Verfassung des Staates, besonders die Eigentumsordnung, schon vor allgemeinen Wahlen und als Bedingung ihrer Zulassung festzuklopfen. Dann, so die Idee, könnte die Eingemeindung der Schwarzen der Nation nur nützen.
Die Wirklichkeit der Demokratisierung: Eine Revolution von oben und eine neue Bürgerkriegslage
De Klerks Revolution von oben tut, als könnte sich eine Staatsführung zu einer neuen nationalen Basis bekennen – und hätte dann auch schon eine. Die Wahrheit ist das Gegenteil: Die Führung kündigt ihr bisheriges Staatsvolk auf, schafft ihre bisherige Basis ab und gibt die mit ihrem Monopol gesicherte Verfügung über alle Instrumente der Macht und die Kontrolle des Staatsapparats auf. Diese funktionieren als zuverlässige Mittel der Macht nicht mehr, wenn die bisherige Machtkonstruktion und damit die mit ihr gesicherte Staatsraison nicht mehr feststehen. An der Feindschaft, die ihr aus ihrer alten weißen Anhängerschaft entgegenschlägt, erfährt die Führung, daß sie eben doch nicht nur einen Personalwechsel an der Staatsspitze, sondern eine neue Staatsraison verordnet. Sie hat ihrem Staat erstens einmal seine vorhandene Grundlage entzogen: Sie legt die Staatsraison dem noch gar nicht einheitlich konstituierten Volk zur Beurteilung vor, setzt das Gewaltmonopol dem Urteil seiner bisher rassistisch sortierten Untertanen aus, verurteilt das bisherige Staatsvolk zum Status einer hoffnungslos unterlegenen Minderheit, verschafft damit dem staatlichen Gewaltmonopol einen neuen Gegner und setzt damit schließlich auch den Staatsapparat und das Militär dem Test auf die Loyalität zu einem Staat aus, dessen Bestand und Ausrichtung fraglich ist.
Die Verwandlung von Trägern des alten Staates in Terroristen und Problemfälle
Den Weißen entzieht der neue Staat nicht bloß alle möglichen Privilegien, sondern die alles entscheidende politische Grundlage: den Status des alleinigen Staatsvolks. Ab sofort haben sie sich nicht nur, sofern sie Proletarier sind, der freien Konkurrenz mit der Masse schwarzer Arbeitskräfte zu stellen. Die Herrenrasse sieht sich umfassend politisch mit dem „Kaffer“ auf eine Stufe gestellt und sich künftig einer vorwiegend „schwarzen“ Obrigkeit unterworfen. Ein Teil der Weißen, der die nationalen Nöte nicht über seinen hergebrachten Sonderstatus zu stellen bereit ist, bewaffnet sich und droht mit dem „totalen Krieg“ (Terre Blanche, Anführer des „Afrikaaner Kampfbundes“, SZ 7.2.1994). Weil die Staatsraison zur Disposition steht, nehmen diese Bürger ihre alten Rechte in die eigenen Hände. Kaum geht es damit um die Machtfrage, sind auch der einheitliche Bestand und die Grenzen des Staates Südafrika nicht mehr sicher: Rassisten, die jetzt andersherum auf „getrennter Entwicklung“ beharren, fordern als Alternative zur widernatürlichen Rassenmischung die Zerschlagung des südafrikanischen Territoriums: Auf dem alten Kerngebiet der Buren wollen sie einen rein weißen „Volks-Staat“ errichten. Daß sie die Weißenherrschaft auf kleinerem Maßstab neu konstituieren wollen und nicht auf Wiederherstellung der guten alten Apartheid bestehen, verrät, wie sehr sie selbst die Entwicklung für nicht mehr umkehrbar halten.
Aber es gibt nicht nur ein weißes Interesse an der Apartheid. Die „getrennte Entwicklung“ hat vorgefundene und erst erfundene afrikanische „Nationen“ hofiert und auf dieser Basis manchem Macht und Geldquellen verschafft, die nun bestritten sind: Schwarze Homelandchefs widersetzen sich dem drohenden Rollenverlust in einem einheitlichen, gemischtrassischen Südafrika. Bophuthatswana beharrt auf der bisherigen juristischen Fiktion, es sei ein unabhängiger Staat. Zuluchef Buthelezi beansprucht unter dem Titel „regionale Autonomie“ Hoheitsrechte in KwaZulu und Natal, die jede westliche Demokratie als Separatismus bekämpfen würde. Zur Durchsetzung seiner Ansprüche nutzt er seine königliche Abstammung und die Stammesbindungen seiner Untertanen, setzt auf den Rassismus innerhalb der Schwarzen und hetzt seine Inkatha-Partei zum Stammeskrieg gegen die politische Organisation ANC auf, die er als Partei des Stammes der Xhosa ausgibt.
Der schwarze Separatismus hat sich mit den weißen Negerfeinden zu einer „Freiheitsallianz“ verbündet, die aus der Allparteienkonferenz über den Übergang zur Demokratie auszog und die angesetzten Wahlen boykottieren will, falls ihre Forderungen nicht vorab erfüllt werden und offen mit dem Bürgerkrieg droht.
Die Verwandlung der Terroristen von gestern in eine staatstragende Kraft
Die Reformer der Nationalpartei, die die alte Basis ihres Staates aufgeben – und damit nicht nur die Loyalität eines Teils der weißen Minderheit, sondern alles nationale Funktionieren, das an der Apartheid hing –, glauben auf diese angesichts der nationalen Krisenlage verzichten zu müssen. Und sie glauben, auf sie verzichten zu können, weil sie sie gegen eine bessere tauschen, nämlich im Grunde bloß entscheidend erweitern. Sie tun so, als hätte der Staat schon ein neues, zuverlässiges und einheitliches Volk, nur weil er sich jetzt zu ihm bekennt und sich entsprechend neu konstituieren will. Aber dieses gar nicht gemütliche Verhältnis zwischen dem schwarzen Volk und der politischen Gewalt, das mit so positiven Titeln wie Emanzipation, Demokratie und Gleichberechtigung beschrieben wird, ist keineswegs gegeben. Es muß, wie die Niederschlagung der Gegner des Staatsumbaus, erst noch ins Werk gesetzt werden und fällt für alle Beteiligten notwendig ziemlich anders aus, als sie es sich erwarten oder zumindest erhoffen. Insofern ist auch noch gar nicht ausgemacht, ob der als Schwarzenbewegung angetretene ANC das Kunststück fertigbringt, zu dem sich die Bewegung der Weißen und die schwarzen Nutznießer der alten Herrschaft erst gar nicht bequemen wollen – nämlich seinen Anhängern klarzumachen, daß sie sich ab sofort als Teile eines gemeinsamen, unzertrennlichen, also plötzlich überhaupt nicht mehr rassisch unterschiedenen Volks verstehen sollen, egal ob sie das wollen und überhaupt so ohne weiteres können. Fraglich ist also, ob sich die neue – schwarze – Volksmehrheit subjektiv und objektiv zum Staatsvolk eines neuen Südafrika eignet: Subjektiv, ob die Schwarzen den gemischtrassischen Staat überhaupt als den „ihren“ ansehen; objektiv, ob sich eine emanzipierte und zur Konkurrenz zugelassene schwarze Bevölkerung überhaupt als Basis eines aufblühenden südafrikanischen Kapitalismus eignet und nicht viel eher mit dem Streit um Löhne und Arbeitsbedingungen, zu dem sie sich dann unweigerlich berechtigt sieht, bislang verläßliche Geschäftsumstände infragestellt.
Die politische Vernunft des ANC
Dabei ist allerdings der alte, vierzig Jahre lang bekämpfte Staatsfeind, der ANC, der größte Pluspunkt, weil der entschiedenste Vertreter des Programms, einen möglichst friedlichen, möglichst reibungslosen, weil für alle entscheidenden Staatsgrundlagen möglichst folgenlosen Wechsel der Macht zu vollziehen. Ihn will de Klerk zum Partner im Kampf gegen den alten Staatsapparat und gegen die an ihm hängenden und ihn bisher tragenden politischen Interessen der Weißen machen – selbst um den sicheren Preis, daß der künftige Präsident Mandela heißt. Im Gegenzug soll die Vertretung der schwarzen Mehrheit dafür sorgen, daß der südafrikanische Staat sich auf die Zustimmung der Schwarzenmehrheit gründen kann – und sonst alles beim Alten lassen. Deswegen stellen die Weißen der Vertretung der Schwarzen eine Bedingung für die Erlaubnis zur Mitwirkung am Staat: Der ANC muß sich auf den Standpunkt eines erweiterten gesamt-südafrikanischen Kapitalismus stellen. Die den Wahlen vorhergehende Allparteienkonferenz zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung war ein Test auf die Bereitschaft Mandelas, seiner Basis die gleiche selbstlose Gefolgschaft zu verordnen wie de Klerk der seinen. Gibt dieser im Namen der Nation weiße Herrschaft und weißen Nutzen aus ihr auf, so soll auch der Führer des schwarzen Aufstands nur noch als südafrikanischer Staatspolitiker agieren und den Glauben an den Nutzen, den er von der Beseitigung der rassistischen Unterdrückung versprochen hatte, aufgeben, bzw. seinen Anhängern austreiben. Der ANC ist so scharf auf die Übernahme der Verantwortung für die Nation und die dadurch repräsentierte Überwindung weißer Herrschaft, daß er dazu auch mehrheitlich ohne weiteres bereit ist. Er sieht sich nämlich an seinem Ziel, er kommt an die Macht, und im Unterschied zu allen anderen afrikanischen Staaten, an die Macht eines erfolgreichen Staates – also übersetzt er seine alten Kampfversprechen in die neuen Staatserfordernisse, die der Besitz der Macht gebietet. Daß da eine schwarze Aufstandsbewegung die weiße Herrschaft womöglich brechen wollte, um die politische Gewalt für ihre elenden schwarzen Anhänger zu nutzen, ist von „Staatsmann“ Mandela nicht mehr zu hören. Wenn er Staatschef werden darf, dann Präsident aller Südafrikaner und im Interesse Südafrikas:
„Die schweren sozialen und ökonomischen Probleme in Südafrika können nur von den verschiedenen Parteien gemeinsam gelöst werden. Dabei handelt es sich nicht nur um die Probleme der Schwarzen, sondern auch um die der Coloureds, der Inder und der Weißen. Wir meinen, daß Südafrikas gesamte Bevölkerung für diese immense Aufgabe des Wiederaufbaus mobilisiert werden muß. Und das kann nur eine Regierung der nationalen Einheit.“ (Mandela im Spiegel 47/93, S. 173 f.)
Für seinen demokratischen Griff nach der Macht ist er auch bereit, den Weißen unabhängig von den Ergebnissen der freien Wahlen einen Teil der Macht und die Kontinuität des weißen Staatsapparats zu sichern:
„Im November (1992) verabschiedete der ANC offiziell ein Dokument, das sich für eine mögliche Teilung der Macht mit der Nationalen Partei ausspricht. Das Papier unter dem Titel „Strategische Perspektiven“ stellt einen pragmatischen Schritt in die Richtung Demokratisierung dar, der auch die Notwendigkeit einer Generalamnestie für die Sicherheitskräfte und eine Beschäftigungsgarantie für den Staatsdienst vorsieht.“ (Internationales Afrikaforum 1992, S.39)
Gegenüber Leuten, die sich in dieses Gemeinschaftswerk nicht friedlich einfügen, bietet Mandela umgekehrt seine Organisation als Ordnungsmacht für den Staat an:
„Mandela: Wir glauben nicht, daß die Probleme mit Gewalt gelöst werden können, und wir werden uns bemühen, alle politischen Kräfte vom friedlichen Weg zu überzeugen. Aber natürlich behalten wir uns auch das Recht vor, andere Maßnahmen zu ergreifen… Spiegel: … also Zwang anzuwenden, notfalls den Ausnahmezustand zu verhängen? Mandela: Wenn alle Überzeugungsversuche fehlschlagen, dann werden wir – in Absprache mit anderen politischen Parteien – entsprechend reagieren.“ (Spiegel 47/93, S. 175)
Der Verdacht, der ANC könnte mit der politischen Macht, die ihm zufallen soll, nationalökonomisch verkehrt umgehen, wird nach Kräften ausgeräumt. Früher gepflegte Reizvokabeln, die einen Vorrang des Volksnutzens vor den „Eigengesetzlichkeiten der Wirtschaft“ nahelegen, werden korrigiert:
„Positiv wurde die Wende aufgenommen, die der ANC jetzt auch offiziell in seiner Wirtschaftspolitik vollzogen hat. In einem Vorbereitungspapier für eine ANC-Konferenz Ende Mai verwarf die Organisation erstmals die bisher geforderte Verstaatlichung der Wirtschaft zugunsten eines gemischten Systems. Das Wort „Sozialismus“ kommt in dem Papier nicht mehr vor. … Eine Beschlagnahme von Eigentum im öffentlichen Interesse soll nur auf der Grundlage eines Gesetzes und gegen Entschädigung möglich sein.“ (Internationales Afrikaforum 1992, S. 148)
Zur wirtschaftlichen Vernunft einer zukünftigen schwarzen Regierung gehört vor allem, daß sie sich der ökonomischen Abhängigkeiten des südafrikanischen Kapitalismus bewußt ist, den sie beerben will:
„Mandela sicherte ausländischen Investoren Schutz und Gleichbehandlung mit inländischen Unternehmen zu. Ausländer könnten sicher sein, daß sie Gewinne aus ihren südafrikanischen Niederlassungen – nach Steuerabzug – weiterhin in ihre Heimatstaaten transferieren können.“ (FR, 8.10.93)
In Bezug auf die materiellen Erwartungen seiner schwarzen Basis, die Mandela nicht gleich ganz vergessen will, weiß er um die richtige Reihenfolge: Erst müssen die Kapitalisten Profite machen, damit dann die armen Schlucker für deren Vermehrung gebraucht und entlohnt werden können:
„In Gesprächen mit dem französischen Staatschef Mitterrand vertrat Mandela die Ansicht, daß ein demokratisch geführtes Südafrika auf Marktwirtschaft setzen müsse, um der Armutsbevölkerung Südafrikas neue Chancen zu geben.“ (Internationales Afrikaforum 1992, S. 40)
Die Bereitschaft Mandelas und der ANC-Führung, die Macht zu den Bedingungen der Weißen zu übernehmen, d.h. außer der Hauptfarbe des Staatspräsidenten und der parlamentarischen Mehrheit im Wesentlichen alles beim Alten zu belassen, ist also weit gediehen. Sie denken genauso entschieden wie ihre neuen weißen Reformpartner ganz in den weiterreichenden Perspektiven einer potenten kapitalistischen Nation.
Das Problem des neuen schwarzen Staatsvolks
Nicht ganz so selbstverständlich ist, daß auch die Basis der „afrikanischen Nation“ alles, was sie sich je vom Machtwechsel versprochen hat, so leicht gegen südafrikanischen Nationalismus eintauscht. Schließlich hat der ANC seine Basis nicht mit dem Versprechen politisiert und mobilisiert, daß eines Tages ein schwarzer Präsident die weiße Vorherrschaft dadurch beendigt, daß er ihr Geschäft verrichtet: nämlich einen südafrikanischen Kapitalismus verwaltet, in dem das Eigentum den Weißen gehört und die neue Freiheit der Schwarzen darin besteht, gar nicht so groß anders als bisher um die Dienste am weißen Kapital konkurrieren zu dürfen. Wie unausgegoren immer die Vorstellungen von einer volksnützlichen schwarzen Staatsführung gewesen sein mögen, die man sich von der Eroberung der Macht erwartet hatte – einfach dasselbe wie bisher, nur unter schwarzem Kommando, haben die ANC-Anhänger und -Kämpfer nicht gemeint.
Die Politiker des ANC wissen das auch und gehen längst zynisch und im Bewußtsein des Gegensatzes ihrer staatsmännischen Vorhaben zu den Anliegen ihrer Basis damit um:
Frage des Interviewers: „Aber wenn Sie zu einer Gemeinde gehen und sagen: „Ihr lebt in Hütten wegen des undemokratischen Systems“, entsteht dann nicht das Problem, daß die Leute erwarten, Häuser zu bekommen, wenn die Demokratie da ist? Nun wissen wir beide, daß das nicht angesagt ist…“
Jordan: „Ich will sagen, daß die Leute nicht von der Demokratie erwarten, daß die Häuser vom Himmel fallen. Erwartungen sind berechtigt und der einzige Weg sie zu erfüllen, ist darum zu kämpfen. Wenn der ANC an der Regierung kommt, haben sie das Recht, an unsere Tür zu klopfen und zu fragen: Wann? Und dann werden wir versuchen müssen, ihnen etwas anzubieten.“
Interviewer: „Und wenn Sie den Leuten erzählen, daß sie bei einer ANC-Regierung an die Tür klopfen können und fragen: ‚Häuser, Jobs – wann?‘ und dann die Regierung nicht in der Lage ist, das meiste von dem zu liefern, was die Leute verlangen. …“
Jordan: „Sie wird eben einiges liefern und für den Rest akzeptable Entschuldigungen (!) haben müssen. … Aber es gibt andere Wege für diese Dinge zu kämpfen. Das könnte zum Beispiel heißen, daß in der Zukunft Leute in freiwilliger Arbeit zum Bau von Häusern beitragen: Das ist ein anderer Weg, für bessere Häuser zu kämpfen, indem man die Leute dazu bringt, sich um diese Sachen selbst zu bemühen.“ (informationsdienst südliches afrika 4/91, S. 12)
Derart beeindruckende Versuche einer modernen demokratischen Politisierung, die mit dem Verweis auf die Ohnmacht des Staates für die Prioritäten der Macht einnehmen will, richten sich freilich nicht an fertige Untertanen, die eingespannt im und abhängig vom kapitalistischen Geschäft auf seinen Erfolg hoffen; sie richten sich an Leute, die für den Staatsumsturz agitiert worden sind, für ihren Kampf auch in ihrer elendigen Lage genügend Anschauungsmaterial, bestimmte Erwartungen und Vorstellungen über Sinn und Zweck ihres schwarzen Kampfes gesammelt haben. Sogar die bescheidene Machtübernahme, die Mandela anstrebt, ist ohne einen ausgewachsenen Machtkampf nicht zu haben – für diesen sollen sich die alten Widerstandskämpfer als zukünftige gute schwarze Staatsbürger in die Bresche werfen und dabei ihre Anliegen so vollständig hinter einen neuen rassenneutralen Nationalismus und eine selbstlose Anerkennung der kapitalistischen Geschäftsnotwendigkeiten samt allen brutalen Folgen, die sie zu Genüge kennen, zurückstellen, wie es die schwarzen Repräsentanten des neuen Südafrika von ihnen verlangen. Ob ihnen das einleuchtet?
Absolut unvereinbare Anliegen
Ob die Schwarzen und die Basis des ANC die Trennung der schwarzen Machtübernahme von all dem, was sie sich davon versprochen haben, mitmachen, das entscheidet sich an der vorab aufgeworfenen Eigentumsfrage – aber nicht im grundsätzlichen Sinn, sondern entlang der jetzt schon nach den Wahlen auf die Tagesordnung gesetzten Frage: Bekommen die enteigneten und vertriebenen Schwarzen ihr Land zurück? Immerhin ist die Abschaffung der Apartheid auch eine Art Schuldeingeständnis der Weißen, so daß nicht nur die Kleinbauern nicht recht verstehen, „daß auf dem Unrecht der Vergangenheit das neue Südafrika aufgebaut werden soll“ (Informationsdienst südliches afrika, 3/91, S. 71). Schwarzenkongresse fordern deshalb auch,
„von einer künftigen Regierung … die sofortige und bedingungslose Rückgabe von enteignetem Land. In einer ‚Land-Charta‘ wird die Zwangsumsiedlung von Millionen von Schwarzen und die Enteignung der Bauern während der Apartheidära verurteilt.“ (SZ, 17.2.94)
Der ANC hat de Klerk die Respektierung des Eigentums versprochen und weiß genügend nationalökonomische Argumente gegen die Landverteilung;[4] aber er kann und will diese Verknüpfung seiner Machtübernahme mit schwarzen Hoffnungen auf Wiedergutmachung und ein Stück Boden nicht völlig dementieren:
„Opfer diskriminierender Landgesetze seit 1913 haben ein Anrecht auf staatliche Entschädigung“.
Was das genau heißt, wird zwar im Dunkeln gelassen, bietet aber Material zum Streit: Wo nicht nur um die Besetzung der politischen Posten gestritten wird, sondern auch darum, was überhaupt Recht ist, da kann der ANC in den Verfassungsverhandlungen viel versprechen – es ist umstritten und dem Ausgang des Kampfes anheimgestellt.
So spaltet die Landfrage schon die den Aufstand tragenden schwarzen Parteien: Die AZAPO (Azanian People’s Organisation) boykottiert die Verfassungsverhandlungen wegen der ultimativen Forderung von de Klerk, daß
„(weiße) Minderheitenrechte garantiert werden müßten, daß die Rückgabe des Landes nicht in Frage käme und daß eine freie Marktwirtschaft garantiert werden müßte.“ (informationsdienst südliches afrika 4/91, S. 13)
Die AZAPO wirft dem ANC ebenso Verrat wie politische Dummheit vor:
„Nach unserer Einschätzung scheint allein die Nationale Partei wirklich in diesem Prozeß zu gewinnen. Die Schwarzen haben von den Verhandlungen nicht profitiert. … Was immer ANC und PAC machen, wenn sie nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse der Schwarzen zu befriedigen, dann werden sie langfristig auf Ablehnung stoßen. Die Schwarzen wünschen in erster Linie die Rückgabe des Landes.“ (ebd.)
Der Anspruch auf Rückgabe des Landes ist also schon zwischen den verschiedenen politischen Richtungen innerhalb der schwarzen Emanzipationsbewegung keine einigungsfähige Frage: Was Entschädigung heißt, ob es eine gibt, ob das einst enteignete Land wieder enteignet werden soll – das alles ist zwischen den Parteien, die das Vertretungsrecht der Schwarzen beanspruchen, umstritten und muß erst noch ausgestritten werden. Der Machtkampf findet demnach nicht nur zwischen Schwarz und Weiß und nicht nur zwischen Demokraten und Rassisten statt – der ANC wird für sein neues Südafrika noch manche linke Konkurrenz innerhalb und außerhalb der eigenen Reihen niedermachen müssen.
Mit großen Teilen des weißen Volks und ihren politischen Repräsentanten ist das Thema der Landrückgabe aber schon gleich nicht kompromißfähig. Deshalb war ja die Anerkennung des (weißen!) Eigentums die absolute Vorbedingung dafür, daß sich die Regierungspartei überhaupt auf die Perspektive eingelassen hat, von Neger regieren zu lassen. Jeder Streitpunkt um die Ausgestaltung des Machtwechsels zeigt, das von einem bloßen Machtwechsel eben überhaupt nicht die Rede sein kann und entlarvt die Fragwürdigkeit des großartigen Versöhnungswerks. Die gültige Staatsverfassung bis in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein muß eben erst noch festgelegt und die widerstreitenden Interessen zur Unterordnung unter die dann gültigen staatlichen Belange gezwungen werden.
Die Konsequenzen: Von Wahlprozeß zur neuen Bürgerkriegslage
Die Organisationsformen des Übergangs verraten ein Bewußtsein der Akteure davon, daß sie erstens die existierende Staatsraison und ihr Funktionieren außer Kraft setzen und den sich ausschließenden Interessen im Land überantworten. Sie verraten zweitens, daß die Veranstalter irgendwie auch schon gemerkt haben, daß damit lauter unversöhnliche, nicht kompromißfähige Fragen auf den Tisch kommen. Die Einberufung einer Allparteien-Konferenz verfolgt deshalb das Anliegen, alle irgendwie mächtigen Standpunkte aufzugreifen und im Interesse eines gewaltlosen Übergangs zur neuen Herrschaft dadurch zu befrieden, daß sie an der Festlegung der künftigen Staatsordnung beteiligt werden. Daß sich die Konferenz zum Konsens verpflichtet hat, also die neue Staatsverfassung von der Zustimmung aller gegeneinanderstehenden politischen Ansprüche abhängig gemacht ist, verrät zugleich das Wissen, daß Standpunkte, die übergangen werden, sich nicht einbinden lassen, weil die herrschende Macht sich zurückgenommen hat. Nur kommt der Konsens eben auch nicht zustande, wenn die Parteien frei sind, nur zu unterschreiben, was sie auch wollen:
„Was zu geschehen hat, wenn kein Konsens erreicht werden kann, läßt die Verfassung offen.“ (NZZ, 16.11.93)
Mit Konsens sollte eine Wahl beschlossen werden, die dann mit Mehrheit und Minderheit das Übergehen der unterlegenen Standpunkte legitim machen soll. Aber die Gruppierungen, die sich künftig hoffnungslos in der Minderheit wissen, stimmten dem Wahlfahrplan erst gar nicht zu. Wenn sie sich doch noch „einbinden“ lassen sollten, dann beugen sich letztlich doch eben nur wegen der Berechnung, sonst gewaltsam kaltgestellt zu werden, bzw. weichen nur der Gewalt. Der Versuch, sie durch ein demokratisches Verfahren mit ihrer Zustimmung unterzubügeln, ist deshalb auch mehr als zweifelhaft: Inkatha, Homelandfürsten und die weißen Rassisten wollen sich bislang trotz aller Zugeständnisse an den Wahlen nicht beteiligen und kündigen schon offen an, daß sie die Niederlage ihres Standpunkts nicht hinnehmen werden.
Der Prozeß der Vorbereitung und Abhaltung von freien und demokratischen Wahlen, der angeblich die friedliche Austragung Konflikten garantieren sollte, die wegen dieses Prozesses ausbrechen, setzt also vielmehr einen neuen Bürgerkrieg auf die Tagesordnung. Wahlen funktionieren eben nur, wenn schon alles feststeht. Die demokratische Reform Südafrikas, begrüßt und belobigt als die Rückkehr dieses Staates zu den von „uns“ geschätzten Zivilisationsstandards, befriedet dieses Land nicht, sondern stellt erst einmal nur die politischen Interessen, die im Dienste einer neuen nationalen Einheit miteinander versöhnt werden sollen, unversöhnlich gegeneinander auf. Die entscheidenden Fortschrittsparteien bereiten sich denn auch darauf vor, den Zweck der Wahl abzusichern, notfalls mit Gewalt. Jetzt schon lassen sie ihre Massen aktiv werden für nichts als einen südafrikanischen Nationalismus, den die schwarzen Führer repräsentieren. Die alten Rassisten dürfen den Staat ihrer Privilegien nicht behalten, und die Schwarzen sollen eine Ordnung, die ihren Interessen dient, nicht erkämpfen. Sie sollen nur gegen die alten Nutznießer antreten, für sich nichts mehr herausholen wollen, egal ob der Staat mit seinen kapitalistischen Verhältnissen für die Mehrheit der Schwarzen, die jetzt zum Staatsvolk zählen, überhaupt irgendeine Perspektive bietet außer die Fortsetzung ihrer freigiebigen Benutzung als billige Lohnarbeiter und alle kapitalistischen Beschäftigungsgelegenheiten weit übersteigende Reservearmee. Sie sollen also das anspruchslose Fußvolk für die Ansprüche neuer Staatsmänner abgeben, die mit ihnen als willfährigem Volk Südafrikas Aufbruch zustandebringen wollen. Dafür schaffen sie nun die Vorherrschaft der Weißen ab.
[1] Dabei hat auch der
ANC wie alle antikolonialen Befreiungsbewegungen den
Anspruch auf eine schwarze Herrschaft mit allen
möglichen programmatischen Vorstellungen legitimiert,
was sich damit an den Verhältnissen im Land ändern und
welchen volksdienlichen Zwecken die neue Herrschaft
sich verpflichtet fühlen würde. Allerdings hat der
offizielle ANC das Programm eines „afrikanischen
Sozialismus“, mit dem in anderen Kolonien die
Einrichtung einer schwarzen Nation eingefordert wurde,
nie entschieden auf seine Fahnen geschrieben, sondern
in Gestalt seines Vorsitzenden Mandela eher umgekehrt
immer wieder Zweifel auszuräumen versucht, es ginge ihm
um einen gesellschaftlichen Umsturz. Die
Schwarzenanwälte haben eben den Unterschied zwischen
den exkolonialen Armenhäusern Afrikas und Südafrika mit
seiner eigenen Staatsreichtum begründenden
kapitalistischen Nationalökonomie nie übersehen, über
den sie gerne selber (mit)gebieten wollten: Der
afrikanische Nationalismus im Sinne des A.N.C. will,
daß das afrikanische Volk in seinem eigenen Land
Freiheit und Erfüllung finden möge. Die Freiheitscharta
ist das wichtigste politische Dokument des A.N.C. Sie
entspricht bestimmt nicht dem Programm eines
sozialistischen Staates. Sie fordert zwar eine
Neuaufteilung, aber keineswegs die Nationalisierung von
Grund und Boden; sie sieht eine Nationalisierung der
Minen, Banken und Monopolindustrien vor, weil sich die
großen Monopole vollständig in den Händen einer
einzigen Rasse befinden, und ohne eine Nationalisierung
derselben würde die Vorherrschaft einer Rasse trotz der
Aufteilung der politischen Macht auch weiterhin
fortbestehen… In keiner Phase seiner Geschichte
befürwortete der A.N.C. revolutionäre Veränderungen des
wirtschaftlichen Gefüges des Landes, und soweit ich
weiß, hat er auch niemals ein Verdammungsurteil gegen
die kapitalistische Gesellschaftsform
ausgesprochen.
(Mandela,
Verteidigungsrede vor Gericht 1964, in: Kap ohne
Hoffnung, Hrsgb. v. Freimut Duve 1965)
Ausgerechnet im einzigen afrikanischen Land, wo
umfassend kapitalistischer Reichtum in nationaler Regie
produziert wird, wo die Mehrheit deswegen den brutalen
Zwängen einer kapitalistischen Lohnarbeiterklasse mit
einer millionenfachen Reservearmee und der politischen
Verhinderung eines Kampfs um den Preis der Arbeit
ausgeliefert ist, wo also für einen sozialistischen
Umsturz genügend Gründe und zugleich Mittel gegeben
waren, hat die Schwarzenvertretung ein solches Ansinnen
entschieden abgelehnt. Daß der ANC dennoch hartnäckig
in den Ruch des „Kommunismus“ geraten ist, lag weniger
an der Zweckkoalition, die er mit der Südafrikanischen
Kommunistischen Partei geschlossen hat, sondern an der
Entschiedenheit der Weißen, ihn als „kommunistische
Gefahr“ zu behandeln, und daran, daß der ANC Hilfe und
Rückhalt für seine Anliegen nur aus dem Osten bzw. den
afrikanischen Ländern erwarten konnte, die, wie
Mosambik, selber Opfer der antikommunistischen
Frontstaatpolitik Südafrikas wurden und auf sowjetische
und kubanische Unterstützung angewiesen waren.
[2] Die moralischen Gegner des rassistischen Regimes in Südafrika nahmen vor allem an diesen „menschenverachtenden Auswüchsen“ der „kleinen Apartheid“ Anstoß. Daß sich der Staat mit seinen rassistischen Sortierkriterien auch ins Privatleben seiner Bürger einmischt, also den Schwarzen das Recht auf eine Menschenwürde versagt, die jedem Christenmenschen unbeschadet seiner sonstigen Umstände zusteht, erschien ihnen als der eigentliche Skandal, so daß das südafrikanische Regime mit der schrittweisen Zurücknahme der „kleinen Apartheid“ in den letzten Jahren christliche Gemüter schon ein gutes Stück besänftigt hat.
[3] „Für die Unternehmer war am wichtigsten, ob die Gewerkschaften die Belegschaft repräsentierten und die getroffenen Vereinbarungen einhalten konnten.“ (Jörg Fisch: Geschichte Südafrikas, München 1991, 2.Aufl., S.42)
[4] In Mosambik
nationalisierte die Regierung das Land, aber die Leute
hatten nicht die Geräte, das Saatgut und die
Kenntnisse, es richtig zu nutzen.
Daraus lernen die
Nationalökonomen des ANC nicht etwa, das man den Leuten
eben noch etwas mehr verfügbar
machen muß als
das Land, sondern daß man das besser läßt. Außerdem
verweist die Kommission auf mögliche Sanktionen
westlicher Geldgeber und auf die Gefahr einer
Kapitalflucht im Falle der Nationalisierung des
Landes.
(Informationsdienst
südliches Afrika, 3/91, S.8)