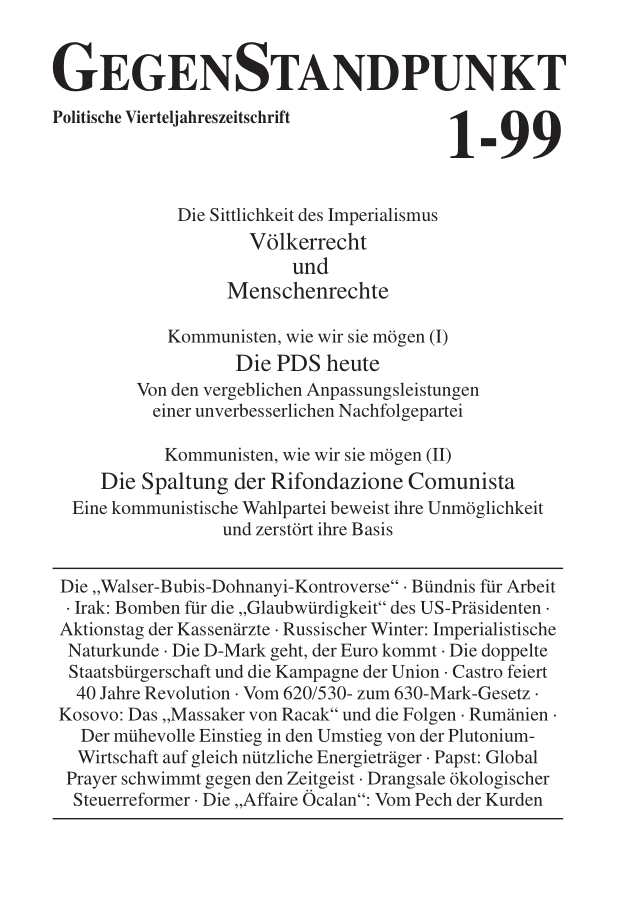Kommunisten, wie wir sie mögen (II)
Die Spaltung der Rifondazione Comunista
Eine kommunistische Wahlpartei beweist ihre Unmöglichkeit und zerstört ihre Basis
Kommunismus in Italien heute – Kapitalismus mitgestalten mit sozialistischer Perspektive. Und wenn Prodi jeden Schein der Rücksichtnahme auf die Kommunisten streicht und von ihnen schiere Unterstützung der Regierung einfordert, dann spaltet sich diese Partei ob des Dilemmas ‚Dabei sein ist alles‘ versus ‚aber bitte mit (zumindest symbolischer) Mitbestimmung‘!
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Kommunisten, wie wir sie mögen
(II)
Die Spaltung der Rifondazione
Comunista
Eine kommunistische Wahlpartei
beweist ihre Unmöglichkeit und zerstört ihre Basis
Eine kommunistische Partei hat 1998 in Europa noch einmal etwas bewegt. Sie hat eine italienische Regierung gestürzt, die sie bis dahin gestützt hatte. Eine Woche später war dieselbe Regierungskoalition unter einem neuen Chef wieder im Amt – und die kommunistische Partei gespalten. Aufstieg und Niedergang der vor kaum 8 Jahren selbst aus einer Art Spaltung hervorgegangenen „Partei der kommunistischen Wiedergründung“ sind ein bedenkliches Zeichen: Offenbar bekommen den modernen Kommunisten sogar rein parlamentarische Umstürze nicht mehr gut; statt des Kampfes gegen die Herrschenden nähren sie den Spaltpilz in den eigenen Reihen. Und das ist noch nicht einmal Zufall.
Die Partei heißt „partito della rifondazione comunista“ (PRC), weil 1991 eine Minderheit den allerletzten Schritt des Weges der alten KP Italiens von der Kapitalismuskritik zur Vertretung der minderbemittelten Schichten im Kapitalismus, von der revolutionären Organisation zur Sozialdemokratie nicht mehr mitgehen wollte. Die Mehrheit der ruhmreichen Partei Togliattis paßte damals Ideale und Identifikationsmarken an ihre schon Jahrzehnte alte politische Praxis an: Sie legte den kommunistischen Namen ab, strich Marx und Lenin, Hammer und Sichel, Revolution und Klassenkampf aus ihrer Symbolwelt und ersetzte sie durch rote Nelken, die grüne Eiche, und ein Bekenntnis zu den militärischen und ökonomischen Waffen des europäischen Imperialismus, NATO und Euro. Eine Minderheit verurteilte den Verrat an der guten alten kommunistischen Tradition und am gemeinsamen Fernziel einer Wirtschaft jenseits des Kapitalismus. Diese „Altlinken“ traten aus der in „PDS“ (partito democratico di sinistra) umbenannten Partei aus und gründeten zusammen mit Resten der immer schon außerhalb der KP stehenden „Neuen Linken“ der 70er Jahre eine Sammlungsbewegung zur Wiedergründung der soeben aufgelösten kommunistischen Partei. Diese trat das von der Mehrheit aufgegebene Erbe der kommunistischen Symbole und Ideale an. Dazu sahen sich die Gründer der Rifondazione berechtigt, weil sie darauf setzen konnten, daß die rote Fahne durchaus noch Anhänger in Italien hat, die sich von ihnen repräsentieren lassen würden. Dank vorhandener Massenbasis schien ihnen ein radikaler Standpunkt vertretbar. Weil sie ihm politisches Gewicht in der Nation zutrauten, sahen sie nicht ein, wieso sie ihre Ablehnung des Kapitalismus aufgeben sollten. Tatsächlich ordnete sich schnell alles, was sich in Italien noch irgendwie antikapitalistisch verstand, der neuen politischen Heimat zu. Die Partei brauchte ihren beachtlichen Anhang nicht herzustellen, sondern konnte die in Europa einmalige Lage für ihr praktisches Eingreifen in die italienischen Verhältnisse nutzen. Dieser Anhang, so die Auffassung der Parteigründer, berechtigt Kommunisten, im Namen der Massen Kritik anzumelden; das Gewicht, das er dem eigenen Wort verleiht, verpflichtet aber auch, es keinesfalls bei der Ablehnung des Kapitalismus zu belassen.
Vom alten „partito comunista italiano“ geerbt haben die
Wiedergründer nämlich auch den Standpunkt eines modernen
und „realistischen“ Kommunismus, den sie bis zur Spaltung
ja mitgetragen hatten. Die heute mögliche
kommunistische Politik
beweist Nützlichkeit wie
Realitätstüchtigkeit ihrer Kritik durch praktikable
Programme und Alternativen, mit denen sie für
Veränderungen zugunsten der Opfer der kapitalistischen
Staatsräson „kämpft“. Mit der Kritik dieser Räson den
Willen zu ihrem Umsturz zu schüren und Gleichgesinnte zu
sammeln, erschiene den Parteileuten als unpolitisches
Theoretisieren. Man ist sich in der Partei sowieso
darüber einig, daß man „Antikapitalist“ ist – und hat in
dieser Richtung keinerlei Klärungsbedarf. Und die Massen
mit ihren sozialen Gerechtigkeits- und nationalen
Fortschrittsvorstellungen will man nicht kritisieren,
sondern vereinnahmen. Agitation und Mobilisierung der
Massen gegen die kapitalistischen Umstände, die ihnen so
wenig bekommen, gehören nicht zu den ach so praktischen
Projekten dieser Kommunisten. Was sie gar nicht erst
versuchen wollen, nennen sie unmöglich.
Ihre politischen Ziele erläutern sie durch eine heftige
Polemik gegen die Kritik, die jedenfalls manche ihrer
Anhänger einmal in die Tat umsetzen wollten: Mit
Träumern, die „in dieser historischen Phase“ das System
angreifen, wollen sie nicht verwechselt werden.
„Jeder Vorschlag muß in aller Deutlichkeit vor allem auf die realen Prozesse eine Antwort geben. Es gibt keine ernst zu nehmenden Programme (wenigstens nicht, solange wir nicht von Büchern zum Träumen sprechen), die nicht antworten auf die scharfe, aber unvermeidliche Frage: Was wollen wir, mit wem haben wir die Absicht, es zu realisieren, und gegen wen.“ (Parteisekretär Bertinotti)
Sie wollen praktische und wirksame Politik machen – und das heißt, Gesetzesinitiativen im Parlament einbringen, sie zusammen mit anderen Fraktionen und gegen die Stimmen der Opposition beschließen, kurz: Sie wollen ihre Ziele mit Hilfe der politischen Gewalt der kapitalistischen Gesellschaft „realisieren“. Der Kampf für die Interessen der Ausgebeuteten findet auf den Kommandohöhen des Staates statt, der die Eigentums- und Ausbeutungsordnung schützt. Praktisch, nützlich und realistisch ist, was sich – je nach Stand der parlamentarischen Kräfteverhältnisse – als Staatsprogramm beschließen läßt.
Es irritiert die Partei überhaupt nicht, daß sie für ihre „sozialistische Perspektive“ mit Initiativen und Gesetzesanträgen wirbt, die mitteilen, wie viel sozialer sich im Kapitalismus und mit den Instrumenten des Staates regieren ließe, wenn man nur wollte bzw. wenn das liebe Volk mehr kommunistische Abgeordnete aufs Capitol schickte. Den impliziten Beweis, den sie da abliefert, läßt sie einfach nicht gelten: Es kann nämlich kaum von einem System des Kapitals die Rede sein, wenn sich der Gegensatz fortschrittlicher und reaktionärer Zustände an der Wertorientierung und dem guten Willen der jeweiligen Amtsträger entscheidet. Mit ihren praktikablen Alternativen dementiert die Partei die Notwendigkeit, das System zu überwinden, zu der sie sich mit ihrem Namen und ihrer roten Folklore bekennt. Ihr unbedingter Wille, praktisch zu sein und den eigenen Anhängern zu beweisen, daß es sich lohnt, Kommunisten ins Parlament zu schicken, fragt freilich auch nicht lange, was für einen Unterschied ihre Initiativen zu denen „der Rechten“ wirklich machen. Da werden einfach tausend Einzelheiten entdeckt, die sich mit der Staatsmacht besser und anders regeln ließen, als es die bürgerlichen Politiker tun. Aber nicht nur das: Die Partei spricht die Kommunisten im Volk, die ihre Ansichten teilen, als Wählerbasis an, für die sie soziale Errungenschaften erkämpfen, deren Vertrauen und Wahlstimmen sie sich durch diesen Einsatz verdienen will. Während sie in historischen Rückblicken den Klassenkampf der Arbeiterklasse hochleben läßt, beweist sie ihren zu Wählern degradierten Anhängern, wieviel Kampf die guten Leute sich durch ein korrektes Wahlkreuz und die kommunistische Repräsentation ihrer Interessen im Zentrum der Macht ersparen können. Sie betreibt die Propaganda ihrer kommunistischen Ideale in Form von Wahlkampfs – und dessen Botschaft lautet immer: Schenkt uns euer Vertrauen! Laßt euch von uns regieren! Wir regeln eure Angelegenheiten besser als die anderen. An dieser Leistung für ihre Wählerschaft will die Partei gemessen werden – und das wird sie auch. Sie selbst erzieht die Anhänger ihrer Sache zu anspruchsvollen Untertanen der demokratischen Art.
„Realpolitik“ und sozialistische Perspektive
Diese Praxis gilt den wiedergegründeten Kommunisten nicht
als sozialdemokratische Politik, die sie ablehnen, und
keinesfalls als ein Beispiel des Verrats, den sie ihren
alten Genossen von der PDS zum Vorwurf machen. Sie
bestehen darauf, daß ihre praktischen Alternativen eine
Werbung sind, mit der die Kommunisten sich das Vertrauen
der Menschen verdienen, die sie später einmal zum großen
Ziel der neuen Gesellschaft hinregieren wollen. Da ihre
heute möglichen Reformen die Herrschaft des
Kapitals nicht angreifen und das auch gar nicht sollen,
besteht der kommunistische Charakter ihrer
Gesetzesvorlagen, die sich nicht prinzipiell von den
Initiativen anderer Parteien unterscheiden, in der
hinzugesetzten Perspektive. Die Partei setzt ihre
wirkliche Politik, ihre Anstrengung, Einfluß auf die
Beschlußfassung im römischen Parlament zu nehmen, zu
einem vorläufigen Treiben herab, das nicht das ist,
was sie letztlich will: Nur in dieser Phase der
kapitalistischen Entwicklung ist die
Massenarbeitslosigkeit das Hauptproblem
, nur vorerst
muß die Politik für Arbeit die gesamte
Wirtschaftspolitik bestimmen
; letztlich muß sie
natürlich abgeschafft werden – diese Art Arbeit. Die
Partei wirbt für ihre Realpolitik
mit dem
Argument, daß sie eigentlich selbst gegen das ist, was
sie im Parlament beschließt, und verbittet sich mit
dieser unehrlichen Distanzierung, daß jemand ihre Politik
am großen kommunistischen Ziel mißt, das sie gleichwohl
hochhält. Dieses Ziel wird durch die Trennung von der
Politik ebenso herabgesetzt – zu einem fernen Ideal
nämlich, das in der Praxis nichts verloren hat; zu einer
Gesinnung, die hinter der Politik der sozialen
Alternative steht und den Willen zum Maximum des heute
Möglichen besonders glaubwürdig macht.
Was die Partei praktisch macht, will sie eigentlich nicht, und was sie will, macht sie nicht. Sie richtet einen Gegensatz von Absicht und Handeln ein und besteht darauf, daß ihre beiden Seiten nicht als Gegensatz, sondern als wechselseitige Verstärkung und Unterstützung aufzufassen seien. Damit schafft sie sich ein Glaubwürdigkeitsproblem, wie es echte Demokraten nicht kennen. Auch die büßen bisweilen Glaubwürdigkeit ein, aber nur, wenn sie es nicht schaffen, mit Macht durchzusetzen, was sie als notwendig propagiert haben. Einen glatten Gegensatz von politischer Absicht und politischer Tat kennen die staatstragenden Parteien jedoch nicht: Sie machen ja kein Hehl daraus, daß sie die Abhängigkeit der Massen vom kapitalistischen Geschäftsgang verwalten – den sozialen Belangen, Arbeitsplätzen und Löhnen, kann Politik gar nicht anders „dienen“ als durch die Förderung von Profit und Wachstum! Die kommunistischen Feinde der Ausbeutung dagegen bestehen ausdrücklich auf jenem Gegensatz, wenn sie einen Sparhaushalt als die – unter der Einschränkung: „jetzt mögliche“ – verantwortbare Verwirklichung ihrer sozialen Absichten verkaufen. Der „Kampf der Partei“ bekommt dadurch ein ganz eigenes Ziel: Es geht nicht um die Durchsetzung dieser oder jener kleinen sozialen Verbesserung, sondern darum, daß die Partei sich und ihre Anhänger ihr die kommunistischen Motive als gültige Richtschnur ihres Tagesgeschäfts glauben können. Ihre Mitwirkung an der Gesetzgebung muß glaubhaft machen, daß sie auf der Seite der Erniedrigten und Beleidigten steht. Der Kampf um das Bild, das sie abgibt, bestimmt das unfriedliche innere Leben und Streiten der Partei und die taktischen Finessen nach außen, die dazu gehören. Dieser Kampf braucht zuerst einmal –
Ein realistisches linksradikales Programm
Es hat sein Maß nicht in den Zielen, die diese Kommunisten angeblich immer noch erreichen wollen – diese sind ein für allemal jenseits der politischen Praxis –, sondern in der „Realität“. Sie ist nicht etwa der zu bekämpfende Zustand, sondern Richtschnur und Kriterium dessen, was geht: „ Die Einleitung eines neuen Reformkurses in der Regierungspolitik muß eine positive Antwort auf die Frage nach der Realisierbarkeit von Änderungsanträgen hier und heute geben.“ Nicht, daß sich anderes – die nötige Anhängerschaft und ihren Einsatz vorausgesetzt – nicht auch und eben gegen diese „Realität“ durchsetzen ließe; dergleichen wird nur gar nicht gewollt, wo „Realisierbarkeit“ zur Meßlatte dessen erhoben wird, was man überhaupt will. Der Gehalt dieser „Realität“ ist kein Rätsel. Es sind die aktuelle Staatsräson, die zu Sachnotwendigkeiten politischen Handelns erklärten aktuellen Zwecke und Konsequenzen staatlichen Machtgebrauchs, an die der linke Reformkurs sich anpassen muß, um seinen Autoren realistisch zu erscheinen. Die Tagesordnung des Staatsprogramms, die stets die amtierenden Mehrheitsparteien definieren, läßt sich die linke Fortschrittskraft von ihren antikommunistischen Gegnern vorgeben, um auf dieser Basis und für diese Probleme dann „linke Lösungen“ anzubieten.
Der Opportunismus ihrer Programmatik ist prinzipiell: In Zeiten, als die politische Mitte soziale Reformen und einen Ausbau des Sozialstaats auf die Tagesordnung setzte, forderte die linke Alternative eine Steigerung davon – „systemüberwindende Reformen“; heute, wo die gültige Staatsräson soziale Rücksichten ausschließt, bestehen realistische Kommunisten darauf, daß einige soziale Errungenschaften erhalten, wenn nicht ausgebaut werden könnten. Stets überlassen sie die Definition der nationalen Auftragslage ihren bürgerlichen Feinden, um daran dann ihre linke Unterscheidung anzubringen. Dabei darf ihr braves Verbesserungswesen sich noch nicht einmal weit von dem entfernen, was die anderen für „machbar“ halten. Die Nähe dazu ist ja der gesuchte Ausweis des Realismus ihrer Forderungen. Wenn also die Linksdemokraten (PDS) die privaten Zuzahlungen zu Gesundheitsleistung erhöhen, fordern die Kommunisten weniger Erhöhung, wenn die Mehrheit schrumpfende Subventionen für den armen Süden vorsieht, fordern die Kommunisten mehr davon. Für die 35-Stunden-Woche, die anderswo in Europa existiert und von den italienischen Gewerkschaften gefordert wird, macht sich die Rifondazione gegen die anderen Parteien stark. Und weil alles Soziale immer mehr zusammengestrichen wird, „kämpft“ man im wesentlichen gegen „Sozialabbau“ und für den kapitalistischen Normalzustand von gestern, der auch schon Millionen italienischer Arbeiter ruiniert hatte.
Die Durchsetzung des linken Reformprogramms im Staat
ist die nächste Pflicht.Sie macht den Unterschied zur „bloßen“ Kritik, die man als Träumerei verworfen hatte. Die Partei, die im Staat und mithilfe seiner Macht Verbesserungen für die Armen und Arbeitslosen „erkämpfen“ will, kümmert sich also ums Kräfteverhältnis der Parteien, die den Staat besetzen und steuern, und macht sich selber zu einem Bestandteil dieses Kräfteverhältnisses. Das Wichtigste, was sie für ihre Sache und die ihrer bedürftigen Anhänger tun kann, ist,
„die Rolle eines vollen politischen Subjekts zu erobern. Andernfalls wären wir in eine Minderheiten- und Protestposition verwiesen, außerhalb der Möglichkeit, auf die politische und soziale Phase einzuwirken, d.h. auf die schlechtesten Bedingungen für den, der sich vornimmt, die Massen zu Protagonisten des politischen Lebens zu machen.“
Wer beim Wettbewerb um die bessere Verwaltung der kapitalistischen Gesellschaft nicht mitmacht, hat sowieso nichts zu melden – er steht draußen und ist bedeutungslos. Bedeutung und Chancen auf Einfluß dagegen hat die Partei, sobald sie mit knapp 10% der Wahlstimmen ins Parlament einzieht. „Die Schlacht um die Existenz der Partei auf der politischen Bühne ist gewonnen“, und die braven „Volksmassen“ mutieren mit diesem Sieg zu „Protagonisten des politischen Lebens“ – sie werden jetzt von authentischen Volksvertretern vertreten.
Die Partei stellt sich sodann dem Umstand, daß sie mit
10% der Wahlstimmen das Kräfteverhältnis der
parlamentarischen Kräfte nicht gerade bestimmt. Für die
erforderlichen Mehrheiten – ja sogar dafür, daß sich die
gewonnenen Stimmen unter dem neuen Mehrheitswahlrecht
überhaupt in Parlamentssitzen niederschlagen, braucht es
ein Bündnis mit anderen Parteien. So sorgen allein das
Wahlrecht und die parlamentarische Arithmetik dafür, daß
diese praktisch orientierten Kapitalismuskritiker
Unterschiede zwischen den staatstragenden Parteien
entdecken, die ihnen viel wichtiger sind als der
Gegensatz, in dem sie zu all diesen Parteien stehen. Der
Bedarf nach Bündnispartnern sortiert die
Parteienlandschaft in eine kapitalistische Rechte und
eine kapitalistische Linke auseinander. Letztere machen
die Kommunisten der Rifondazione bei den Wahlvereinen
aus, die in grauer Vorzeit ihr Recht, an die Macht zu
kommen, mit dem Bekenntnis zu allerlei sozialen Absichten
verkauft haben. Unter dem Zeichen des Ölbaums werden die
Linksdemokraten, jene Verräter, gegen die man die eigene
Partei gegründet hatte, zu Partnern im gemeinsamen Kampf
um die erste Linksregierung seit 50 Jahren
: Die
Rifondazione nutzt die historische Stunde der
Linken
, leistet ihren Beitrag zur Geburt der
Regierung Prodi
und ist stolz darauf. Das ist dann
schon der zweite Sieg der guten Sache: Heute lebt das
Projekt des PRC. Die Niederlage der Rechten bedeutet ein
politisches Ereignis, das große Hoffnungen auf
Veränderung im Land geweckt hat.
Die Möglichkeit von Veränderung ist das wirkliche und selbständige Ziel der Partei. Selbstverständlich weiß man, daß die linken Mehrheits-Partner anderes wollen als die Umsetzung der kommunistischen Reformideen: Aber immerhin läuft etwas Linkes, wenn auch nicht das, was man selbst will. Zur Erhaltung der Möglichkeit kommunistischen Einflusses muß vor allem „die Rechte“ von der Macht ferngehalten werden; und dafür darf man die linke Regierung nicht mit linken Forderungen überlasten. Die realistischen Kommunisten führen auf diese Weise den Widerspruch zwischen ihren revolutionären Idealen und ihrer Realpolitik in die Realpolitik selbst ein: Um die Möglichkeit ihres Einflusses auf die Politik des Landes zu erhalten, verzichten sie darauf, diesen Einfluß auszuüben. Sie stützen eine Regierung, gegen deren Maßnahmen sie opponieren, und sichern ihr die parlamentarische Mehrheit, mit der sie all das beschließt, was die Rifondazione nicht will. Die eigenen Reformvorschläge dagegen – mögen sie noch so realistisch erfunden sein – passen nicht ins Regierungsprogramm, sind also alles andere als realistisch. Genau der kleine Unterschied ihrer Forderungen zu denen der anderen Parteien, auf den der PRC soviel Wert legt, ist zuviel. Zumal die linke Regierung Prodi ihren Kredit als staatstragende Kraft im Land und in Europa auf die Demonstration gründet, daß die „Altkommunisten“, die die Regierung stützen, keinen Einfluß auf die italienische Politik gewinnen.
Mit der ungerührt von allen Regierungsbeschlüssen gepflegten Einbildung, die linke Regierung als Mittel kommunistischer Fortschritte zu nutzen, machen sich die wiedergegründeten Kommunisten tatsächlich zum Mittel einer Regierung, die ein gigantisches Verarmungsprogramm der sozialen Schichten durchführt, aus denen die Anhänge der Rifondazione stammen. Italiens nationale Priorität Nr. 1 in den Jahren der linken Mehrheit ist der lange gefährdete Eintritt in die europäische Währungsunion. Für die Teilhabe am harten Geld wird ein Programm der Haushaltskonsolidierung aufgelegt, samt weitreichender Privatisierungen, Werksschließungen, Entlassungen und der Streichung bis dahin üblicher sozialer Leistungen. All das tragen die Kommunisten mit, indem sie Abschwächungen der Härten fordern, tatsächlich aber die Regierung an der Macht halten, die Abschwächungen ablehnt. Gerade dadurch ist Italien europatauglich gemacht worden – und zwar ohne die Klassenkämpfe und Widerstände, die eine rechte Regierung von kommunistischer und gewerkschaftlicher Seite zu erwarten gehabt hätte. Was die Parlamentarier der Rifondazione als unumgänglich passieren lassen, hat bei ihrer Basis den Bonus, daß es dann wohl unumgänglich sein wird – sei es, wegen der Sachzwänge, denen das Land im europäischen Verbund unterliegt, sei es wegen der Erhaltung der linken Regierung. Und in den wenigen Fällen, in denen diese Beglaubigung nicht ausgereicht hat, hat sich die Rifondazione als Ordnungsmacht bewährt: Autonome Gewerkschaften, die sich Zumutungen nicht gefallen lassen wollten, die die Partei mitverantwortete, hat sie selbst an den Pranger gestellt und als Chaoten aus dem linken Verantwortungsverbund ausgegrenzt.
Weil sie ihr höchst realistisch konzipiertes Programm durch ihre Teilhabe an der Macht nicht voranbringt, sondern nun dieses zum Ideal ihres parlamentarischen Einflußnehmens werden läßt, kämpft sie um Symbole ihrer Bedeutung in der italienischen Politik – und die folgen einem doppelten Maßstab: Einerseits geht es um den Beweis, daß die Rifondazione eine linke Regierung ermöglicht, die ohne ihre Unterstützung scheitern würde – in dieser Hinsicht gehört es zur Verantwortung der Kommunisten, sich von den eigenen Forderungen etwas abhandeln zu lassen; andererseits braucht es auch Beweise der Berücksichtigung ihrer Forderungen im Programm der Regierung Prodi. Die „manovra finanziaria“ im Herbst ist daher stets der große Auftritt der Kommunisten, der Gipfel ihrer politischen Bedeutung. Gewohnheitsmäßig lehnen sie das erste Haushaltsgesetz ab, drohen mit dem Sturz der Regierung, um an irgend einem herausgesuchten Punkt eine soziale Verbesserung herauszuschlagen, mit der sie sich und ihren Anhängern den Nutzen ihres parlamentarischen Mitmischens beweisen. Die andere Seite lehnt im Interesse der Konsolidierung des Staatshaushalts und ihrer eigenen Glaubwürdigkeit ebenso rituell ab – stets ist der Sturz der Regierung nahe oder auch schon vollzogen, um dann durch eine kleine Konzession der einen oder anderen Seite wieder geheilt zu werden. Und stets hält sich die Rifondazione zugute, die beiden hehren Ziele einer fortschrittlichen politischen Kraft in Italien verantwortlich in Einklang gebracht zu haben: Politisch einzuwirken – und der Linken nicht leichtfertig durch übertriebenen Starrsinn den Linken die Regierungsmacht zu entziehen und damit die einmalige Chance für die Möglichkeit fortschrittlicher Politik zu
Das ging so manches Jahr. Den Haushalt 1998 hat man gegen das später nicht eingelöste Versprechen passieren lassen, die Regierung werde ein Gesetz zur Einführung der 35-Stunden-Woche vorlegen. Die Enttäuschung war gegenseitig. Daß sie den Schein der Nachgiebigkeit zugelassen hatte, hielt die Regierung Prodi nämlich für eine Schwäche, die sich nicht wiederholen sollte. Den Haushaltsentwurf für 1999 legte sie gleich mit der Klarstellung vor, diesmal sei die soziale Komponente von ihr selbst schon berücksichtigt, der Entwurf sei nicht mehr verhandelbar, Nachbesserung ausgeschlossen.
Damit verweigert Prodi der Fraktion, die er für seine Regierungsmehrheit im Parlament braucht, offen den Schein von Einflußnahme und Korrektur und fordert Unterstützung ohne jede Mitbestimmung. Die famosen Kommunisten hätten ohne weiteres weitergemacht wie bisher: Das ganze Staatsprogramm über den Haushalt unterschrieben und dagegen irgendeine symbolische linke Konzession eingehandelt. Man ließ sie nur nicht mehr. Der Versuch des Parteirats, zum Schacher der früheren Jahre zurückzukehren, scheitert, die Regierung läßt sich stürzen – und beschert nicht ihren Mehrheitsparteien, sondern der Rifondazione das größte Problem. Wie steht sie da? Entweder als „Mörderin“ der ersten linken Regierung seit einem halben Jahrhundert oder als bedingungslose Unterstützerin einer Politik, die sie ablehnt. Ihr verlogenes Erscheinungsbild als nationale Fortschrittskraft – radikal und zugleich wählbar, auf Seiten der Armen und zugleich wirksam im Getriebe der Macht – ist in beiden Hinsichten beschädigt.
Über die Frage, wie die Partei in dieser mißlichen Lage
eine gute Figur macht, geraten sich ihre Protagonisten in
die Haare. Nicht daß sie nicht beide genau dieselbe
Politik gemacht hätten und weiterhin machen wollten:
Parteisekretär Bertinotti und der Parteirat kalkulieren
in der Taktik der Haushaltsberatungen ’98 nur anderes als
der Vorsitzende Cossutta und die Mehrheit der
Parlamentsfraktion. Während die ersteren die linke
Alternative
in der Politik des Ölbaum-Bündnisses auf
einmal nicht mehr erkennen können und es sich schuldig
sind, den Bruch des Regierungsbündnisses, den sie nicht
wollen, wenigstens zu riskieren, verurteilt Cossutta dies
als eine Verantwortungslosigkeit gegenüber der
kommunistischen Pflicht, die Linke an der Macht zu
halten: Bertinottis Politik der ständigen Verweigerung
führt in die Krise, was nur die Rechte wieder an die
Macht bringt mit schlimmen Konsequenzen für die
Volksmassen; die Partei würde den Aufschrei der
öffentlichen Meinung des Landes und der eigenen Wähler
nicht aushalten.
Die Spaltung – das kommunistische an der Rifondazione
Diese taktische Einschätzung wird in der Partei so prinzipiell gehandelt, daß sie sich darüber spaltet. Offenbar nehmen beide Fraktionen keine nüchterne Bestandsaufnahme dessen vor, was sie mit ihrer parlamentarischen Unterstützung der Regierung Prodi erreicht haben. Keine Seite mag sich eingestehen, daß für ihre Sorte konstruktiv kritischer Mitarbeit in der Demokratie einfach kein Platz ist. Schlimm genug, daß Kommunisten das nicht mehr wissen, sie lassen aber auch die Erfahrungen nicht gelten, die ihnen ihr praktischer Test darauf eingebracht hat: die Unterstützung einer bürgerlichen Regierung, um sie zu linken Zugeständnissen zu drängen, funktioniert nicht: die Benutzung des Instruments zerstört es, und seine Erhaltung verlangt den Verzicht auf seine Benutzung. Die Kündigung der Kooperation läuft auf genau dasselbe hinaus wie Weitermachen. Über diese Alternative, sollte man meinen, hätte man sich nicht spalten müssen.
Ganz anders die Politiker der Rifondazione – sie können sich einen anderen und wichtigeren Spaltungsgrund überhaupt nicht denken: Denn für sie stehen zwei kommunistische Pflichten und zwei ausschließende Einbildungen über Leistung und Rolle der Partei in Konflikt. Die eine Seite rechnet sich die Leistung an, „die Linke“ im Land an die Macht zu bringen, auch wenn sie nichts Linkes beschließt. Die andere setzt auf die Rolle des linken Korrektivs – und mag sich diesen Selbstbetrug nur glauben, wenn wenigstens irgendwelche Symbole dafür vorweisbar sind. Um ihres doppelten Selbstbetrugs willen, werden sie politisch verrückt und behandeln lächerliche taktische Fragen als prinzipielle: Nachdem das ganze Maastrichtprogramm mitgetragen wurde, machen ein paar Millionen Lire mehr oder weniger für das Gesundheitswesen, ein Versprechen für die Einführung der 35-Stunden-Woche oder keines den Unterschied zwischen der korrekten Linie und Verrat; Beteiligung oder Nichtbeteiligung an einer bürgerlichen Regierung, die sich ohnehin nicht beeinflussen läßt, macht die Differenz zwischen realistischem Fortschrittswillen und linksradikalem Liquidatorentum. Mit Leuten, mit denen man jahrelang diese miesen Fragen des notwendigen Opportunismus und der richtigen Distanz gewälzt und entschieden hatte, will man auf einmal nichts mehr zutun haben: Sie verhindern das Notwendige und sind der neue Feind.
Selbstverständlich werden diese Politiker sowenig wie
andere aus Erfahrung klug – seien ihre Erfahrungen mit
dem parlamentarischen Weg auch noch so schlecht: Kaum
gespalten leiden beide Spaltprodukte an der Klarheit
ihres Entschlusses und gestehen, daß zu ihrem modernen
und praktikablen Kommunismus nun die andere Seite fehlt.
Bertinotti fragt sich, was die schönste
Prinzipienfestigkeit nützt, wenn man auf einmal draußen
ist und nicht mehr zu dem „arco costitutionale“ gehört,
der um die italienische Politik kungelt: Wenn vorher
die größte Gefahr die der Integration war, so ist es
jetzt die der Isolation.
Kaum draußen sucht die übrig
gebliebene Rifondazione Wege, wieder einzusteigen. Der
realpolitische Flügel unter Cossutta gründet eine neue
Partei mit dem patriotischen Namen „partito dei comunisti
italiani“ und löst den ewig widersprüchlichen Versuch,
der Regierung von außen linke Zugeständnisse abzuringen,
ins andere Extrem auf: Man steigt in die neue Regierung
unter d’Alema voll ein, stellt den Justizminister und
bekennt zum ohne wenn und aber zum aktuellen
Staatsprogramm: Die Linke muß Verantwortung
übernehmen; Träume sind für die Jugend. Man muß zwischen
Hoffnungen und Realität unterscheiden.
(Cossutta).
Auch solche Konsequenz kann beeindrucken – dennoch wird
es nicht lange dauern, bis unter den Kommunisten Italiens
einige entdecken, daß sie schon irgendeinen Unterschied
zu den Linksdemokraten brauchen, wenn sie sich nicht
gleich dort einreihen wollen. Darüber können sie sich ja
wieder spalten.
Die Basis ist nicht klüger als die Führung. Soweit sich das Parteileben der Rifondazione, in der sich immerhin die Aktivisten des alten PCI und die außerparlamentarische Linke gesammelt hatten, von dem regulärer Wahlparteien unterscheidet, ist es ein Beitrag zur Selbstzerstörung des vorgefundenen kommunistischen Massenwillens. Kritik an einer kommunistischen Strategie, die den Kampf gegen die kapitalistische Herrschaft zu einer Frage glaubwürdiger Selbstdarstellung geraten läßt, kommt nicht auf. Statt dessen wird brav der Kampf zweier Linien nachvollzogen deren eine linksradikale Isolation und die andere rechtsopportunistische Anpassung heißt. Zeit ihres Wirkens und nicht erst jetzt verliert die Partei einzelne und Gruppen enttäuschter Mitglieder, denen sie entweder nicht radikal genug oder zu radikal ist. Um die aufregende Frage nach dem richtigen Maß der Radikalität kreisen die Debatten der Partei seit je – eine andere Schulung als diese gibt es dort nicht. Nach einigen Monaten stellt sich heraus, daß die Basis zum überwiegenden Teil die Mischung von Anpassung und Distanz, wie sie der Flügel um Bertinotti vertritt, glaubwürdiger findet als die unbedingte Verpflichtung auf die Regierungslinie, die Cossuttas Kommunisten Italiens gewählt haben. Alle Beteiligten freilich lernen aus ihrer Spaltung, daß Kommunismus entweder Illusion oder bedingungslose Teilnahme an der Staatsverwaltung zum Zwecke ihrer Verbesserung ist. Oder eine gelungene Mischung aus beidem.