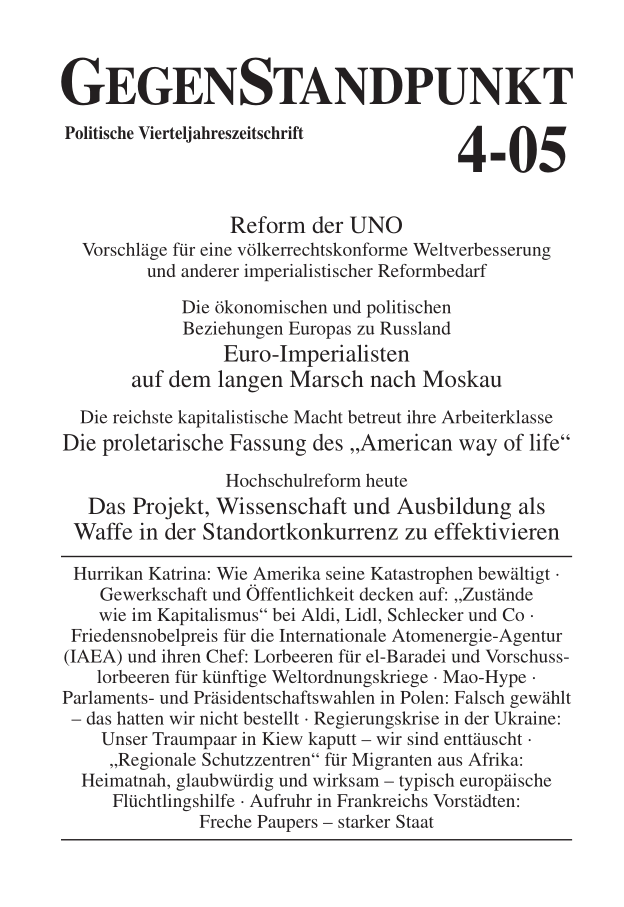Die reichste kapitalistische Macht betreut ihre Arbeiterklasse
Die proletarische Fassung des „American way of life“
200 Jahre kapitalistische Erfolgsgeschichte haben die USA nicht nur zur reichsten und mächtigsten Nation der Welt gemacht; zugleich fehlen einer stets wachsenden Anzahl amerikanischer Bürger elementare Notwendigkeiten des Lebens – vom bezahlbaren Dach über dem Kopf bis hin zur Absicherung gegen die Kosten von Krankheit und Alter. Und der maßgebliche Sachwalter der Nation bekennt sich offen zu dieser Sachlage: Er erklärt die Sicherstellung solcher Lebensnotwendigkeiten zum idealen Ziel staatlicher Politik, dem sich nur mit „Mut“ und viel „Idealismus“ allenfalls genähert werden kann.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Das amerikanische System sozialer Betreuung: „Hilfe zur Selbsthilfe“
- II. Die Gewerkschaft als Organisator des Sozialen
- III. Sozialreform, the American way
- 1. Der Rückzug des Kapitals aus der Abteilung Soziales erzeugt die wachsende Verarmung derer, die auf solche Kassen angewiesen sind
- 2. Der staatliche Reformbedarf …
- 3. … und seine aktuelle Zuspitzung: Die „Ownership Society“ als Reformprojekt der Rentenkasse
- Fazit: Der „hard-working American“ als Leitfigur amerikanischer Sozialpolitik
- Nachtrag I Die Verwaltung des Elends Welfare: Un-American contributions for losers
- Nachtrag II Charity: Privat contributions for losers
Die reichste kapitalistische Macht betreut ihre Arbeiterklasse
Die proletarische Fassung des „American way of life“[1]
Wie es um die materielle Lage der arbeitenden Klasse in den USA bestellt ist, teilt der Präsident der USA in seiner Rede zum Amtsantritt mit. Da verspricht er seinen Bürgern Folgendes:
„Amerika benötigt Idealismus und Mut, weil wir ein wesentliches Werk zu Hause zu erledigen haben – das nicht vollendete Werk amerikanischer Freiheit … Nach dem Ideal amerikanischer Freiheit gelangen die Bürger zur Würde und Sicherheit ökonomischer Unabhängigkeit, statt sich am Rande des Existenzminimums abzuarbeiten … Wir werden das Eigentum an Wohnstätten und Unternehmen, an Rentensparkonten und Krankenversicherung ausweiten – und damit unsere Bürger befähigen, die Herausforderungen eines Lebens in Freiheit zu meistern.“ (G.W. Bush, Inaugural Address; 21.1.05)[2]
Eine aufschlussreiche Diagnose. 200 Jahre kapitalistische Erfolgsgeschichte haben die USA nicht nur zur reichsten und mächtigsten Nation der Welt gemacht; zugleich fehlen einer stets wachsenden Anzahl amerikanischer Bürger elementare Notwendigkeiten des Lebens – vom bezahlbaren Dach über dem Kopf bis hin zur Absicherung gegen die Kosten von Krankheit und Alter. Und der maßgebliche Sachwalter der Nation bekennt sich offen zu dieser Sachlage: Er erklärt die Sicherstellung solcher Lebensnotwendigkeiten zum idealen Ziel staatlicher Politik, dem sich nur mit „Mut“ und viel „Idealismus“ auch nur genähert werden kann. Dabei ist Bush ja keineswegs der erste Präsident, der solches verkündet: Ob nun unter dem Titel „war on poverty“ oder in der Bush-Variante einer anzustrebenden „ownership society“: Noch jeder amerikanische Präsident erklärt es zum maßgeblichen Bestandteil seines Programms, sich auch und gerade der Lebenslage der Abteilung seiner Bürger annehmen zu wollen, die es immerzu nicht schaffen, für ihren eigenen Unterhalt zu sorgen. Die gebetsmühlenhafte Wiederholung dieser Botschaft ist allerdings nie als Eingeständnis irgend eines Versagens an dieser Front, gar als staatliche Selbstkritik gemeint. Armut ist nun mal die unverwüstliche Kehrseite des amerikanischen Reichtums: Wenn allen staatlichen Anstrengungen zum Trotz der wachsende Reichtum mit einer Tendenz der Armen einher geht, immer mehr und immer ärmer zu werden, dann ist das eben eine Sachlage, mit der die Herrschaft sich konfrontiert sieht; eine „Herausforderung“, der sie sich stellt und auf die sie immer aufs Neue passende „Antworten“ sucht und suchen muss.
Im Falle der Bush-Regierung lautet die Antwort: Leuten, die es mangels eigener Mittel zur „selbstverantwortlichen Bewältigung“ ihres Lebens nicht bringen, soll per Einsatz der Staatsgewalt dazu verholfen werden. Mit diesem Versprechen bekennt sich der Staat zu den Gründen, die allererst dafür sorgen, dass Leute überhaupt mittellos werden und bleiben: Auf der Grundlage will er das Seine dazu tun, dass die Leute trotzdem zurechtkommen. Diese Gründe sind staatlich gewollt und ins Werk gesetzt: Arm ist man in den USA – genauso wie hierzulande –, weil man das Pech hat, zur Klasse der Lohnarbeiter zu gehören. Diese Gattung Mensch arbeitet in den USA ebenso wenig wie in Europa, Japan und anderswo für die Sicherung des eigenen Unterhalts: Ihre Arbeit dient
der Vermehrung des Vermögens amerikanischer Kapitaleigentümer; sie stiftet Reichtum und Macht des amerikanischen Staates. Der sorgt deshalb auch mit seiner Gewalt dafür, dass die Leute von dem zu leben haben, was ihre Arbeitskraft dem Kapital wert ist; der Lohn, der dem Kapital Wachstum sichert, ist der Lebensunterhalt, der den arbeitenden Massen zusteht. Diese Leistung amerikanischer Arbeit für amerikanischen Reichtum kann ein Präsident nur gutheißen; zumal die arbeitenden Massen so, durch ihre Arbeit und den Lohn, den sie dafür erhalten, am Fortschritt dieses Reichtums aus seiner Sicht adäquat beteiligt sind. Bleibt der leidige Sachverhalt, dass dieser Lohn bei ziemlich vielen Leuten in ziemlich vielen proletarischen Lebenslagen chronisch zum Leben nicht reicht – was der Staat gar nicht groß dementieren will. Ein anständiger proletarischer Amerikaner hat dann zuzusehen, wie er in aller Freiheit mit dieser Sachlage zurechtkommt. Sofern und soweit er dies tut, greift ihm die Staatsgewalt durchaus mit der einen oder anderen Unterstützungsleistung unter die Arme: Immer streng nach dem Maßstab, dass der kompensatorische Ersatz von Mitteln, die in der proletarischen Kasse fehlen, dem hohen Ziel zu dienen hat, mittellose Leute zu selbstverantwortlichen Bewältigern der eigenen Notlagen zu machen. Um mit Bush zu sprechen: Die staatliche Betreuung proletarischer Not soll Lohnarbeiter befähigen, sich den „Herausforderungen des Lebens in einer freien Gesellschaft“ zu stellen. Was immer diese auch an Zumutungen für sie bereithält: Das ist sie dann, ihre Teilhabe am „American dream“.
I. Das amerikanische System sozialer Betreuung: „Hilfe zur Selbsthilfe“
Die erste sozialpolitische Tat des amerikanischen Staates besteht darin, jedem Bürger klassenübergreifend und ohne Ansehen der Person und der Rasse bei seiner Geburt eine Sozialversicherungs-Nummer zu verpassen. Mit dieser Kennzahl erfasst der Staat seine Bürger in allen Abteilungen der Rechte und Pflichten, mit denen sie es im Zuge ihres Arbeits- und Familienlebens zu tun bekommen. Welche Rechte und Pflichten das dann sind, wie sie nach welchen staatlichen Gesichtspunkten ausgestaltet sind – das kommt ganz darauf an. Die flächendeckende Zuständigkeit, die der Staat in Sachen Soziales für seine Bürger geltend macht, ist mit einer flächendeckenden Ausstattung mit Wohltaten nicht zu verwechseln. Die hat sich ein guter Ami vielmehr in wahrsten Sinne des Wortes zu erarbeiten; wenn nicht mit eigenem Eigentum, dann eben mit dem Dienst am Eigentum anderer. Wie gut man sich dabei bewährt, entscheidet darüber, was man von den Zusatzveranstaltungen in Sachen Soziales hat, mit denen der Staat die Anstrengungen seiner minderbemittelten Bürger begleitet, sich mit Lohnarbeit durchs Leben zu schlagen. Der amerikanische Staat jedenfalls tut sein Bestes, damit auch in diesem „Sektor“ die private Initiative ihre segensreichen Wirkungen entfalten kann und möglichst wenig durch staatliche Eingriffe behindert wird.
1. Die Rente: Altersarmut in Selbstverantwortung
a) „Social Security“: Der Staat verpasst der Altersarmut eine Kasse
In den USA gibt es eine staatlich organisierte Rentenkasse mit dem aufschlussreichen Namen „Social Security“. Und in der Tat: Die Rente ist die einzige Sozialleistung, die der US-Bürger „sicher“ hat; d.h.: Die einzige Abteilung Soziales, in der der Staat sich dazu durchgerungen hat, eine umlagenfinanzierte staatliche Zwangskasse europäischer Machart einzurichten. Das heißt weder, dass jeder Ami eine Rente bekommt, noch, dass sie für diejenigen, die eine bekommen, zur Finanzierung des Lebensabends reicht. „Sicher“ ist erstens, dass man als Beitragszahler in der Zwangskasse drin ist, sobald und solange man arbeitet; von den Einkünften der Lohnarbeiter wie Selbstständigen[3] kassiert der US-Staat die Beiträge, mit denen sich die Kasse finanziert. Sicher ist zweitens, dass man in der Frage, ob und wenn ja wie viel Rente man bekommt, nicht viel in der Hand hat: Sowohl die Zeit, die man gearbeitet haben muss, um in den Genuss einer Zahlung zu kommen, als auch deren Höhe legt der Organisator der Umlage nach seiner Kassenlage fest. Und sicher ist drittens, dass man als Rentner darauf angewiesen ist, die staatlich verfügten Zahlungen zu erhalten: Für zwei Drittel der Normalverdiener-Rentner stellt der Social Security Check inzwischen das fast ausschließliche Alterseinkommen dar.[4]
Das Verfahren, das der amerikanische Staat in dieser Abteilung Soziales zur Anwendung bringt, ist von hierzulande bekannt: Ausgehend von dem Urteil, dass der in einem proletarisches Arbeitsleben verdiente Lohn je für sich für die Finanzierung der Zeit nach der Arbeit nicht reicht, macht er durch Zwangsbeiträge und ein Umlageverfahren die Gesamtheit seiner arbeitenden Bevölkerung dafür haftbar, dass ihre Klassenbrüder auch im Alter noch ein Einkommen haben – oder wenigstens die meisten von ihnen ein bisschen. Wer wann und wie viel, legt der Staat in aller Freiheit fest: Er legt das Renteneintrittsalter auf demnächst 67 Jahre fest, knüpft die Anspruchsberechtigung von Rentnern an 10 Jahre Beitragszahlung und beschränkt zugleich die Rentenzahlung auf maximal 40% des (nach einem komplizierten Verfahren errechneten) Durchschnitts des in der gesamten „Lebensarbeitszeit“ verdienten Lohns. So sorgt der Staat dafür, dass nur Leute etwas bekommen, die ihren Willen zur Arbeit nachweislich lange und kontinuierlich betätigt haben; und die nur wegen Alter, also garantiert nicht wegen fehlenden Willens zur Arbeit aus der Konkurrenz ausgemustert sind. In der staatlichen Rentenkasse anerkennt der Staat die Bereitschaft von Proleten, sich um den Reichtum der Nation verdient zu machen; und diese Anerkennung lässt er ihnen so zuteil werden, dass er am Ende aller Mühen das lebenslange Vorhandensein dieser Bereitschaft am Erfolg beim Erwerb von „entitlements“ abliest und materiell honoriert.[5] So kombiniert er das Prinzip der Kollektivhaftung mit dem vielgerühmten „Geist der Selbstverantwortung“: Also mit dem Auftrag an die Betroffenen, die staatliche Rente als Ansporn zur privaten Selbstvorsorge zu betrachten. Und zwar in doppelter Hinsicht: Sie müssen zusehen, „in Arbeit“ zu kommen und zu bleiben; und sie müssen sich auf privatem Wege darum kümmern, dass die Rente hinterher irgendwie reicht.
b) Die Betriebsrente: Soziale Absicherung als Vertragsgegenstand zwischen Kapital und Arbeit und sprudelnde Quelle von Finanzkapital
Wie hart die Altersarmut zuschlägt, hängt von der privaten Absicherung ab. Dass diese für die meisten unerschwinglich ist, gesteht der Staat großzügig ein, wenn er bei Rentnern über 65 auf die Kontrolle darüber verzichtet, ob sie neben ihrer Rente noch Einkünfte aus Arbeit haben. Viele Rentner – nicht nur die, die zuvor Billigstlöhner waren – arbeiten irgendwie weiter; eine Aufstockung der staatlichen Rente durch private Vorsorge ist eben für die meisten unerschwinglich. In größerem Stil findet sie deshalb vorwiegend in Gestalt von Betriebsrenten statt, also dort, wo Unternehmen mit einer Gewerkschaft bzw. Belegschaftsvertretung eine entsprechende Vereinbarung ausgehandelt haben oder aus eigenen Erwägungen eine Rentenkasse als betriebliche Sozialleistung einrichten.
Mit den betrieblichen Sozialleistungen hat es seine eigene Bewandtnis. Das Kapital berechnet den Aufwand für die betrieblichen Vorsorgekassen einerseits als Bestandteil der betrieblichen Lohnsumme: Als Teil der Kosten also, die es für die Anwendung der Arbeitskraft zahlt. Dieser Lohnbestandteil hat andererseits die kleine Besonderheit, dass er nicht an dessen „Empfänger“ ausgezahlt wird, sondern im Betrieb verbleibt und sich in den Händen des Unternehmens zu schönen Sümmchen addiert. Diese liegen nicht beim Betrieb in irgendwelchen Tresoren herum und warten auf Auszahlung, sondern werden wie jedes nicht zur unmittelbaren Weiterführung des Geschäfts benötigte Geld als Kapital verwandt, d.h. in renditebringenden Papieren angelegt, wo sie – wenn alles nach Plan geht – Überschüsse abwerfen.[6] Aus diesen Überschüssen werden dann, wenn Beschäftigte in Rente gehen, deren Rentenansprüche bedient. So wird ganz systemgerecht aus Lohnbestandteilen Kapital und der schnöde kapitalistische Gewinntrieb in den Dienst der sozialen Absicherung des proletarischen Alters gestellt; und der Staat, dem diese Art sozialer Vorsorge nur recht ist, begünstigt sie, indem er Rücklagen für Betriebsrenten steuerlich begünstigt und die ausgezahlten Rentenbeiträge steuerfrei stellt.
Auf diese Weise sind die betrieblich oder gleich gewerkschaftlich kontrollierten „pension funds“ zu den größten Finanzkapitalen in den USA herangewachsen – die Pensionskassen der Betriebe haben ihren Umfang in den letzten 10 Jahren auf 13 Billionen Dollar verdreifacht. Das Geschäft mit der privaten Altersvorsorge ist eben beste Grundlage für Kapitalbildung und -vermehrung. Der kleine Widerspruch an dieser besonderen Form der Kapitalanlage bleibt allerdings ihr etwas kapitalwidriger Zweck: Die Vermögensvermehrung, die hier stattfindet, hat – letztlich – für Auszahlungen gerade zu stehen, die sich nach Zeitpunkt und Umfang nicht den Kriterien optimaler Vermögensverzinsung verdanken, sondern den vertraglich definierten Rentenansprüchen der lieben Mitarbeiter. Selbstverständlich beherrschen Unternehmen allerlei Methoden, um mit diesem Widerspruch umzugehen, d.h.: Die Finanzlage der Kasse an die jeweils gezahlte Rentensumme anzupassen bzw. umgekehrt. Im Ursprung beruhten die meisten Rentenansprüche auf sogenannten ‚defined benefit plans‘, in denen der spätere Auszahlungsbetrag fest steht; die Höhe des rechnerischen Lohnbestandteils, den der Betrieb jeweils pro Beschäftigten in diese Kasse zahlt, wird dann jeweils neu festgelegt bzw. zwischen Gewerkschaft und Betrieb neu ausgehandelt. Die Mehrzahl der Unternehmen hat inzwischen ihre Rentenfonds auf ‚defined contribution plans‘[7] umgestellt, in denen die Einzahlungsbeträge festliegen, aber offen bleibt, wie viel der Einzahler dann am Ende an Rente bekommt. Im Zuge der Einführung dieser neuen Rentenpläne wurden in aller Regel die Leistungsempfänger zusätzlich zur Kasse gebeten. Auf diese Weise sichern sich die Unternehmen freie Verfügung über die Kasse als Kapitalvermehrungsmittel: Der Zufluss der Beiträge in die Kasse bleibt verlässlich; die Frage, wie viel Geld je in den Taschen der prospektiven Rentner landet, ist voll zu deren Risiko gemacht.
2. Das amerikanische Gesundheitswesen: Ein Konglomerat von Betriebskrankenkassen, „Medicare“ und „Medicaid“
Ein der Rentenkasse entsprechend organisiertes Krankenkassenwesen kennt der amerikanische Sozialstaat nicht.[8] Die Sorge um Erhalt und Pflege der eigenen Physis ist in den USA genau so Privatsache wie die um Essen und Wohnen – jedenfalls erst einmal. Und weil dieses Lebensrisiko für den Arbeitsmann genauso wenig privat bewältigbar ist wie die Armut im Alter, gilt für die Krankenversicherung das gleiche wie für die Rente: Für die Dauer des aktiven Arbeitslebens ist sie eine Sache der Vereinbarung zwischen Kapital und Arbeit, also betrieblicher Krankenkassen. Auch die gibt es vornehmlich in den Bereichen der Wirtschaft, in denen sich Gewerkschaften durchsetzen konnten; aber auch andere Unternehmen kennen durchaus Gesichtspunkte, die ihnen die Einrichtung einer Betriebskrankenkasse einleuchten lassen. Diese betrieblichen Krankenkassen finanzieren sich auf die gleiche Art und Weise wie die betrieblichen Rentenkassen und werden vom Staat ebenfalls steuerlich unterstützt. Mit einem gesetzlichen Regelwerk sorgt der Staat dafür, dass das Kapital mit den Kassen, die es einrichtet, auch gewissen grundlegenden Anforderungen in Sachen Gesundheitsvorsorge entspricht. Wie die Betriebe die Kosten für die Kasse als Lohnbestandteil verbuchen und ihrer Belegschaft in Rechnung stellen, ist ihnen selbst überlassen.
Mit dem der Ausbeutung eigenen immensen Bedarf an „Gesundheitsdienstleistungen“[9] und einem Unternehmertum, das aus allem ein Geschäft zu machen versteht, ist so die Basis für die größte Gesundheitsindustrie der Welt gelegt – und zugleich die Gesundheitsvorsorge für die lohnarbeitenden Massen zu einer rundum unsicheren Sache gemacht. Nicht nur Umfang und Ausmaß der Gesundheitsvorsorge der Abteilungen des Proletariats, die Arbeit haben, sind ausdrücklich und von vornherein von den geschäftlichen Berechnungen des Kapitals abhängig gemacht; für all diejenigen, die keine haben, sind diese Kassen nicht zuständig. Eine flächendeckende Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung kommt darüber also nicht zustande; ein Umstand, dessen sich der amerikanische Staat dann doch noch ansatzweise kompensatorisch annimmt. So hat er in den 60er Jahren mit „Medicare“ seine Rentenversicherung um eine Krankenversicherung für Rentner ergänzt, die als Pflichtversicherung Bestandteil der Rentenkasse ist und über einen zusätzlichen Beitragsanteil finanziert wird – auch das im Übrigen schon eine Reaktion des Staates auf den Umstand, dass die Betriebskrankenkassen immer seltener die verrenteten Mitarbeiter mit versicherten. Und erst kürzlich hat sich der Staat genötigt gesehen, diese Krankenversorgung der Alten um eine Pillenversicherung[10] zu ergänzen; so wenig leistet ‚Medicare‘ – offenkundig nur das Minimum an gesundheitlicher Betreuung der Alten, das der Staat für unumgänglich hält. Auch hier gilt: Leistungen erhalten nur diejenigen, die es – genau wie bei der Rente – zu einer Mindestnützlichkeitsdauer von 10 Jahren fürs Kapital gebracht haben. Die übrigen müssen sich, wenn überhaupt, mit einer schmerzlich spürbaren Schlechterversorgung im Rahmen von „Medicaid“ zufrieden geben. Mit diesem 1965 eingerichteten Programm betreut der Staat diejenigen, die es nachweislich zu keinerlei Eigenvorsorge in Sachen Gesundheit bringen – auch hier keineswegs in jedem Fall, vielmehr gemäß staatlich definierten Zugangsberechtigungskriterien.[11]
3. Betreuung der Arbeitslosigkeit
Wer in den USA das Pech hat, den freien Arbeitsmarkt zu bevölkern, ohne es zu einer Beschäftigung zu bringen, ist – so wollen es die „Gesetze“ der freien Marktwirtschaft – mittellos. Ob er deshalb in den Genuss irgendwelcher staatlicher Zuwendungen kommt und wenn ja, welcher, steht dahin. Mit einer Unemployment Insurance
(UI) erkennt der Staat im ‚Social Security Act‘ von 1935 zwar an, dass ‚hire and fire‘ zu den Lebensrisiken eines Lohnarbeiters gehört; das heißt aber noch lange nicht, dass er alle Leute, für die das Kapital keine Verwendung hat, in die Rubrik „arbeitslos“ hinein sortieren will. Auch „Arbeitslosigkeit“ ist ein Status, den man sich verdient haben muss; dadurch nämlich, dass man schon einmal gearbeitet hat, also die eigene Nützlichkeit für einen Arbeitgeber schon bewiesen hat. Nur dann nämlich kommt man überhaupt in den Genuss einer Anspruchsberechtigung für Zahlungen aus einer UI-Kasse.
Deren Einrichtung und Organisation überlässt der Zentralstaat weitgehend[12] dem Budget der Einzelstaaten; diese definieren, ob mit Arbeitslosigkeit überhaupt ein staatlicher Betreuungsfall vorliegt. Das ist sehr sachgerecht: So entscheiden die Behörden „geschäftsnah“ darüber, welche Mittel sie für die Pflege der aktuell überschüssigen Bestandteile der örtlichen Reservearmee auslegen wollen. Ihrer Haushaltslage entnehmen sie dann, ob sie auch können, was sie wollen. In die Zuständigkeit der Einzelstaaten fällt es, sich von den Unternehmern Steuerbeiträge zu holen, aus denen dann ein „trust fund“ für die Zahlung von Arbeitslosengeld zu bilden ist; die Unternehmen wälzen diesen Betrag in aller Regel auf den Lohn ab. Wer dann jeweils anspruchsberechtigt ist,[13] definieren die Behörden mit entsprechenden Titeln; wer wie lange wie viel Geld bekommt, ist eine abhängige Variable der Finanzierungslage der UI-Kasse. Maximal sind 26 Wochen Unterstützung möglich; in staatlich ausgerufenen Notstandsfällen – wie etwa bei „Katrina“ – ist diese Frist um 13 Wochen verlängerbar. Im landesweiten Schnitt kommen so ca. 16 Wochen Bezugsdauer zustande, mit erheblichen Unterschieden bei den ausgezahlten Beträgen, die landesweit bei durchschnittlichen 47% des letzten Lohns liegen. So sorgt der Staat über Zahlungsdauer und Bezugssumme dafür, dass entlassene Lohnarbeiter gar nicht erst auf die Idee kommen, sich im Status des staatlich alimentierten Arbeitslosen einzurichten, statt sich selbstverantwortlich um neue Beschäftigung zu bemühen – wenn es sein muss, auch in der entgegengesetzten Ecke des weiten Landes.
Die Hälfte der Arbeitslosen fällt erst gar nicht unter die Bestimmungen der Arbeitslosenversicherung. Ein Großteil derer, die für den wunderbar flexiblen Arbeitsmarkt ihren Dienst tun – das Heer der Halbtagsbeschäftigten, Zeitarbeiter, Leiharbeiter usw. –, bekommt es mit seinen unzuverlässigen Arbeitsverhältnissen einfach nicht hin, bei den Antragsstellen irgendeine Anspruchsberechtigung nachzuweisen. So sorgen die Regelungen der Versicherung noch einmal explizit dafür, dass diese Klientel dem Arbeitsmarkt nicht ausgeht.
II. Die Gewerkschaft als Organisator des Sozialen
Soviel ist klar: Bei dem, was der Lohnarbeiter in den USA an Sozialleistungen zu erwarten hat, spielen die Gewerkschaften eine gewichtige Rolle. Sie erstreiten für ihre Mitglieder nicht nur Löhne, sondern auch soziale Leistungen; dazu gehören neben den betrieblichen Kassen für Gesundheits- und Altersvorsorge auch Elemente von Arbeitsplatzsicherheit. In gewerkschaftlich durchorganisierten Unternehmen wird über die Aufstiegsberechtigung in der betrieblichen Arbeitsplatz- und Lohnhierarchie nach Dauer der Betriebszugehörigkeit entschieden; ebenso bei Entlassungen und Wiedereinstellungen; so verschaffen Gewerkschaften ihren Mitgliedern das Privileg, im Unterschied zum Heer derer, die jede Arbeit annehmen müssen, zu einer ganz speziellen betrieblichen „Reservearmee“ zu gehören.
Dieses Privileg, in einer „unionized company“ zu arbeiten, ist für die amerikanischen Arbeitervereine denn auch das Hauptwerbeargument dafür, dass Arbeiter sich gewerkschaftlich organisieren sollten:
„Gewerkschaftsmitglieder beziehen höhere Löhne und Sozialleistungen als Arbeiter, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Im Durchschnitt liegen die Löhne gewerkschaftlich organisierter Arbeiter 28% über denen in nicht gewerkschaftlich organisierten Bereichen. Nur 15% der nicht organisierten Arbeiter haben garantierte Rentenansprüche; bei Gewerkschaftsmitgliedern sind es 69%. 80% aller Gewerkschaftsmitglieder sind durch eine betriebliche Krankenversicherung abgesichert, bei Nichtgewerkschaftern liegt der Prozentsatz bei 50%.“ (www.afl-cio.org)
Soweit die gewerkschaftliche Erfolgsmeldung über den „union advantage“. Der Haken dabei: Die Mehrheit der US-Arbeiter ist eben nicht gewerkschaftlich organisiert und ist deshalb bei den gewerkschaftlich erkämpften Sozialleistungen nicht dabei. Das hat zunächst einmal etwas damit zu tun, unter welchen Bedingungen ein gewerkschaftliches Vertretungsrecht in den USA überhaupt zustande kommt.
1. Wie der Staat den gewerkschaftlichen Einspruch regelt
Wie jedes kapitalistische Land kommen auch die USA nicht umhin, sich des Gegensatzes zwischen den Dienstkräften der Nation und ihren Arbeitgebern rechtlich anzunehmen. Der gewerkschaftliche Einspruch gegen die vom Kapital verfügten Arbeits- und Lebensbedingungen des Proletariats muss, wenn er schon nicht dauerhaft zu verhindern geht, rechtlich eingehegt werden.[14] Dabei wird wie überall darauf geachtet, dass sich der gewerkschaftliche Einspruch im rechten Verhältnis zum nun einmal maßgebenden unternehmerischen Interesse betätigt. In den USA gibt es dafür seit 1935 ein National Labor Relations Board
(NLRB).[15] Diese Instanz gibt dem gewerkschaftlichen Vertretungsanspruch die Verlaufsformen vor, die das Zustandekommen einer gewerkschaftlichen Vertretung im Betrieb regeln. Ob sich aber eine Gewerkschaft als Vertretung durchsetzen kann oder nicht – bleibt dann dem Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit überlassen.
Das geht so: Wenn eine Gewerkschaft Unterschriften von 30% einer Belegschaft vorlegen kann, schaltet sich auf Antrag[16] die Arbeitsbehörde ein und organisiert Anerkennungswahlen. Wenn dabei mehr als 50% der Belegschaft mit Ja stimmen, ist die Gewerkschaft zunächst anerkannt und kann die Aufnahme von Tarifverhandlungen bei der Firma beantragen. Ob solche Verhandlungen dann auch zustande kommen, ist allerdings noch sehr die Frage. Das NLRB-Regularium sieht Einspruchsrechte des Arbeitgebers vor, die die Aufnahme des collective bargaining
auf unbestimmte Zeit verzögern können. Zwar gibt es gesetzlich festgelegte Fristen für die Aufnahme von Verhandlungen, eine Betriebsleitung weiß aber allemal Bußgelder für überzogene Fristen gegen die Vorteile eines gewerkschaftsfreien Betriebs abzuwägen – zumal sie die gewonnene Zeit gleich sinnvoll dafür nutzen kann, um die antragstellenden Belegschaftsmitglieder eines Besseren zu belehren. Entschließt sich die Gewerkschaft oder das gewerkschaftliche Gründungsprojekt zwecks Durchsetzung der Aufnahme von Tarifverhandlungen zu einem Streik, darf der Betrieb die Gewerkschaftsmitglieder vor die Tür setzen und durch willige Streikbrecher dauerhaft ersetzen. Damit diese Strategie auch richtig „zieht“, baut das Gesetz noch eine weitere Hürde auf: Bis zum Plazet der Geschäftsleitung zur Aufnahme von Tarifverhandlungen darf kein Gewerkschafter ohne deren Genehmigung das Betriebsgelände betreten. So ist dafür gesorgt, dass die Antwort auf die Frage, wann ein gewerkschaftlicher Einspruch rechtmäßig ist, an der Durchsetzungsfrage vor Ort hängt. Deshalb gibt es das ganze Anerkennungsprozedere auch umgekehrt: Wenn mindestens 30% einer Belegschaft es beantragen, kann eine im Betrieb schon etablierte Gewerkschaft nachträglich mit demselben Prozedere (über 50%) auch wieder abgewählt werden.
Einige Bereiche der nationalen Wirtschaft stellt der Staat, was gewerkschaftliche Betätigung angeht, von vorne herein unter Sonderregeln. Nicht unter das NLRB-Statut fallen z.B. die Bereiche Landwirtschaft und Infrastruktur sowie insbesondere der öffentliche Dienst. Hier ist es den „Public Employment Relation Boards“ (PERB) der Einzelstaaten überlassen, in wieweit das Regularium des NLRB auf den Staat als Arbeitgeber überhaupt Anwendung findet. Auf diesem Felde tun sich wieder einmal vor allem die Südstaaten hervor; auf den Landesdurchschnitt berechnet ist es ca. 40% der beim Staat Beschäftigten verboten, sich am Arbeitsplatz gewerkschaftlich zu betätigen. Dennoch ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad inzwischen im öffentlichen Dienst noch am höchsten.
2. Wie sich die Gewerkschaften ihren Einfluss erkämpfen
a) „Organize or die“
Auf dieses staatliche Prozedere haben sich die US-Gewerkschaften als positive Grundlage für die Interessensvertretung der Arbeiter eingelassen. Entsprechend sieht das Gewerkschaftsleben aus. Das Aushandeln von Tarifverträgen mit dem Kapital findet statt zwischen einzelnen Unternehmen bzw. Betrieben und Niederlassungen dieser Unternehmen („bargaining units“) und landesweit zig tausend gewerkschaftlichen „locals“. Selbst wo „locals“ zu einem größeren Gewerkschaftsverband organisatorisch zusammen geschlossen sind, was meistens der Fall ist, gibt es die unterschiedlichsten Abmachungen für verschiedene Betriebe und Arbeitergruppen. Wenn mehrere Gewerkschaften für unterschiedliche Betriebsteile zuständig sind oder sich ihre Zuständigkeit dort erst erkämpfen wollen, kommt es dann nicht selten zu Schönheiten wie der, dass ein Gewerkschaftsteil mit seinem Kampf um Vertretung in Konkurrenz zu einer anderen gerät; auch dass eine Gewerkschaft sich als Streikbrecher im Revier der anderen „brotherhood“ anbietet, ist als Durchsetzungsstrategie durchaus im Programm. Entsprechend heftig toben dann nicht nur die Auseinandersetzungen der Gewerkschaftseinheiten mit dem Kapital, sondern durchaus auch gegen einander. Eine amerikanische Gewerkschaft organisiert nicht die Klasse; sie will gar nicht so etwas wie der „Arm einer Arbeiterbewegung“ sein. Sie erstreitet und verteidigt mit ihrem Anerkennungskampf in den „bargaining units“ die besonderen Rechte ihrer Klientel; ihr Erfolg in dieser Frage entscheidet damit zugleich auch immer über ihr Recht, diese zu vertreten. Deshalb sieht sie zu, sich für diese Klientel möglichst unverzichtbar zu machen, und strebt danach, möglichst alle Bedingungen des Arbeitslebens zum Gegenstand von Vereinbarungen mit der Betriebsleitung zu machen: Lohngruppen, Berufsgruppen, Aufstiegswege, soziale Leistungen für Krankheit und Rente. So verschaffen die Gewerkschaften den von ihnen Vertretenen den Status eines Besserverdienenden
– einen Status, den es sonst nur nach Maßgabe des Unternehmens geben würde, also in der Regel überhaupt nicht.
So sieht das Soziale dann aus, das diese Arbeitervertreter organisieren: Inwieweit Lohnarbeiter in dessen Genuss kommen, ist von vorn bis hinten abhängig davon, in welcher Branche, in welcher Region, in welcher gewerkschaftlichen Macht- und Konkurrenzlage sie das Glück oder Pech haben, zu arbeiten.
b) Die Gewerkschaft als Lobby
Über allem haben die Gewerkschaften einen Dachverband, den AFL-CIO. Dieser repräsentiert über die konkurrierenden einzelgewerkschaftlichen Interessen hinweg den „union advantage“, also so etwas wie eine gemeinsame Gewerkschaftsbewegung für das „working America“. Denn in einem sind sich die Einzelgewerkschaften dann doch noch einig: Der Erfolg ihrer Kämpfe ist auf den „starken Arm“ des Staates angewiesen. Davon, dass der auf sie hört, dass ihre Stimme in Washington etwas zählt, gehen sie schon deswegen aus, weil sie schließlich Organisator des Sozialen in wichtigen Teilen der amerikanischen Industrielandschaft sind. So kriegt das „working America“, oder wie der AFL-CIO seine bevorrechtete Arbeiter-Klientel stolz nennt, die American middle class
eine Lobby bei der Herrschaft. Allen seinen Geschäftsbereich betreffenden Staatsmaßnahmen entnimmt der Dachverband die Beförderung oder Behinderung von Gewerkschaftsanliegen; an jedem neuen Gesetz soll man den jeweiligen Einflussstand der Gewerkschaft ablesen bzw. – was so ungefähr dasselbe sein soll – eine mehr oder minder gute Bedingung für gewerkschaftliche Arbeit. Um solche Bedingungen zu befördern, suchen die Gewerkschaftsoberen bei Politikern und Parteien ihre Sichtweise zu verbreiten, der zufolge die politischen Instanzen gut beraten sind, wenn sie die Gewerkschaften als maßgebliche Repräsentanten einer wichtigen Abteilung strebsamer Staatsbürger anerkennen und in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen. Zur Verbreitung dieses Standpunkt lassen die Gewerkschaftsbosse dann wie jede andere Lobby auch jede Menge Wahlkampfspenden fließen. Nicht nur bei den ausdrücklich für das Soziale zuständigen Abteilungen des Staates, sondern auch beim Handels- und Außenministerium werden sie vorstellig, um gewerkschaftsfreundliche Entscheidungen in Haushaltsfragen, in Sachen Außenhandel etc. – herbeizuführen. Dazu gehört auch, dass sie im Namen amerikanischer Arbeitsplätze Partei ergreifen für amerikanische Wertarbeit und amerikanische Unternehmen gegen auswärtige „Wettbewerbsverzerrungen“ und bei allen handelspolitischen Unternehmungen der Regierung von CAFTA bis China darauf dringen, dass Washington dem Ausnützen von Billiglöhnen außerhalb Amerikas von höchster Stelle aus einen Riegel vorschiebt.
c) Warum der gewerkschaftliche Einfluss schwindet
Diese staatstragende „Zuarbeit“ zum Erfolg der amerikanischen Konkurrenzgesellschaft wird den Gewerkschaften zu ihrer Verwunderung nicht gedankt. Schon seit einigen Jahren werden die Gewerkschaften in den USA aus der Zuständigkeit für Arbeits- und Sozialverträge immer mehr ausgemischt.[17] Der Dachverband registriert dies so, als wären seine Mitgliedsgewerkschaften überhaupt nicht vor Ort dabei gewesen:
„Die amerikanische Mittelklasse ist in Gefahr – dies beweist die wachsende Zahl privater Insolvenzen, ein bisher ungekanntes Niveau privater Verschuldung und eine wachsende Unsicherheit des Arbeitsplatzes. Zugleich zerreißt das soziale Sicherheitsnetz: Sowohl auf der staatlichen Ebene, wo die letzte Haushaltsvorlage der Regierung Bush abermals Kürzungen in entscheidenden Sozialprogrammen vorsieht; als auch im privaten Sektor, wo Arbeitgeber sich immer mehr aus der Vorsorge für Gesundheit und Alter zurückziehen und immer seltener Löhne zahlen, mit denen eine Familie über die Runden kommen kann.“ (www.afl-cio.org)[18]
Der Angriff, den Kapital und Staat in den USA seit einiger Zeit auf den Lebensunterhalt der Arbeiter fahren, führt auch dort nicht zu einer Stärkung der Organisationen, die die Sicherung des Lebensstandards als ihren ausdrücklichen Zweck verkünden, sondern ganz im Gegenteil zu deren Schwächung: Landesweit ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad mittlerweile unter 10% gesunken. Das hat mehrere Gründe.
- Der
private sector
hat es sich noch nie nehmen lassen, dem gewerkschaftlichen Einfluss wo immer möglich einen Riegel vorzuschieben. Das Prozedere, mit dem der Staat die Zulassung einer Gewerkschaft im Betrieb geregelt hat, eröffnet dem Kapital schon jede Menge Möglichkeiten, es gleich gar nicht zu einer gewerkschaftlichen Vertretung im Betrieb kommen zu lassen. Darüber hinaus ziehen amerikanische Betriebe alle erdenklichen Register, wenn sie beschlossen haben, eine einmal etablierte gewerkschaftliche Vertretung wieder loszuwerden –union busting
[19] heißt das dann: Von der Einschaltung spezialisierter Anwälte über eindeutige Werbekampagnen in Sachen Arbeitsplatzsicherheit bis hin zur ‚Bestechung‘ der Belegschaft mit Sozialleistungen, damit Gewerkschaften außen vor bleiben. Vorzeigeunternehmen für letztere Strategie ist WalMart, Amerikas größter ‚non-union‘-Arbeitgeber. Mit einem freiwilligen Krankenversicherungsprogramm für seine 1,3 Mill. Beschäftigten legt es WalMart richtiggehend auf die Demonstration an, dass ein „working America“ ganz ohne Gewerkschaften viel amerikanischer ist. Dass das Programm deftige Zuzahlungen vom Lohn einschließt und nur eine rudimentäre Grundversorgung abdeckt, tut diesem Beweiszweck insofern keinen Abbruch, als es mit einer handfesten Drohung gepaart ist: Wer sich gewerkschaftlich betätigt, setzt seinen Versicherungsschutz aufs Spiel. Also, so die bestechende Logik von WalMart, sind Gewerkschaften eher schädlich, wenn man als Arbeiter in der Konkurrenz zurecht kommen will. - Der Staat sorgt nicht nur mit seiner Arbeitsbehörde dafür, dass die betriebliche Zulassung von Gewerkschaften eine Frage des Kräfteverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit ist und bleibt. Seit Reagan kommen verstärkt Vorschriften aus Gewerkschaftsgesetzen zur Anwendung, mit denen der Staat aus seinen Erwägungen heraus die Macht der Gewerkschaften beschneidet und deren Einsatz kriminalisiert.[20] Dies betrifft erstens national unerwünschte Streiks: Also solche, die nach staatlichem Beschluss „die nationale Gesundheit oder Sicherheit gefährden“. So hat Reagan damals mit seinem Einspruch nicht nur einen Streik der Fluglotsengewerkschaft PATCO verhindert; die Streikführer wurden als Verbrecher behandelt, die Streikenden entlassen, die Streikkasse beschlagnahmt, der Gewerkschaft der Status des Tarifvertragspartners aberkannt. Auch nach Reagan sind solche Aktionen keine Seltenheit geblieben, wie z.B. Ende 2001 das Verbot eines Streiks von Mechanikern bei United Airlines, oder 2002 die Zerschlagung des Streiks der Longshoremen (Hafenarbeiter) in Oakland CA, weil sie – so die staatliche Begründung – die militärische Logistik für den Aufmarsch im Irak-Krieg „behindert“ hätten. Seit „9/11“ wirft der Staat zweitens noch ein ganz anderes Auge auf den gewerkschaftlichen Selbstbehauptungskampf: Mit dem
Homeland Security Act
wurden neue gesetzliche Schranken für gewerkschaftliche Betätigung geschaffen. So wurde z.B. den „Screeners“, die auf den Flughäfen des Landes Gepäckstücke durchleuchten, Anfang 2003 jegliches Recht untersagt, überhaupt Tarifverhandlungen zu führen; mit einem neuenTransportation Security Act
wurden diese Beschäftigten zudem direkt einer Bundesbehörde unterstellt – da hilft es dem AFL-CIO und seinen Einzelgewerkschaften überhaupt nichts, dass sie überwiegend linientreu hinter dem „Krieg gegen den Terrorismus“ stehen. Mit der gewaltsamen Zerschlagung von Streiks mitsamt der sie organisierenden Gewerkschaft liefert der Staat nämlich ganz nebenbei noch eine Klarstellung ab: Bei welcher „Seite“ im Kampf zwischen Kapital und Arbeit er die Wahrnehmung nationaler Sicherheitsinteressen gut aufgehoben sieht. Allemal sind es nach dem sehr parteilichen staatlichem Befund die Gewerkschaften, die mit ihrem Abwehrkampf gegen Lohnsenkungen den „sozialen Frieden“ stören,[21] auf den es dem Staat ankommt. So „beweist“ die politische Gewalt mit ihrem gewaltsamen Eingreifen also auch die letztliche Ohnmacht der Gewerkschaften in der Frage, welcher Klasse die Macht über Arbeits- und Lebensbedingungen im freien Amerika zusteht.
Gegen die Angriffe des Kapitals und der politischen Gewalt verteidigen sich Gewerkschaften auf ihre Weise. Wo noch ein nennenswertes Vertretungspotenzial übrig geblieben ist, wie z.B. in der Autoindustrie, beweisen sie mit kreativem „concession bargaining“ ihre Verantwortung für das Überleben „ihrer“ Firma. Mit dieser Strategie „kämpfen“ sie darum, sich ihr erworbenes Recht auf Vertretung der jeweiligen Belegschaften überhaupt zu sichern – und tun damit das Ihre dazu, dass ihren Mitgliedern jeder Grund dafür abhanden kommt, sich weiter für eine gewerkschaftliche Vertretung stark zu machen. Auch deswegen sieht es so aus, dass die WalMart-Strategie recht behält.
d) Wie die Gewerkschaften auf ihre Ausmischung reagieren: Sie spalten sich
Die Gewerkschaft bilanziert die Angriffe von Kapital und Staat als Misserfolg ihrer Bemühungen, ihrer potentiellen Klientel ausreichend Gründe dafür zu liefern, sich bei ihr als Mitgliedschaft einzufinden. Ihre Basis schwindet – und damit, so ihr Befund, auch ihre Fähigkeit, im Betrieb und gegenüber dem Staat noch irgendwie Eindruck zu machen. Was zu tun ist, um diese schwindende Basis eines Besseren zu belehren – darin sind sich die Gewerkschaften uneinig; an dieser Frage hat sich die Gewerkschaftsorganisation neulich gespalten. Seit September 2005 gibt es zwei Dachverbände in der amerikanischen Gewerkschaftslandschaft, die sich die nationale Repräsentation des „union advantage“ streitig machen. Beide wollen dasselbe: Dem amerikanischen Traum vom Erfolg auch und gerade für das Proletariat eine erfolgreiche Agentur anbieten.
Der neue Gewerkschaftszusammenschluss der Abtrünnigen nennt sich CTW: „Change to Win“-Koalition; ihr neues Programm heißt programmatisch: „Restoring the American Dream“. Dieser Verein hat mittlerweile mehr als 40% der ehemaligen AFL-CIO-Mitglieder um sich geschart. Er wirft dem alten Dachverband vor, zu wenig für das dringend benötigte Mitgliederwachstum getan zu haben. Als Grund für den zunehmend sinkenden Einfluss der Gewerkschaften auf Löhne und Arbeitsbedingungen sieht die neue „coalition“ den Umstand, dass sie durch Konkurrenz ihre eigene Fähigkeit schwächt, überhaupt gegen das Kapital Verträge zu erzwingen, und deshalb auch immer weniger Mitglieder rekrutiert. Damit die Gewerkschaft sich wieder besser aufstellen kann, um dann auch wieder mehr beim Staat zu sagen zu haben, fordert sie:
„Alle Gewerkschaften sollten für gemeinsame, nicht konkurrierende Anliegen zusammenarbeiten. Alle Gewerkschaftsmitglieder, die es mit dem selben Arbeitgeber zu tun haben oder in der gleichen Branche oder dem gleichen Sektor arbeiten – egal, in welcher Gewerkschaft sie organisiert sind –, sollten ihre Macht vereinen, um bessere Verträge und bessere staatliche Gesetzgebung zu erkämpfen.“
Die verbliebene alte Hälfte (AFL-CIO) sieht die Sache genau umgekehrt. Ihr neues Programm mit dem Titel „Stärkung unserer Gewerkschaftsbewegung für die Zukunft“, das sie sich anlässlich der Spaltung gegeben hat, gibt dem schwindenden Einfluss der Gewerkschaften in Washington die Schuld daran, dass gewerkschaftliche Anliegen inzwischen insgesamt im Lande so wenig zählen. Sie loben die Anstrengungen, die sie im letzten Präsidentschaftswahlkampf unternommen haben, als probaten Weg zur Stärkung der Gewerkschaftsbewegung:
„Wir haben uns bemüht, aus der Solidarität und Kraft der Wahlkampagne von 2004 das Beste zu machen und die Schritte einzuleiten, die nötig sind, damit die Gewerkschaftsbewegung wachsen kann.“
Die Niederlagen, die Kapital und Staat ihnen bescheren, lassen bei amerikanischen Gewerkschaftern also nicht den leisesten Zweifel an ihrem Projekt aufkommen, Lohnarbeitern den Dienst am Kapital als erfolgreiches Lebensprogramm hinzuorganisieren. Sie definieren ihren Misserfolg konsequent als Organisationsproblem – und das nehmen sie so ernst, dass sie sich darüber glatt in zwei Teile spalten. Das übergeordnete Vereinsleben im Dachverband hat die lebhafte Konkurrenz zwischen den Einzelgewerkschaften eben noch nie aufgehoben, sondern nur fortgesetzt. Und jetzt sortieren sich auch noch konkurrierende Dachverbände haargenau nach den Prinzipien, nach denen die „local“-Gewerkschaften immer schon gearbeitet, und an denen sie ihren Dachverband gemessen haben: Wie gewichten wir unsere schlagkräftigsten Waffen? Lieber mehr „von oben“ die Einheit über alle Gegensätze hinweg sichern und durch erfolgreichere Lobbyarbeit die Bedingungen dafür schaffen, dass mehr Basis rekrutiert werden kann? Oder besser: Mit mehr erfolgreicher Arbeit von unten
Mitglieder rekrutieren, um dann auch die Lobbyarbeit erfolgreicher zu machen? Das soll der amerikanische Prolet bei seinem ohnehin schwierigen „pursuit of happiness“ jetzt auch noch entscheiden …
III. Sozialreform, the American way
1. Der Rückzug des Kapitals aus der Abteilung Soziales erzeugt die wachsende Verarmung derer, die auf solche Kassen angewiesen sind
Wie weitgehend das Sozialsystem in den USA auf betrieblich eingerichteten Kassen beruht – seien sie nun gewerkschaftlich erkämpft oder vom Kapital aus eigenen Berechnungen eingerichtet –, wird spätestens dann deutlich, wenn die Unternehmen anfangen, ihre Renten- und Gesundheitskassen radikal abzubauen bzw. für die Beschäftigten zu verteuern. Mittlerweile sind die betrieblichen Rentenzahlungen und Krankenversicherungsleistungen anerkannterweise zur schier unerträglichen Belastung fürs Kapital[22] geworden. Und es wird auch gar kein Geheimnis daraus gemacht, woran das liegt:
„Die Autokonzerne, aber auch viele andere Traditionsunternehmen leiden unter den Kosten für die Gesundheit und Altersversorgung ihrer Mitarbeiter und Rentner … Jetzt rächt sich, dass die großen Industriekonzerne ihren gut organisierten Mitarbeitern seit den siebziger Jahren soziale Wohltaten zugestanden haben, die sie sich nicht leisten konnten. Eine gefährliche Allianz von Aktionären und Gewerkschaften sorgte dafür, dass die teuren Versprechen durch riskante Anlagen am Kapitalmarkt finanziert wurden. Als die Börsen vor vier Jahren einbrachen, wurde das Desaster deutlich. Die Renten- und Krankenversicherungen konnten nur noch durch Zuschüsse der Unternehmen finanziert werden … Der Traum von sozialer Sicherheit nach jahrzehntelanger Arbeit ist für viele Familien verflogen.“ (SZ, 19.10.)
Dem nicht ganz ideologisch verbohrten Leser mag es eher scheinen, als ob die Belegschaften solcher „Traditionskonzerne“ sich eine soziale Betreuung nicht leisten können, die nur klappt, wenn Manager beim Zocken am Kapitalmarkt Glück haben. Aber sei’s drum: Immer, wenn das Kapital „leidet“, wenn es gar Rentnern und Kranken gegen jede vernünftige Kapitalrechnung „Zuschüsse“ zahlen muss, weiß es, auf wen es dieses Leiden abwälzen muss – und kann. Anders als die Zahlungsverpflichtungen, denen Unternehmen gegenüber ihren Klassenbrüdern nachzukommen haben, haben die Sozialkosten für die Unternehmen nämlich den unübersehbaren Vorteil, dass man sie loswerden kann. Es handelt sich bei ihnen eben um Lohnkosten: Und bei denen gilt allemal, dass vertragliche Vereinbarungen über sie nur solange Bestand haben, wie sie sich für das Unternehmen rentieren. Wenn die Aufwendungen der Betriebe für das Soziale an Verträge mit den Gewerkschaften gebunden sind – dann müssen diese Verträge eben fallen.[23]
In Sachen Rente konfrontieren die Betriebe ihre Vertragspartner von der Belegschaftsseite mit entsprechenden Forderungen. Für neu Eingestellte werden Leistungen entweder gestrichen oder massiv reduziert; schon pensionierte Betriebsangehörige werden neu zur Kasse gebeten, etwa für Zuzahlungen zur Krankenversicherung; feste Pensionszusagen werden in variable umgewandelt; es werden „freiwillige“ Kassen eingeführt, in denen die Beschäftigten bis zu zwei Drittel der Beiträge selbst zahlen müssen; usw. usf. Andere Unternehmen, wie die großen Fluggesellschaften, machen nach diversen Gehaltskürzungen und Beitragserhöhungen den Übergang dazu, ihre Pensionsverpflichtungen schlicht zu streichen. Das Gleiche bei den Krankenkassen: Mitversicherten Familienmitgliedern wird der Krankenversicherungsschutz gestrichen; der Fortbestand betrieblicher Versicherungen wird von Zuzahlungen und Leistungskürzung abhängig gemacht; usw. – so dass es immer fraglicher wird, ob und in welchem Umfang die Betriebsversicherungen Schadensfälle überhaupt noch regulieren. So fallen immer neue Teile der Arbeiterschaft aus jeder Krankenversicherung heraus. Seit den Tarifverträgen von 2004 ist bei den großen Autokonzernen auch die 10-jährige Arbeitsplatzgarantie vom Tisch. So macht das Kapital den Gesamtlohn dafür haftbar, ob die Rechnungen des Unternehmens mit den Sozialkassen als Kapitalanlage aufgehen; zugleich sorgt es mit Rationalisierungen und Entlassungen dafür, dass die betrieblich gezahlte Lohnsumme, die in die Kassen fließt, ständig sinkt.[24] Das Ganze läuft auf dem üblichen Wege ab: Über Streiks, Verhandlungen und „schweren Herzens“ eingegangene „Kompromisse“. Die laufen alle auf dasselbe hinaus: Gewerkschaften bzw. Belegschaftsvertreter können stolz sein, wenn es ihnen gelingt, die betrieblichen Sozialleistungen überhaupt zu retten; das Kapital lässt sich jedes Zugeständnis mit Lohnsenkungen bezahlen.
Besonders schnörkellos gestaltet sich die Sache im Falle von Insolvenz. Wenn die Firma zahlungsunfähig ist, entfallen ihre Zahlungsverpflichtungen an die Kassen, aus denen die Rentner und Kranken alimentiert werden. Deshalb nutzen nicht wenige Unternehmen die Anmeldung eines Insolvenzverfahrens, um ihre diesbezüglichen Verpflichtungen los zu werden. In bewährter Manier stellen sie ihre gewerkschaftlichen Vertragspartner vor die Alternative, sich entweder an der totalen Pleite der Firma mit schuldig zu machen oder radikal abgesenkten Löhnen und Sozialleistungen ihr Plazet zu geben. Zuletzt geschehen beim Auto-Zulieferer Delphi:
„Der angeschlagene amerikanische Automobilzulieferer Delphi Corporation kann seine Pensionszusagen auf Dauer nur dann erfüllen, wenn die Beschäftigten künftig für ein Drittel ihres bisherigen Lohns und der Sozialleistungen arbeiten… Nur durch eine erhebliche Verringerung der Lohnkosten ließen sich ausreichend Gewinne erwirtschaften, um die bestehende Lücke zwischen Pensionsverpflichtungen und dem vorhandenen Vermögen in Höhe von rund 5 Mrd. $ zu schließen. Delphi hat Gläubigerschutz nach Kap 11 des amerikanischen Insolvenzrechts beantragt. Zuvor hatte es die Gewerkschaft der Automobilarbeiter abgelehnt, das Paket aus Lohn und Zusatzleistungen von durchschnittlich 65 $ je Arbeiter in der Stunde auf ca. 18 $ zu verringern.“ (FAS, 12.10.)
So geht die „Senkung der Lohnnebenkosten“ auf amerikanisch: Nicht als groß angelegtes staatliches Programm zum Abbau von Kassenleistungen, sondern als unmittelbare Streichung von Lohnbestandteilen durch das Kapital. Die Wirkung ist einerseits die gleiche wie hier: Die Leute werden immer ärmer und immer weniger fähig, auch noch „aus eigener Kraft“ irgendwelche „Vorsorge“ zu treffen. Andererseits eine andere: Die Leute fallen auf das zurück, was der Staat ihnen in Aussicht stellt, und das war zum Überleben nie gedacht. Der Staat reagiert – entsprechend.
2. Der staatliche Reformbedarf …
Am Zustand des Sozialwesens wird laufend Kritik geübt. Die Betroffenen stimmen dann, wenn sie mal gefragt werden, das passende Lamento an[25] – das war’s dann aber auch. Und auch Gewerkschafter finden immer wieder Gelegenheit, die von ihnen mit herbeiverhandelte Lage als gesellschaftlichen Missstand anzuprangern. Die einzige Kritik am Sozialsystem, die praktisch wird, ist allerdings die des Veranstalters der ganzen Chose. Den Staat kosten die Kassen, aus denen er Alte und Kranke alimentiert, immer schon zu viel und leisten zu wenig – gemessen an dem anspruchsvollen Maßstab, dass sie nur kompensatorisch tätig werden, dem strebsamen Lohnarbeiter in seinem Bemühen um Bewältigung seiner Lebensumstände unter die Arme greifen sollen. Das gilt erst recht, wenn der Staat feststellt, dass immer mehr Leute aus alten Sicherungssystemen herausfallen, weil es die schlicht nicht mehr gibt. Ein Weg, diese Lage zu bewältigen, kommt schließlich nicht in Frage: Dass die politische Gewalt sich zu der Notwendigkeit bekennt, mit eigenen Zahlungen einzuspringen, wo das Kapital sich aus der Organisation sozialer Lohnbestandteile verabschiedet. Umgekehrt: Dass der Staat sich genötigt sieht, in gewissem Ausmaß einzuspringen – wie etwa jüngst bei ‚Medicare‘ –, ist der ganze Missstand, dem es beizukommen gilt.
- Die staatlichen Ausgaben für Gesundheit sind zu hoch. ‚Medicare‘ und ‚Medicaid‘ machen zusammen inzwischen ca. 20% des nationalen Haushalts aus; schon das ist ein eigentlich nicht hinnehmbarer Skandal.[26] Zugleich entdeckt jede neue Regierung mit regelmäßiger Sicherheit ein „coverage gap“, also eine Unterversorgung sowohl der arbeitenden wie der Gesamtbevölkerung mit Krankenversicherung. Gegen beide Missstände gilt es, etwas zu tun. Was dann zu tun ist, bemisst sich daran, dass einerseits dem Kapital auf keinen Fall irgendwelche geschäftswidrigen Rücksichtnahmen auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter aufgenötigt werden dürfen, andererseits dem Staat nicht noch weitere Kosten entstehen sollen. Das Prinzip bisheriger Reformmaßnahmen bestand deshalb darin, mit immer neuen „Anreizen“ für die Kalkulationen des Kapitals dessen Willen zu befördern, eine halbwegs verlässliche und gleichzeitig bezahlbare medizinische Versorgung wenigstens der Leute zu organisieren, die arbeiten. Bisher am weitesten ging das Projekt eines „Health Security System“ unter Clinton: Darin sollten sich vor allem Klein- und Mittelbetriebe, die in größtem Umfang das Krankenversicherungswesen abbauen, zusammenschließen und überbetriebliche Gruppenverträge mit Krankenversicherungen abschließen („health alliances“) – wie bei den großen Konzernen unter bundesstaatlichen Rahmenrichtlinien, einzelstaatlicher Aufsicht und ausgeweiteten Steuererleichterungen. Der Plan scheiterte im Gesetzgebungsverfahren wegen des ungeheuerlichen Eingriffs in die unternehmerische Entscheidungsfreiheit.
- Auch die Rentenkasse muss sich schon immer den kritischen Blick des Staates gefallen lassen – schon deshalb, weil sie eine gewichtige Abteilung im amerikanischen Staatshaushalt ausmacht. Seit ihrer Einrichtung verfügt die Rentenkasse über einen beträchtlichen Überschuss, aus dem sich der Staat ganz selbstverständlich für seinen Haushaltsausgleich bedient. Auf der Grundlage ist er immerzu damit beschäftigt, die „Finanzierbarkeit“ der Renten zu sichern. Die Beiträge wurden schrittweise von ursprünglich 2% auf aktuell 12,4% der Lohnsumme angehoben; 1983 wurde aus dem Beitragsaufkommen ein „trust fund“ als Rücklage für später wachsende ausstehende Auszahlungen eingerichtet; zeitgleich wurde eine Rentenbesteuerung eingeführt, deren Einnahmen der Rentenkasse gutgeschrieben werden, und die gesetzliche Erweiterung des pflichtversicherten Personenkreises beschlossen. Zudem wurde das Renteneintrittsalter für die nach 1959 Geborenen von 65 auf 67 angehoben… Mittlerweile diagnostiziert der Staat einen prinzipiellen Webfehler an seiner Rentenkasse: Wenn große Teile der Rentner nur noch von den staatlichen Rentenzahlungen leben und die Rentner gleichzeitig noch anderen Sozialstaatsabteilungen zur Last fallen – dann ist etwas schief gelaufen mit dem Prinzip der Selbstverantwortung, dem die Kasse doch auf die Beine helfen sollte.
So wird die politische Gewalt wieder einmal gegenüber ihrem eigenen Sozialwesen fundamentalistisch. Angesichts des Umstands, dass immer mehr normale Amerikaner ohne staatliche Sozialleistungen nicht mehr über die Runden kommen, lassen die obersten Amtsinhaber selbstkritisch verlauten, der Staat habe sich überhaupt in unamerikanischer Weise in die soziale Betreuung des Proletariats eingemischt. Damit, so die in dieser Frage aktuell wieder einmal herrschende Meinung in den USA, habe der Staat gegen den Geist der Selbstverantwortung verstoßen, der doch das Weiß-Warum jedes amerikanischen Bürgers ausmacht und auszumachen hat. Wenn die Regierung also nun beschließt, die Verantwortung für die eigene soziale Lage an ihre Bürger zurückzureichen – dann geht es ihr nicht um so schnöde Ziele wie die bloße Entlastung der Staatskasse von den sozialen Kosten der Lohnarbeit; dann geht es ihr darum, diesen Geist wieder zu beleben. In den Worten des Präsidenten:
„Je mehr Eigentumsbildung es in Amerika gibt, umso mehr Lebenskraft gibt es in Amerika, umso mehr Leute haben existenziellen Anteil an der Zukunft dieses Landes.“ [27]
So lautet das Bush-Programm namens „ownership society“, die der Präsident mit der grundsätzlichen Reform der Rentenkasse auf den Weg bringen will.
3. … und seine aktuelle Zuspitzung: Die „Ownership Society“ als Reformprojekt der Rentenkasse
Aufgrund von Hochrechnungen, dass die Überschüsse irgendwann einmal ganz in Rentenauszahlungen zu fließen drohen, hat die Regierung Bush den nahenden „Bankrott“ der staatlichen Rentenversicherung ausgerufen:
„Sie sollten sich vor Augen führen, dass Ihr Rentensystem einfach bankrott sein wird, wenn die Vereinigten Staaten jetzt nicht handeln“ (Bush auf seiner 60-Tage-Tour durchs Land in dieser Sache; Die Zeit 13/05).[28]
Als Grund dafür will sie ausgemacht haben, dass die Bürger die „Kontrolle“ über ihr „Eigentum“ – sprich ihre Ansprüche an die ‚Social-Security-Kasse‘ an „Regierungs- und Gesundheitsbürokraten“ (Bush) verloren hätten. Die „Rückgabe“ dieses „Eigentums“ an seine rechtmäßigen Besitzer soll zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Reform soll nicht nur den Bankrott aus der Welt schaffen; sie soll zugleich die eigentlichen Eigentümer der Rentengelder zum selbstverantwortlichen Umgang mit den Vorsorgegeldern befreien. So einfach geht es, den Zwang zur Vorsorge, der aus der materiellen Not der Lohnarbeit kommt, in Freiheit zu verwandeln: Wenn dieser Zwang nicht mehr über das staatliche Eintreiben von Beiträgen und Zuteilen von Auszahlungen ausgeübt wird, sondern jeder selbst entscheiden darf, wie er mit fehlenden Mitteln den Ausgleich schafft zwischen aktuellem und fürs Alter vorhersehbarem Geldmangel – dann ist das kein Zwang mehr, sondern freies Verantworten der eigenen Lebenslage.
Dass das gleiche Geld, das in den Händen der Kasse für die Alimentierung der Rentner nicht reicht, in den Händen der freien Bürger dies allemal zu leisten vermag – das, so die Regierung Bush, geht auch. Noch akkumuliert die Rentenkasse riesige Überschüsse:[29] Und die wären am Kapitalmarkt im Sinne späterer Rentenzahlungen viel besser aufgehoben. Damit, dass der Staat in Sachen Rente die Regie übernommen hat, hat er dieser Sicht der Dinge zufolge in Wahrheit verhindert, dass der normale Ami mit bezahlbarer Altersvorsorge, Krankenversicherung etc. ausgestattet wird. Die Mittel, die der Staat in seinen Sozialkassen angehäuft hat, habe er dem Kapitalmarkt entzogen: Dort angelegt und geschäftlich verwandt, wären sie ein probates Mittel, alle sozialen Probleme des Proletariats zu lösen. In dieser Diagnose lassen sich amerikanische Politiker vom Schicksal diverser im Zuge von Börsenkrächen pleite gegangener Pensionsfonds nicht irre machen – wie auch: Sie wollen ja kein Urteil über den Gang des Geschäfts mit Finanzanlagen abgegeben haben, sondern ein Prinzip verkünden:Wenn schon in der freien Marktwirtschaft alle Einkünfte, bis hin zur popligen Rente und Gesundheitsversorgung für ausgediente Proleten, vom Kapitalwachstum abhängen – dann, so der Standpunkt, kann doch die Sicherung von Renten überhaupt nur dadurch gelingen, dass die Geldmittel für die Vorsorge auch in den Dienst dieses Wachstums gestellt werden.
Die Diagnose definiert die Kur. Nach dem Plan des Präsidenten soll die Rentenkasse dadurch gestärkt werden, dass jüngere Lohnarbeiter zusätzlich zu ihren Rentenkassenbeiträgen über private Rentenversicherungsverträge[30] steuerbegünstigt am Kapitalmarkt „investieren“ und darüber ein Drittel ihrer späteren Rente finanzieren – eine Art amerikanischer Riester-Rente also. Die Rentenbeiträge sollen eingefroren werden; für diejenigen, die schon in Rente sind oder kurz davor stehen, soll sich an der Rentenhöhe nichts ändern. Für die betrieblichen 401(k)-Programme ist vorgesehen, dass Einzahlungen steuerbegünstigt aufgestockt werden können; zudem soll die Übertragbarkeit der Rentenansprüche von einem Betrieb zum anderen erleichtert werden. Ergänzt wird das Ganze durch einen Programmpunkt namens „Ensuring Freedom of Choice“: Wer mindestens 3 Jahre in 401(k)-Pläne eingezahlt hat, soll selbst entscheiden können, in welche Fonds das Geld gesteckt wird. Langfristig soll es darüber hinaus möglich sein, auch einen Teil der gesetzlichen Rentenbeiträge in privaten Rentenversicherungsfonds anzulegen. Und wenn man schon dabei ist, kann man ja schon mal darüber spekulieren, ob der Kapitalmarkt nicht überhaupt die Lösung für alle Fährnisse des Arbeiterdaseins bietet:
‚Lifetime Savings Accounts‘ würden allen Amerikanern die Gelegenheit bieten, steuerfrei zu sparen, um eine Berufs- oder Hochschulausbildung zu bezahlen, die Anzahlung für ein erstes Haus zu leisten, ein Auto für die Fahrt zur Arbeit zu bezahlen oder das Rentenalter zu finanzieren.
(Bush)
Das ganze Projekt kostet den Staatshaushalt erst einmal Einiges. Einzahlungen in die Rentenkasse fallen weg, während Auszahlungen noch zu leisten sind; Steuerausfälle sind zu erwarten… – nach Schätzungen der Regierung summiert sich die Haushaltsbelastung auf zwischen 50 und 200 Mrd. $ über die nächsten 10 Jahre. Deswegen gibt es parteiübergreifend sowie in der politischen Öffentlichkeit über das Projekt Streit. Dass Reformbedarf besteht, steht dabei auf allen Seiten ebenso fest wie die grundlegende Zielsetzung. Gleichzeitig den Staatshaushalt zu entlasten und den aktuellen wie prospektiven Rentnern eine Perspektive selbstverantwortlicher Finanzierung ihres Alters anzubieten, fände natürlich jeder amerikanische Politiker im Prinzip prima. Aber geht das? Wird das nicht zu teuer? Ist das aktuell in der Radikalität, wie von Bush propagiert, überhaupt nötig?[31] Und – auch dieses Bedenken wird laut – begibt sich der Staat nicht mit der Privatisierung der ‚Social Security‘ eines gewichtigen Einnahmepostens, der doch immer für die Mitfinanzierung der sonstigen Staatsausgaben gut war? Diese Einwände gehen bunt durcheinander; immer unter dem Gesichtspunkt, wie denn die staatliche Haushaltslage am besten vereinbar zu machen sei mit dem Umstand, dass die wachsende Altersarmut den Staat nun einmal kostet – so oder so. Und auch der Verdacht darf im politischen Spektrum nicht fehlen: Dass Bush mit seinem ganzen Manöver in Wirklichkeit bloß die hart erarbeiteten Spargroschen anständiger Amerikaner den Finanzgeiern an der Wall Street in die Hände spielen will. Wozu nur zu sagen ist, dass er das erstens in der Tat will, dass es zweitens aber ganz verfehlt ist, diesen Sachverhalt als gemeinwohlschädliche Förderung mächtiger Sonderinteressen, also präsidentielle Pflichtverletzung anzusehen. Die privaten Geldinteressen, die da zugange sind, sind schließlich „die Wirtschaft“ der kapitalistischen Nation USA; in wessen Händen sollten die Rentengelder besser aufgehoben sein? Dennoch: Es kann sein, dass das ganze Projekt in seiner aktuellen Form dann doch noch scheitert. Ein allgemeines Volksgemurmel in Sachen Verschleuderung hart erarbeiteter Rentengelder hat
„zu wachsendem Widerstand in Bushs eigener Partei gegen die Reform geführt. Im nächsten Jahr finden Kongresswahlen statt und die Kandidaten wollen nicht riskieren, von den Wählern abgestraft zu werden, die Angst vor einer Rentenreform haben.“ (SZ, 9.11.)
Da ist also noch Erziehungsarbeit nötig, damit der amerikanische Lohnarbeiter die Angebote und Herausforderungen, die ihm die Politik in Sachen selbstverantwortlicher Lebensführung bietet, auch richtig versteht und mit dem Kreuz an der richtigen Stelle würdigt.
Fazit: Der „hard-working American“ als Leitfigur amerikanischer Sozialpolitik
Der amerikanische Staat lässt sich nicht nachsagen, er müsse der besonderen Reproduktionsquelle Lohnarbeit, die für sich zum Leben nichts taugt, erst durch sozialstaatliche Betreuung zur Tauglichkeit verhelfen. Warum auch: Im kapitalistischsten aller kapitalistischen Länder gibt es nach allgemeinem Dafürhalten keine Arbeiterklasse; keine Abteilung von Leuten, deren Gemeinsamkeit in der Funktion liegt, die sie für den Kapitalreichtum zu erbringen haben; deren Reproduktion also dadurch bestimmt ist, was das Kapital sich rentable Arbeit kosten lässt. Stattdessen gibt es im Land der unbegrenzten Möglichkeiten jede Menge freier, gleicher, nach privatem Glück strebender Bürger, die sich unter durchaus harten Bedingungen durchs Leben kämpfen; manche von ihnen gehen am Fließband oder auf der Werft ihrem ‚pursuit of happiness‘ nach, andere an der Börse oder in der Chefetage. Egal: Wo der „hard-working American“ in der sozialen Hierarchie auch stehen mag, er hat jeden Pfennig, den er besitzt, selbst erarbeitet; er nutzt dazu jede Gelegenheit, die sich bietet, lässt sich nicht davon beeindrucken, dass man dabei des Öfteren auf die Schnauze fällt, und ist stolz auf den Wohlstand, den eigene Arbeit bringt. Solchen Leuten gesteht der Staat seine Sozialleistungen gerne zu: Sie haben jeden Pfennig, den sie vom Staat erhalten, selbst durch ehrliche Arbeit verdient, haben also ein Recht darauf. Schließlich machen sie sich mit ihrem Erfolgsstreben für sich zugleich für die Gemeinschaft nützlich: Das „working America“ ist die feste Basis, auf der die Nation in ihrer ganzen Macht und Herrlichkeit beruht. Darauf darf man dann als amerikanischer Lohnarbeiter stolz sein: Auf die eigene Arbeit, den eigenen Erfolg – und die Wertschätzung, die beides im Selbstbild der Nation genießt.
Nachtrag I Die Verwaltung des Elends Welfare: Un-American contributions for losers
Wer Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika sein will, der muss sich aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln, als Tellerwäscher oder Börsenspekulant, auf jeden Fall mit zupackendem Einsatz seines Geld-, Arbeits- oder sonstigen Vermögens durchs Leben schlagen. Der Grundsatz gilt im Allgemeinen wie im Reich der ‚social security‘ im Besonderen. Eine Ausnahme macht der amerikanische Wohlfahrtsstaat bei eindeutiger ‚disability‘: Erwerbsunfähige im Sinne bundeseinheitlicher Rahmenrichtlinien und einzelstaatlicher Sonderregelungen bekommen eine dementsprechend festgelegte Rente.[32] Wer jedoch über ein Minimum an einsatzfähiger Arbeitskraft verfügt, der hat als Amerikaner auch das Zeug dazu, sich einen anständigen Lebensunterhalt zu erkämpfen. Über Leute, die das partout nicht hinkriegen, ist damit im Prinzip bereits das Urteil gefällt: Anständige Amerikaner in dem Sinn sind das nicht. Ein großer Teil liefert auch prompt den praktischen Beweis, lässt sich bei einer Straftat erwischen und landet in der Abteilung des sozialen Netzes, die von einer umfänglichen, nach ihrer teilweisen Privatisierung kräftig aufblühenden Gefängnisindustrie geknüpft wird.[33]
1. Die Familie: Ordnungseinrichtung im staatlichen Auftrag
In einer Hinsicht geht die Rechnung allerdings für die Staatsgewalt selber, die sie anstellt und durchexerziert, doch nicht auf. In welcher, das hat der Gesetzgeber im ‚Social Security Act‘ von 1935 gleich mit der Benennung einer speziellen zusätzlichen Fürsorge-Institution programmatisch klargestellt: Für nötig hält er AFDC, ‚Aid for Families with Dependent Children‘. Definitionsgemäß können die abhängigen Kleinen wirklich noch nicht für sich selber sorgen; ihnen soll auch nicht angelastet werden, wenn bzw. dass ihre Erzeuger es an ‚selbstverantwortlicher Lebensführung‘ fehlen lassen. Durch deren Elend und drohende Verwahrlosung findet Amerikas sozialpolitisches Herz sich also herausgefordert, echte Nothilfe zu leisten.
Das tut der Staat in Respekt vor der Institution, die er überhaupt ganz grundsätzlich als ökonomische und sittliche Grundeinheit seiner Gesellschaft schätzt, als vom Bürger selbst geschaffenes Miniatur-Gemeinwesen, als den praktizierten Gemeinsinn des Konkurrenzgeiers, wie der ökonomische ‚American way of life‘ ihn fordert: Die Familie ist aus Sicht des Souveräns, der über eine kapitalistische Klassengesellschaft gebietet, die leibhaftige Pflicht, der moralische Sachzwang und zugleich der schönste und natürlichste, persönlichste und zwingendste Beweggrund, sich als ‚hard working American‘ zu bewähren, im unerbittlichen bürgerlichen Lebenskampf, dem gesellschaftlichen Biotop des echten US-Bürgers, zur Hochform aufzulaufen und notfalls auch für die Heimat des eigenen familiären Lebensglücks und der ‚dependent children‘ den Helden zu machen. Diese ‚family values‘ halten die politisch Verantwortlichen auch da in Ehren, wo der eigentlich haftbare Chef der Keimzelle gestorben oder im Gefängnis gelandet ist, sich auf irgendeine andere Art aus dem Staub gemacht hat oder ein hoffnungsloser Versager ist. Auch in so desolater Lage soll immer noch die Familie als Überlebenseinheit und sittliche Anstalt ihren Dienst tun: Die noch greifbaren Elternteile sollen sich besinnen und zusammenreißen, sich im Interesse der Ihren wieder oder überhaupt in den gesellschaftlichen Konkurrenzkampf einklinken und so durch ihr praktisches Vorbild den Kleinen beibringen, wie im ‚Land der Freien‘ selbstverantwortliche Lebensführung geht. Dafür langt es, zumal in ökonomischen Krisenzeiten, allerdings nicht, jeden irgendwie Arbeitsfähigen dem produktiven Sachzwang des Elends auszusetzen: Zu der Einsicht hat sich die mitfühlendste Regierung, die die USA je hatten, angesichts eines explosionsartig gewachsenen Pauperismus durchgerungen und ein Betreuungswesen organisiert, das Geldzuwendungen einschließt, um verelendete Familienmenschen zu einem sittlichen Familienleben zu befähigen. Daran hält die amerikanische Sozialpolitik im Prinzip bis heute fest.
Seit jeher hat sie mit ihrer – finanziell eher knapp bemessenen – Großzügigkeit allerdings auch ein grundsätzliches Problem: Die Unterstützungszahlungen bieten keine Gewähr, dass sie die unterstützten Familien als selbsttragende sittliche Versorgungsanstalten so flott machen wie beabsichtigt. Weder bewähren sich die Erziehungsberechtigten zuverlässig als Garanten eines anständigen Lebenswandels ihrer ‚ghetto kids‘,[34] noch gelingt den Erwachsenen selber im erwünschten Umfang der Start in eine neue Konkurrenzkarriere mit Erfolgen, die eine weitere Unterstützung überflüssig machen würden. Insofern verfehlt die organisierte ‚Welfare‘ ihr Ziel – als dauerhafter Ersatz für einen erfolgreichen Lebenskampf um familiäre Selbstversorgung, diesen einzigen dem US-Bürger gemäßen ‚way of life‘, sind die staatlichen Geldgeschenke ein für allemal nicht gemeint. Wer sie in Anspruch nimmt, für längere Zeit womöglich, der zieht daher das wache Misstrauen der Behörden auf sich, hier mache es sich mal wieder jemand in der sozialen Hängematte bequem und damit einer Missachtung der Grundregeln des ‚fair play‘ schuldig. Unweigerlich kommt der Verdacht auf, ‚Welfare‘-Empfänger hätten sich Kinder überhaupt nur zugelegt, um in den Genuss von AFDC-Zahlungen zu kommen; die Sozialpolitik hätte sich insofern ihre verelendete Klientel durch deren ganz unamerikanische Alimentierung letztlich selber geschaffen. Dem Anwachsen ihrer Kundschaft entnehmen die ‚Welfare‘-Politiker daher im Wesentlichen den Fingerzeig, dass sie es den Armen zu leicht machen, arm zu sein. In der Richtung suchen sie dann nach Abhilfe.
2. Das Rassenproblem und seine soziale Bewältigung: Pauperismus ohne Diskriminierung
Bei der kritischen Besichtigung des nationalen Pauperismus stoßen amerikanische Sozialpolitiker auf den Befund – und wenn nicht von selber, dann werden sie von farbigen oder auch nicht-farbigen Bürgerrechtlern immer wieder einmal darauf gestoßen –, dass anderthalb Jahrhunderte nach der gewaltsamen Sklaven-Befreiung „von oben“ und Jahrzehnte nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Rassentrennung und für eine wirkliche rechtliche Gleichstellung der farbigen US-Bürger mit der farblosen Mehrheit die Masse der ‚Welfare‘-Klientel von dunkler Hautfarbe ist. Das gibt ihnen zu denken.
Keine Beachtung – um das vorweg zu sagen – findet dabei der politökonomische Grund eines ebenso massenhaften wie dauerhaften Bestands an Leuten, die es schlicht nicht schaffen, im bürgerlichen Konkurrenzkampf um Jobs und Geld mitzuhalten oder überhaupt mitzumachen. Dass die kapitalistische Wirtschaftsweise für einen beträchtlichen Prozentsatz der nationalen Bevölkerung keine Verwendung hat, relative Übervölkerung des Landes zu den notwendigen Wirkungen dieses ur-amerikanischen ‚pursuit of happiness‘ gehört: die Einsicht hat keinen Platz im Weltbild der Verantwortlichen. Denen fällt stattdessen die auffällig einseitige Verteilung des Elends unter den einheimischen Rassen auf. Auch dies allerdings schon lange nicht mehr unter dem kritischen Gesichtspunkt, dass hier eine Ungerechtigkeit vorliegen könnte, ein Verstoß gegen die heiligen Grundsätze des ‚fair play‘, der repariert werden müsste. Beschwerden und Forderungen dieser Art haben ihre Zeit gehabt: Zwischen dem Ende des 2. Weltkriegs und dem des Vietnamkriegs haben schwarze Amerikaner in dem stolzen Bewusstsein, ihrem Vaterland als Soldaten tapfer gedient und sich damit dessen uneingeschränkte Anerkennung verdient zu haben, gegen gesetzliche Bestimmungen und gesellschaftliche Sitten aufbegehrt, die ihnen absichtlich oder faktisch den Weg zur ungehinderten Teilnahme am bürgerlichen Lebenskampf versperrten. Damals gingen einige Gruppierungen so weit, im Namen des offiziellen amerikanischen ‚dream that all men are created equal‘ dem Staat USA seinen amerikanischen Charakter abzusprechen und mit Aufkündigung ihrer Loyalität zu drohen. Das hat dieser Staat sich ebenso wenig gefallen lassen wie Übergänge der ‚Black Panther Party‘ zu Klassenkampf-Ideen. Mit vielen Inhaftierten und ein paar Toten hat er für die Klarstellung gesorgt, dass es einen ‚amerikanischen Traum‘ und eine ‚Suche nach dem Glück‘ gegen ihn und außerhalb seiner Zuständigkeit nicht gibt. Bürgerrechtlern, die in diesem Sinne auf ihn gesetzt haben, ist er – nach erheblichen Unruhen und gegen den hinhaltenden Widerstand seiner Südstaaten – entgegengekommen: Den Ruf nach ‚equal rights and opportunities‘ hat er erhört und 1965 mit dem ‚Civil Rights Act‘ beantwortet. Rassische Diskriminierung auf dem freien Arbeits- und Wohnungsmarkt, im Ausbildungsbereich, in der Teilhabe am öffentlichen Leben überhaupt ist seither untersagt und ganz allmählich auch aus der Mode gekommen; Förderprogramme vor allem im Bildungswesen haben die Nation um eine schwarze Elite bereichert. Und es wurde den Bürgern dunkler Hautfarbe landesweit praktisch möglich gemacht und gerichtlich dabei geholfen, einen eventuellen Anspruch auf Unterstützung aus der ‚Welfare‘-Kasse durchzusetzen – mit der interessanten Folge, dass sie nun nicht bloß unter den Gefängnisinsassen und den Todesstrafen-Kandidaten, sondern auch unter den offiziell geführten Paupers weit überproportional vertreten sind. Die durchgesetzte sozialrechtliche Gleichstellung dieses Bevölkerungsteils hat nichts daran geändert, dass er das Hauptkontingent der kapitalistisch erzeugten relativen Übervölkerung der USA stellt; sie hat allein dafür gesorgt, dass sich dieses Verhältnis in der Klientel der nationalen ‚Welfare‘ widerspiegelt.
Das fällt, wie gesagt, den Verantwortlichen auf; und zwar ausgesprochen unangenehm. Die können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie es mit ihrer Familien-Nothilfe einem ganzen, schon längst nicht mehr vom bürgerlichen Konkurrenzkampf ausgeschlossenen Teil ihres Volkes erspart haben, sich um eine bürgerliche Karriere zu bemühen. Nicht nur, aber sehr speziell auf die bürgerrechtlich befriedeten armen Schwarzen richtet sich der Verdacht, sie legten es darauf an, sich per Kindergeld alimentieren zu lassen – die Skandalfigur der dicken schwarzen, von zahllosen Kindern verschiedener Väter umringten, sorgenfrei vor sich hin schlampenden ‚welfare queen‘ dient quasi als Beleg und leibhaftiger Beweis für die Notwendigkeit, ganz ohne neue Rassendiskriminierung das egalitäre System der AFDC-Beihilfen gründlich zu reformieren.
3. Sparen am Pauperismus: Ein Dienst an den Betroffenen
Amerikas Präsidenten führen einen ‚Krieg gegen die Armut‘ nach dem andern, doch die Zahl der ‚Welfare‘-Empfänger will nicht abnehmen, zeigt eher steigende Tendenz. Das schädigt nicht bloß den Staatshaushalt, sondern wirft nach offizieller Auffassung ein schlechtes Licht auf die geistig-moralische Verfassung eines starken Bevölkerungssegments, das sich dem ‚American dream‘ vom Glück durch Konkurrenzerfolg ganz offensichtlich entzieht. Die dauerhaft hohe Kriminalitätsrate, der Verfall ganzer Stadtviertel zu ‚no go zones‘, in denen die Polizei mit quasi militärischem Vorgehen für Ruhe sorgen muss, eine ausufernde verwahrloste Drogenszene bestätigen den traurigen Befund: Die Familienpflege versagt auf ganzer Linie – ordnungs-, sozial-, erziehungs-, finanzpolitisch. Die Staatsmacht kommt nicht umhin zu reagieren.
a) „Ending welfare as we know it“
Im Reformprogramm der Clinton-Administration, das den bezeichnenden Titel ‚Personal Responsibility and Work Opportunity Act‘ trägt, bezichtigt sich der Staat, den bisherigen Misserfolg des Sozialwesens: die zu hohen Kosten, den Sittenverfall und die Verwahrlosung der Leute selbst herbeigeführt zu haben. Indem er überhaupt einen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe gewährt hat, will er zur Unselbstständigkeit der Armen angestiftet und durch seine Hilfe für Familien mit Kindern die gesunde Familie, die eigenständig das Leben meistert, zerstört haben; die armselige Figur des Antragstellers beim Sozialamt hätte ohne die staatliche Armenbetreuung gar nicht erst entstehen können. Diese ‚welfare as we know it‘ abzuschaffen, wird als Maßnahme im wohlverstandenen Eigeninteresse der Betroffenen definiert, als Befreiung von staatlicher Gängelung und Chance, endlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Konsequenterweise verfolgt die Reform der Sozialpolitik das Ziel und misst ihren Erfolg daran, dass die Zahl der Fälle abnimmt, die in den Akten des Sozialamtes geführt werden müssen. Das erreicht der Bundesstaat zum einen einfach dadurch, dass er den bisherigen Rechtsanspruch auf ‚Welfare‘ abschafft. Die neue, auf Zeit gewährte Hilfe für Not leidende Familien (TANF, Temporary Assistance for Needy Families) wird an die Verpflichtung der Familienvorstände geknüpft, sich auf dem Arbeitsmarkt ihren Lebensunterhalt zu beschaffen: ‚Welfare‘ erhalten ‚needy families‘ nur, wenn die Erwachsenen sich täglich im Jobsuchzentrum melden. Innerhalb von zwei Jahren, in denen sie Unterstützung erhalten, müssen sie einen Job finden, ersatzweise an einem Arbeitstraining teilnehmen bzw. gemeinnützige Arbeit leisten. Auf die gesamte Lebenszeit berechnet kann maximal fünf Jahre Sozialhilfe bezogen werden. So kann niemand mehr mit der Not der Kinder argumentieren, um sich berechnend eine eigene Versorgung zu verschaffen. Es gilt – endlich wieder – umgekehrt: Wem es nicht gelingt, sich selbst zu versorgen, der hat die steigende Not seiner Kinder gleich mit zu verantworten.
Zum anderen delegiert der Zentralstaat die Durchführung des Programms an die Einzelstaaten und erteilt ihnen für die Vergabe von Mitteln Auflagen. Sie erhalten Bundesmittel als ‚block grants‘, die je nach Erfüllung der Zielvorgabe, die Zahl der Unterstützungsempfänger zu senken, variieren, also als finanzielle Belohnung bzw. Bestrafung wirken. So werden die Einzelstaaten haushaltstechnisch auf das Kürzungsprogramm verpflichtet. Seit 2002 müssen sie, um weiterhin Bundesmittel zu erhalten, nachweisen, dass 50% der Unterstützungsempfänger auf dem freien Markt einer Arbeit nachgehen oder in offiziellen Arbeitsprogrammen tätig sind. Die Einzelstaaten sind überdies frei, per Erlass die maximale Bezugsdauer auf weniger als 5 Jahre festzulegen; das hat fast die Hälfte der Staaten bereits getan. Sie dürfen Eltern die Unterstützung für ein Kind entziehen, das während der Zeit gezeugt wurde, in der die Familie ‚Welfare‘ bezieht. Etliche Staaten verlangen von den ‚Welfare‘-Empfängern, sich durch ‚personal responsibility‘-Verträge mit der Behörde auf Disziplin und Wohlverhalten am Arbeitsplatz zu verpflichten.
Das Ergebnis: Die Zahl der anerkannten Sozialfälle wurde innerhalb von zwei Jahren von 4,4 Millionen auf 2,5 Millionen gesenkt. Die Begünstigten sind unter Kontrolle, denn sie sind völlig abhängig von dem, was irgendeine regionale Behörde über ihren Fall beschließt. So viel zur Wiederherstellung der ‚personal responsibility‘. Ob der Rest eine Arbeitsgelegenheit gefunden hat, geht den Staat nichts mehr an.
b) Die Runderneuerung der ‚family‘ als ‚last resort‘ gegen den Sittenverfall
‚Strengthening families and work toward independence and self-reliance‘ heißt die Fortführung, die Bush, der Präsident des republikanisch ‚mitfühlenden Konservatismus‘, der von beiden Fraktionen beschlossenen Reform seines demokratischen Amtsvorgängers angedeihen lässt. Diese Reform wird turnusmäßig alle 3 Jahre bei der Budget-Erlass-Verlängerung auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Der Erfolg des fortgesetzten ‚war on poverty‘ wird dabei in dreifacher Hinsicht bilanziert: erstens die erreichte Abnahme der Zahl der Leistungsempfänger; zweitens der Spareffekt; drittens aber auch immer der Beitrag zur gesellschaftlichen Ordnung und die sittlich wohltuende Wirkung auf den Volkskörper, die die Regierung sich von ihren ‚Welfare‘-Ausgaben verspricht. Denn der ordnungspolitische Effekt soll mit dem Einsparen von Geldern nicht entfallen.
Deswegen soll Hilfe, wenn sie schon bewilligt wird, auch ausgezahlt werden. Das war etwas in den Hintergrund getreten, seit man die Einzelstaaten über ihren Haushalt zu Sparfunktionären der Bundesregierung gemacht, ihre Sparerfolge zusätzlich prämiert und damit eine gewisse Kreativität bei ihren Bemühungen um die Sanierung ihrer Haushalte befördert hat – manche überwiesen z.B. die Unterstützung gar nicht oder verspätet, um Zinsen zu sparen. Dieser Umgang soll korrigiert werden. Die Hilfe für die auserwählten Armen, die sich trotz Arbeit nicht erhalten können, wird teilweise sogar erweitert: Damit sie sich in ihren Job ‚reinhängen‘, auch wenn der Lohn nicht einmal von einem Tag auf den andern zum Überleben reicht, können sie statt bisher maximal 7000 $ nun bis zu 16.000 $ erhalten, und für die Bewältigung besonderer Notlagen – wie sollen sie zu ihrer Arbeitsstelle kommen, wo lassen sie die Kinder… – kann es besondere Zuschüsse geben.
Alle diese Maßnahmen sind allerdings, so die Bush-Regierung, im Grunde nichts wert, wenn es bei den Slum- und Mobile-Home-Bewohnern nicht zu einer moralischen Neuausrichtung auf die ‚family values‘ kommt. Die Regierung sieht nämlich einen direkten Zusammenhang zwischen all den Ordnungsproblemen, die sich in den Armutsquartieren häufen, wie Arbeitslosigkeit, Drogen, Jugendgewalt und Kriminalität, und einer falschen Familienstruktur: Die Zunahme dieser Probleme, sagen ihre Sozialstatistiken, geht einher mit dem Anstieg unehelicher Geburten. Der Schlüssel zu einer grundlegenden Besserung der Lage liegt also darin, die gesunde Familie zu fördern. Daher wird das Nothilfe-Programm um die Abteilung ‚Family Composition‘ ergänzt. So wird den Menschen in speziellen Erziehungsveranstaltungen beigebracht, dass man vor der Ehe keusch zu bleiben und die Ehe monogam und dauerhaft zu sein hat; junge Paare ermuntert man durch materielle Anreize zu einer regulären Eheschließung. Teenager mit unehelichen Kindern werden durch die Drohung mit dem Entzug der Sozialhilfe gezwungen, bei ihren Eltern zu wohnen und die Schule zu besuchen. Mit verstärktem Einsatz werden die Erzeuger unehelicher Kinder aufgespürt und – nicht nur moralisch – haftbar gemacht. So arrangiert die reichste Nation der Welt ihre ‚Welfare‘-Familien neu. Die Frage, ob dieses moralische Korsett ihre Elendsbevölkerung wieder stabilisiert, wird die Regierung sich wie gehabt vorlegen und unter Beachtung ihrer Haushaltslage entscheiden.
Nachtrag II Charity: Privat contributions for losers
In der Welt jenseits der ‚endless opportunities‘ gibt es in Amerika eines unübersehbar ‚plenty‘: eine vom Staat sich selbst überlassene Armut. Da trifft es sich gut, dass der Amerikaner, der reiche zumal, ein mitfühlendes Herz hat und dem Schwächeren gerne hilft. Das tut er überhaupt nicht aus schlechtem Gewissen, wie es den sozialgleichmacherisch angehauchten Europäer gelegentlich überkommt und das mit einer Spende befriedigt werden will. Wer in Amerika „es geschafft hat“, der entdeckt in den Bettlern und Bedürftigen – sofern er sie nicht gleich unter die kriminellen Versager rechnen muss – entweder den ‚less fortunate‘, den Nachbarn, den ein Pech aus der Bahn geworfen hat und dem man bis zu einem gelungenen Neustart weiterhilft, oder, je nach dem, einen Angehörigen jenes großen unglücklichen Teils der Menschheit, der aus irgendeinem Grund – noch – nicht angekommen ist in jenem großartigen amerikanischen System, das jedem seine Chance bietet und unweigerlich – die mildtätigen Reichen sind selber der beste Beweis – für Glück und Wohlstand sorgt, wenn man nur selbstbewusst genug mitmischt. An den Segnungen dieses Systems lässt man die Draußengebliebenen und Herausgerutschten ein wenig teilhaben, damit die sehen bzw. mit neuem Mut daran glauben, wie überlegen und wie großartig der ‚American way of life‘ im Allgemeinen ist und der, der ihn erfolgreich geht, im Besonderen.
In diesem Sinne bedankt sich der anständige Amerikaner einmal im Jahr, am 3. Donnerstag im November, in Form eines Truthahn-Essens bei seinem Wirtschaftssystem resp. dessen höchster Erfolgsgarantiebehörde, dem GOtt der USA, dafür, wie weit er es darin und unter SEiner Obhut gebracht hat, und bittet unter Anrufung der Verse 31 bis 40 aus Kap. 25 des Matthäus-Evangeliums[35] ausgesuchte ‚fellow citizens‘ zu Tisch, um den Gast mit Speisen und Bewunderung, sich selbst mit Stolz und Leutseligkeit zu füllen. Bei aller herzlichen Mildtätigkeit weiß er allerdings zu unterscheiden und seine Spenden einzuteilen.
Gute Karten haben Bedürftige, deren Elend in irgendeiner Weise die nationale Ehre befleckt – Ausnahmefälle allesamt, denn grundsätzlich wird die kapitalistisch produzierte Armut nie und nimmer dem herrschenden System angelastet und auch nicht dem Umstand, dass es in all seiner Großartigkeit einmal versagt haben könnte; vielmehr zeugt sie ausschließlich davon, was für ein Unglück es ist, nicht dazuzugehören. Aber Ausnahmen gibt es doch immer wieder; vernachlässigte Kriegsveteranen z.B. – so einen im Stich zu lassen, würde jeder aufrechte US-Bürger als persönliche Schande empfinden. Stellvertretend für seine Nation mag er sich auch keinesfalls Hartherzigkeit gegen unterernährte Kinder nachsagen lassen. Und für Aids-Kranke hat die nationale Prominenz, die sich selbst, wenn nicht gefährdet, so doch kollegial betroffen findet, ein eigenes Netzwerk geknüpft. Paupers dieser Kategorie können darauf hoffen, dass TV-Evangelisten und Talkshow Moderatoren oder auch die Kontaktbörsen der Eliten, die ‚charity parties‘, sich eines ihrer Probleme annehmen.
Um den großen Rest kümmert sich eine Vielzahl professioneller ‚charity‘-Unternehmen. Am bekanntesten innerhalb Amerikas sind die meist konfessionellen Suppenküchen, die mancherorts auch als ‚homeless shelter‘ dienen. Diesen Speisungen kann man Übertreibungen nicht nachsagen; sie werden qualitativ und quantitativ übersichtlich gehalten. Häufig sind sie Verteilstationen von Lebensmitteln, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist; steuersparend und werbewirksam von örtlichen Supermarktketten gespendet. Überhaupt wird darauf geachtet, dass bedeutende Almosen ihren Geber öffentlich in ein gutes Licht rücken; in Angelegenheiten der Mildtätigkeit ist Heuchelei in Amerika unbekannt, Angeberei gute Sitte – wozu sollte es denn auch gut sein, die eigene Wohltätigkeit zu verstecken, wenn sich daraus Nutzen schlagen lässt, ohne dass es dem Empfänger milder Gaben schadet?! Von den mit Spenden bedachten Hilfsorganisationen wird auch keinerlei Selbstlosigkeit oder bescheidenes Auftreten erwartet, sondern Professionalität verlangt – berechnungslose Philanthropie wird eher belächelt und als Grundlage einer soliden ‚charity‘-Arbeit auf jeden Fall für ungeeignet gehalten. Zu ernsthafter ‚charity‘ gehört nämlich nicht zuletzt, dass den Begünstigten scharf auf die Finger geschaut und anständig ins Gewissen geredet wird: Fragwürdige, irgendwie unamerikanische Gestalten sind das ja allemal; da möchte man als Mitglied der anständigen Gesellschaft schon eine gewisse Rückversicherung haben, dass die alten Kleider aus der Garage nicht am Ende einem Schnorrer in die Hände fallen. Die TV-Spendenprofis bauen ein solches ‚screening‘ der Almosenempfänger gerne gleich als Unterhaltungsteil in ihre Bettelshows ein.
Außerhalb Amerikas am bekanntesten ist die Armee Gottes, die ‚Salvation Army‘, die den zweifelhaften Charakter der Armen gleich zu ihrem Missionsgegenstand erkoren hat. Innerhalb der Vereinigten Staaten hat sie sich damit einen bedeutenden Image-Vorsprung vor konkurrierenden Spendensammlern verschafft; sie gilt dort als erster Ansprechpartner für Naturkatastrophenhilfe. Ihre eigentliche Leistung besteht aber darin, dass sie als erste NGO den guten Ruf Amerikas als Heimat eines mildtätigen Imperialismus in über 100 Länder der Welt getragen hat: eine Synthese von helfendem Zugriff und ‚public relations‘, die mittlerweile durch zahllose neue Organisationen perfektioniert worden ist. Die halbe Welt wird von amerikanischen Hilfsagenturen durchzogen, die mit ihrem Einsatz den auswärtigen ‚less fortunate‘ den ‚American way of life‘ als Vorbild und als Inbegriff all ihrer unbefriedigten Sehnsüchte vor Augen stellen. So sind am Ende sogar noch die Paupers der kapitalistischen Weltmacht zu etwas nütze: als Vorbild dafür, wie sich aus dem Elend eine Werbeveranstaltung für die ‚family values‘ und für Amerika als deren Schutzmacht machen lässt.
[1] Bisher sind Artikel zum Thema Sozialstaat für folgende Länder erschienen: Frankreich (in GegenStandpunkt 3-03, S.111), Italien (in GegenStandpunkt 3-04, S.51), Spanien (in GegenStandpunkt 3-04, S.69), Großbritannien (in GegenStandpunkt 1-05, S.107).
[2] America has need of idealism and courage because we have essential work at home – the unfinished work of American freedom … In America’s ideal of freedom, citizens find the dignity and security of economic independence, instead of laboring on the edge of subsistence … We will widen the ownership of homes and businesses, retirement savings and health insurance – preparing our people for the challenges of life in a free society
.
[3] Selbstständige bezahlen die vollen 12,4% Beitragssatz, allerdings nur bis zu einem Höchstverdienst von derzeit $ 90.000,–. Einkünfte oberhalb dieser Grenze sind nicht beitragspflichtig.
[4] Diese Abhängigkeit der normalen Proleten von der staatlichen Rentenzahlung ist die feste Grundlage der guten Meinung des Volkes über diese Kasse: Den Scheck, so heißt es, kann ihnen jedenfalls keiner nehmen. So kann man sich irren.
[5] Dieser staatliche Standpunkt – Verdiente Alte sollen nicht ins Elend fallen – ist die Grundlage für alle im Volk im Umlauf befindlichen Ideologien zur ‚Social Security‘. Kein Ami, der ansonsten jeden Empfänger von noch so trostlosen staatlichen Zuwendungen als Parasiten verdächtigt, der sich seiner Pflicht zum Konkurrieren entziehen will, käme auf die Idee, diesen Vorwurf auf die Rentner anzuwenden: Die haben sich nämlich ihr Recht auf Versicherungsleistungen selbst verdient!
[6] Die Firma General Electric z.B. machte 2001 noch 15% ihres Gewinns mit Anlagegewinnen aus der Pensionskasse.
[7] Diese heißen „401(k)-Pläne“ nach dem entsprechenden Paragrafen des Internal Revenue Code (US-Einkommensteuergesetz)
[8] In den Roosevelt’schen Gesetzesvorlagen zum ‚Social Security Act‘ von 1935 gab es eine „Machbarkeitsstudie“ zur Frage, ob die Krankenversicherung ebenfalls als kollektive Zwangskasse aufzuziehen sei. Auch in der Truman-Ära nach dem zweiten Weltkrieg kamen solche Pläne wieder auf. In beiden Fällen obsiegte bei der Mehrzahl der Politiker in Washington – unter tatkräftiger Lobbyarbeit der AMA (American Medical Association) – die amerikanische Vernunft gegen den Anflug von Sozialismus.
[9] Laut amtlichen Statistiken gehen in den USA mehr als 13% des Bruttosozialprodukts für das Gesundheitswesen drauf, während europäische Länder etwa 9-10% aufwenden. Von den ca. 285 Millionen Amerikanern kommen 55% in den Genuss einer betrieblichen Krankenversicherung, 9% sind privat oder durch das Militär versichert, 10% werden durch ‚Medicaid‘ und 13% durch ‚Medicare‘ erfasst. 13% sind durch keine Krankenversicherung geschützt.
[10] Vgl. GegenStandpunkt 1-04, S.22.
[11] ‚Medicaid‘ ist nur für diejenigen Individuen und Familien mit niedrigem Einkommen zugänglich, die nach bundesstaatlichen bzw. einzelstaatlichen Gesetzen anspruchsberechtigt sind. Je nach den Gesetzen des jeweiligen Einzelstaates muss für einige medizinische Leistungen ein kleiner Teil der Kosten zugezahlt werden. Viele Bevölkerungsgruppen sind von ‚Medicaid‘ erfasst; innerhalb dieser Gruppen müssen für die Anspruchsberechtigung jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden (Alter, Schwangerschaft, Behinderung…); Einkommen und mögliche andere Geldquellen (wie Bankkonten, Immobilien oder andere verkäufliche Dinge) werden überprüft; ebenso, ob man ein US-Bürger ist oder ein legales Aufenthaltsrecht hat. Die Regeln, nach denen Einkommen und andere Geldquellen angerechnet werden, unterscheiden sich von Einzelstaat zu Einzelstaat sowie zwischen den einzelnen Gruppen von Berechtigten.
(www.epi.org).
[12] Die zentralstaatliche Gesetzgebung legt allgemeine Richtlinien sowie einige Mindeststandards fest, an die sich die Einzelstaaten halten müssen.
(www.epi.org).
[13] Der Arbeitslose hat nachzuweisen, dass er „ohne eigenes Verschulden“ seinen Arbeitsplatz verloren hat. Zu den Kriterien für ein mögliches Nichtverschulden gehört z.B. in allen Bundesstaaten seit einigen Jahren der Sachverhalt, dass man entlassen wurde, weil das Produkt, das die Firma herstellt, nun importiert wird. So findet der Standpunkt des Staates, dass Verluste von US-Firmen in der internationalen Konkurrenz nur das Ergebnis unfairen Wettbewerbs sein können, Eingang in die Betreuung der Arbeiterklasse: Als Rechtstitel des Arbeitsmannes, der zum Opfer solch unfairer Konkurrenz geworden ist.
[14] Es hat ziemlich lange gedauert und ist sehr blutig zugegangen, bis sich die politische Gewalt in den USA zu dieser „Einsicht“ durchgerungen hat. Bis in die Jahre der 1. Weltwirtschaftskrise hinein war die erste Antwort des Staates auf jedes Aufbegehren von Proleten, auf jeden Versuch, eine Gegenwehr gegen die ihnen vom Kapital aufgeherrschten Arbeitsbedingungen und Löhne aufzubauen, diese gnadenlos niederzumachen, Streikende niederzuknüppeln und deren Anführer zu erschießen. Auf diese Weise hat der Staat den anarchistischen Arbeitervereinen in den 20er Jahren den Garaus gemacht. Auf der Grundlage erging im Rahmen des „New Deal“ an die staatstreuen Arbeitervereine das Angebot zur konstruktiven Mitarbeit am Wiederaufbau der Nation. In diesem Sinne haben sich die Gewerkschaften in den Kriegsjahren in den entsprechenden Industrien um die materielle Basis des Kriegserfolgs verdient gemacht und damit die Grundlage für die Sorte Gewerkschaftsmacht gelegt, über die sie heute verfügen: „Vor fünfzig Jahren ermöglichte das Prinzip der Partnerschaft es den maßgeblichen Industriegewerkschaften, so etwas wie privatisierte Sozialstaaten (privatized welfare states
) einzurichten: Arbeitsplatzsicherheit, steigende Löhne und anständige Betriebspensionen im Austausch für die Selbstverpflichtung auf die langfristige Profitabilität des Unternehmens.“ (International Socialist Review).
[15] Der National Labor Relations Board ist für die Umsetzung des National Labor Relations Act (NLRA) zuständig, mittels dessen die Arbeitsbeziehungen im privaten Sektor überwacht werden, d.h. die Beziehungen zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und Beschäftigten; sowie die Rechte von Beschäftigten, eine Gewerkschaft zu gründen, einer beizutreten oder sie zu unterstützen, und kollektive Verhandlungen durch von ihnen selbst gewählte Vertreter durchzuführen bzw. von solchen Aktivitäten Abstand zu nehmen. Der NLRB verhandelt Klagen gegen angebliche Verletzungen des NLRA durch Arbeitgeber oder Gewerkschaften. Die Agentur befasst sich weiterhin mit Anträgen, mittels derer eine Gewerkschaft beantragt, Beschäftigte zum Zwecke von kollektiven Verhandlungen zu vertreten; oder Anträge von Belegschaften, die von der sie vertretenen Gewerkschaft nicht mehr vertreten werden wollen.
(www.nlrb.gov).
[16] Prinzipiell kann sich eine Gewerkschaft auch ganz ohne NLRB über den Weg der sog. „voluntary recognition“ eine Vertretungsmacht im Betrieb erkämpfen. Aus naheliegenden Gründen sind „freiwillig“ allerdings die wenigsten gewerkschaftlichen Mitspracherechte zustande gekommen.
[17] Seit Reagan ist der AFL-CIO auch nicht mehr in den Verwaltungsgremien des NLRB vertreten.
[18] Dass die Gewerkschaft sich bei ihrer Beschwerde über sinkende Löhne auf deren Wirkung auf die Familie beruft, ist kein Zufall. Ihr Vorwurf an das amerikanische Unternehmertum lautet, dass es mit seinem privaten Profitinteresse die Grundfesten dessen erschüttert, was jeder gute Ami als das Bollwerk der nationalen Gemeinschaft zu schätzen weiß: Den Zusammenhalt anständiger, arbeitsamer Menschen im Familienverband. So stellt sich die Gewerkschaft selbst vor als die Instanz, der es mit der Verteidigung der „american middle class“ letztendlich nur um das Höchste der nationalen Sittlichkeit geht: Die „family values“. Kapital und Staat sind wenig beeindruckt: Ein Bush sieht die Sache eher so, dass diese „values“ nicht zu Forderungen berechtigen, sondern vielmehr dazu beitragen sollen, dass Lohnarbeiterfamilien auch schwerste Bedingungen als Herausforderung meistern.
[19] Siehe GegenStandpunkt 2-99, S.20: „Union busting“: Ein modernes Dienstleistungsunternehmen bereinigt die letzten Reste gewerkschaftlicher Umtriebigkeit.
[20] Der ‚Taft-Hartley-Act‘ von 1947 war die erste Antwort des Staates auf den Versuch der Gewerkschaften, sich ihre materielle Position über die Kriegszeit hinweg mit Hilfe des „closed shop“ zu sichern: Sie trafen Vereinbarungen mit Unternehmen, dass nur Gewerkschaftsmitglieder einzustellen seien. Den Einzelstaaten wird es freigestellt, das unbeschränkte „right to work“ gesetzlich zu verankern, also das „closed shop“ zu verbieten. Dieses Prinzip ist inzwischen in 20 Einzelstaaten, vor allem im Süden, durchgesetzt. Es bildet die Grundlage für die Strategie der Unternehmen, den gewerkschaftlichen Einfluss durch Verlagerung der Betriebe in „gewerkschaftsfreie“ Staaten bzw. durch entsprechendes „outsourcing“ los zu werden.
[21] Das wissen die Unternehmen natürlich und nutzen es aus: Im Streik der Hafenarbeiter hat die Kapitalseite sich jeder Verhandlung mit der Gewerkschaft verweigert und ihrerseits den Staat aufgefordert, doch endlich die Sache aus nationalen Sicherheitsgründen für sie zu entscheiden.
[22] Ohne die Pensions- und Krankenversicherungsbeiträge würde etwa die Gewinnmarge von GM von mageren 0,5 Prozent auf 5,5 Prozent steigen … Nach Schätzungen der Analysten beträgt der Kostenanteil für die Altlasten bei General Motors pro in den USA produziertem Fahrzeug 1.784 Dollar
(Die Zeit, 10/04).
[23] Dabei versucht das Kapital natürlich auch, bereits eingegangene Zahlungsverpflichtungen rückwirkend zu kürzen; das ist aber rechtlich nur teilweise möglich. Also versuchen die Firmen, bestehende Pensionsverpflichtungen mit allen buchhalterischen Tricks auf die staatliche Pensionsversicherung PBGC abzuwälzen. Diese in den 70er Jahren gegründete Institution soll eigentlich nur in Notfällen einspringen… Doch die massiven Ausfälle… haben dazu geführt, dass die PBGC selbst hart am Rande der Zahlungsunfähigkeit operiert. Um einen Zusammenbruch zu vermeiden, wird über kurz oder lang der amerikanische Steuerzahler einspringen müssen.
(SZ, 9.11.)
[24] Inzwischen kommen z.B. bei General Motors 2,5 aus den betrieblichen Sozialkassen finanzierte Rentner auf einen Beschäftigten.
[25] Etwa so: Bei einer Meinungsumfrage 1993 beklagten sich 90% der Amerikaner darüber, dass die Gesundheitsversorgung zu teuer sei, drei Viertel hielten den Versicherungsschutz für nicht ausreichend, und nahezu die Hälfte war mit der Qualität der Versorgung unzufrieden.
(Aus Politik und Zeitgeschichte 8/96, S.13) Daran wird sich in den letzten 10 Jahren sicher nichts geändert haben.
[26] Schon vor 10 Jahren hieß es: „Die Zunahme des Mitgliederbestandes und der Kostenanstieg (für medizinische Leistungen, d.V.) haben das Medicare-Programm zu einer Belastung des Bundeshaushalts werden lassen.“ (ebd.). Das konnte nur noch schlimmer werden.
[27] The more ownership there is in America, the more vitality there is in America, and the more people have a vital stake in the future of this country.
Bush’s Idee von der ‚Ownership Society‘, in der jeder für die eigene Vorsorge verantwortlich ist, ist das für das 21. Jahrhundert angemessene Gegenstück zu Roosevelts ‚New Deal‘
(WSJ/HB 19.10.04)
[28] Der Übergang zum Zuschussbetrieb soll regierungsoffiziell 2018/19 erfolgen; der Bankrott wird für 2025 vorhergesagt.
[29] In seinem jährlichen Bericht für 2002 hat der Aufsichtsrat der Social Security prognostiziert, dass die Rentenkasse bis 2017 mehr an Beiträgen einnehmen als sie an Zahlungen leisten wird.
(www.epinet.org)
[30] ‚Retirement Savings Accounts (RSAs)‘
[31] Schluss mit der Dramatisierung: Social security ist finanzierbar.
(The Seattle Times, 29.3.)
[32] Dabei werden die Aufwendungen der Einzelstaaten durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt in gleicher Höhe ergänzt.
[33] Einzelne Bundesstaaten gehen hier sozial- und erziehungspolitisch voran und sorgen bei den Verlierern der Nation mit absoluter Unnachsichtigkeit – ‚zero tolerance‘ – und der Androhung völlig unverhältnismäßiger Strafen – ‚3 strikes you’re out‘: lebenslänglich bei der dritten Verurteilung auch bloß für Kleindelikte –, also durch eine Politik der massiven Abschreckung für Sorgfalt bei der Karriereplanung.
[34] Bevor die lieben ‚dependent children‘ der Unterklasse endgültig auf die schiefe Bahn geraten, gibt der Sozialstaat ihnen noch eine Chance: Präventiv auf Antrag von Eltern, die sich anders nicht mehr zu helfen wissen, oder per Beschluss eines Jugendgerichts alternativ zur ersten fälligen Gefängnisstrafe können Kinder und Heranwachsende in ‚boot-camps‘ überstellt werden, wo ihnen mit militärischem Drill die Regeln eingeschliffen werden, deren Beachtung den ordentlichen bürgerlichen Konkurrenzkampf von seiner kriminellen Variante unterscheidet.
[35] Für die andern 364 Tage im Jahr gelten dafür uneingeschränkt und in wörtlichster Auslegung die Verse 14 bis 30.