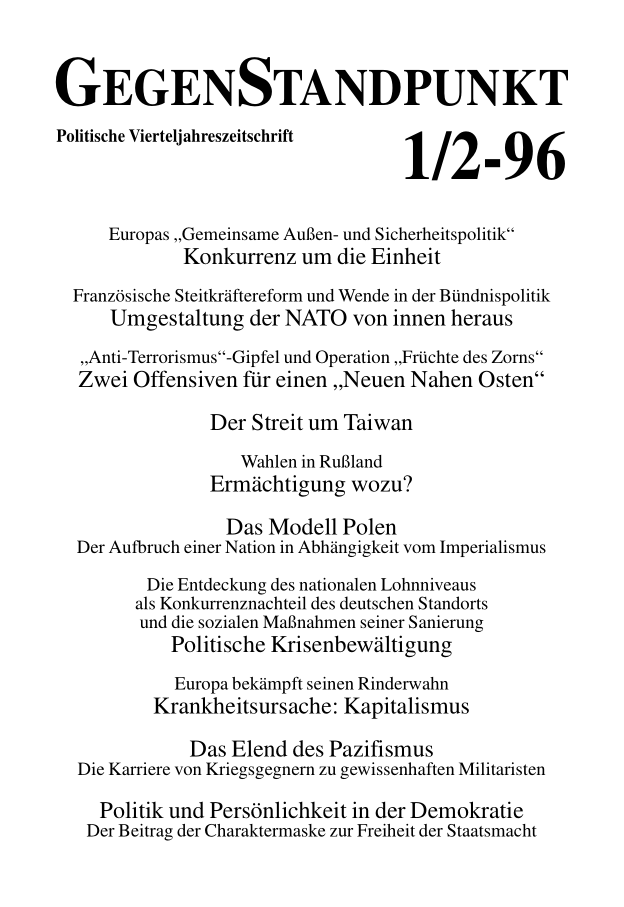Alltag im Klassenstaat (Teil III)
Die Entdeckung des nationalen Lohnniveaus als Konkurrenznachteil des deutschen Standorts und die sozialen Maßnahmen seiner Sanierung:
Politische Krisenbewältigung
Das deutsche „Bündnis für Arbeit“ sieht das Hauptproblem von Staat und Wirtschaft im Preis der Arbeit. Dessen Senkung wird mit Unterstützung der deutschen Gewerkschaften als Hebel zur Sanierung angesehen. Alle europäischen Staaten beteiligen sich an der Standortkonkurrenz um das niedrigste Lohnniveau.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Ein deutsches „Bündnis für Arbeit“ zum Kampf gegen ihren Preis
- II. Die politischen Hebel und Maßnahmen im Kampf gegen den Standortnachteil „nationales Lohnniveau“
- III. Die restliche Abwicklung des politischen Auftrags durch die Standesvertretungen für Wachstum im deutschen Standort
- IV. Armut als Sachzwang und Waffe der Konkurrenz im Standort Europa
Alltag im Klassenstaat (Teil III)
Die Entdeckung des nationalen Lohnniveaus als Konkurrenznachteil des deutschen Standorts und die sozialen Maßnahmen seiner Sanierung:[*]
Politische Krisenbewältigung
I. Ein deutsches „Bündnis für Arbeit“ zum Kampf gegen ihren Preis
Die deutsche Politik hat sich zu einer neuen Betrachtung des Zustands herbeigelassen, in dem sich ihr Standort befindet. Der zur Schau getragene Stolz auf die harte DM tritt zurück; vermeldet wird ein Rückgang des Wachstums, Unternehmen aller Größen machen Verluste, und die Rechnungen im Staatshaushalt gehen nicht auf. Solche Diagnosen, die die gewohnten Maßstäbe marktwirtschaftlichen Erfolgs in Anschlag bringen, ergänzt die Regierung seit einiger Zeit um einen weiteren Befund, den sie zugleich als Auftakt für praktische Maßnahmen gewertet wissen will. Die zunehmende Arbeitslosigkeit gilt ihr als Index für die schlechte Verfassung der nationalen Ökonomie; ihre Überwindung wird als Hebel für die fällige Sanierung angesehen.
Dabei ist den politischen Verwaltern der nationalen Wirtschaft durchaus bekannt, woher die Arbeitslosen kommen: Die Unternehmen haben im Interesse ihrer Konkurrenzfähigkeit, namentlich gegenüber dem Ausland, „rationalisiert“, i.e. durch zweckmäßige Investitionen in ihre Produktionsanlagen Lohnkosten gesenkt; Arbeitskräfte haben sie damit überflüssig gemacht – bei sich selbst und bei nicht wenigen ihrer Konkurrenten, die „am Markt“ praktisch erfuhren, daß ihnen die besagte Fähigkeit abgeht und sie zumachen müssen. Ihren Erfolgsweg wußten die Erfolgreichen auch immer als soziale Leistung zu verkaufen. Dem Vorwurf, sie würden Arbeitsplätze vernichten, begegnen die Arbeitgeber unter anderem mit dem Hinweis auf die immensen Kosten, die heutzutage die Schaffung eines Arbeitsplatzes verursache, der in der globalen Konkurrenz Bestand haben könne. Dieser Auskunft, daß das Wort Arbeitsplatz
keinen Ort bezeichnet, an dem Leute einmal erlernten Bastelarbeiten nachgehen, sondern die Kalkulation mit dem Einsatz einer bezahlten Arbeitskraft für den Unternehmensgewinn, hat schließlich auch der Kanzler in seiner Eigenschaft als Vorstand der arbeitenden Bevölkerung seine Anerkennung nicht verweigert. Seit geraumer Zeit weiß er, daß nicht irgendwelche, sondern rentable Arbeitsplätze fehlen. Der Politik sind eben die Rechnungen, die massenhaft Lohnabhängige für unbrauchbar erklären, weil sich ihr Einsatz nicht rentiert, nicht nur vertraut. Sie respektiert sie auch, erklärt sich in allerlei Ideologien sogar für ohnmächtig gegenüber den „Sachzwängen“, deren Walten sie ihre ganze Macht verschrieben hat.
Diesen Respekt kündigt das „Bündnis für Arbeit“ nicht auf. Die Initiative zur Halbierung der Arbeitslosenzahlen nimmt Maß an den Ergebnissen, die ein konkurrenztüchtiges Marktwirtschaften dem Standort Deutschland beschert hat. Beim unverbindlichen Bedauern über gewisse „unvermeidliche negative Begleiterscheinungen“ will sie es aber nicht belassen. Die Arbeitslosigkeit wird für die Probleme verantwortlich gemacht, die den Politikern aus ihren und der Geschäftswelt schlechten Bilanzen erwachsen. Zu dieser Einsicht kommen die Patrioten des Geldes ganz einfach: Daran gewöhnt, daß ihnen aus der ziemlich flächendeckenden Beschäftigung
ihres Volkes unverzichtbare Dienste erwachsen, stellen sie deren Ausbleiben fest.
1.
Zu Jahresbeginn hat man sich an verantwortlicher Stelle über die Lage Deutschlands im internationalen Standortwettbewerb
große Sorgen gemacht. Konstatiert wurde von den Bilanzführern der Nation ein Rückfall von Aufträgen, Produktion und Beschäftigung in Deutschland … auf den Stand des Rezessionsjahres 1993
(Minister Rexrodt, Süddeutsche Zeitung 11.1.96), ferner starke Einnahmeverluste für den Staat in 1995
und explodierende Sozialausgaben
(SZ 6.2.96) infolge des Anstiegs der Zahl derer, die ohne Arbeit sind. Bei einem Treffen von Regierung, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften zur Wahrung der Zukunftschancen für Wachstum und Beschäftigung
wurde im Sinn dieser Sorge akuter Handlungsbedarf
(Bulletin 26.1.96) angemeldet und auch gleich die Richtung angegeben, in die er sich zu erstrecken hat. Unter dem von der Gewerkschaft ins Gespräch gebrachten Motto Bündnis für Arbeit
nahmen die Verantwortlichen im Standort das Problem, das ihnen das fehlende Wachstum bereitet, als Beschäftigungskrise
(Der Spiegel, 4/96) nicht nur zur Kenntnis. Auch in ihren politischen Maßnahmen, die sie im Rahmen ihres Aktionsprogramms zur Belebung der Wirtschaft
generell für angezeigt hielt und seitdem Zug um Zug auf den Weg bringt, unterstellt die Bundesregierung den Wegfall von „Beschäftigung“ als den Störfall im Standort Deutschland. Sie hätte gern mehr von jenen Plätzen, aus denen im Standort das Wachstum kommt; und gemäß diesem Bedürfnis stellt sie der Nation die wirtschaftspolitische Diagnose:
„In Deutschland fehlen gegenwärtig über fünf Millionen wettbewerbsfähige Arbeitsplätze. Das ist nicht akzeptabel.“
Für grundsätzlich akzeptabel befunden wird also umgekehrt erst einmal alles, was im Standort vorhanden ist. Die vielen Arbeitsplätze zum Beispiel, von deren Wettbewerbsfähigkeit
selbstverständlich auch Politiker wissen, daß sie im Wege tüchtiger Rationalisierung, also kosten- und arbeitsplatzsparender Modernisierung von kapitalistischen Betrieben zustandekommt. In Ordnung geht selbstverständlich auch der Umstand, daß mit Arbeitsplätzen unter dem Gesichtspunkt ihrer Rentabilität kalkuliert wird, eine Investition in sie Folglich nur dann stattfindet, wenn, und immer so, daß sie einen vermehrten Rückfluß verspricht. Mit abgehakt ist all das, was die Rentabilitätskalkulation namens Arbeitsplatz sachzwangmäßig an Notwendigkeiten mit sich bringt: daß die ebenso teuren wie verdienstvollen Aufwendungen für eine konkurrenztüchtige Modernisierung von Arbeitsplätzen sich nur dann lohnen, wenn sie die Aufwendungen für teure Arbeitskräfte überflüssig machen; daß alle sonst noch anfallenden Kosten der Produktion Gegenstand äußerster Sparsamkeit sind und dabei schon wieder die Arbeitskosten im Zentrum aller Bemühungen stehen, weil sich die eingekauften Arbeitskräfte – im Unterschied zur eingekauften Maschinerie – noch im Produktionsprozeß hinsichtlich ihrer Bezahlung und der Leistung, die sie zu erbringen haben, nach Bedarf günstig arrangieren lassen… Mit diesen und anderen Folgen eines „rentablen Arbeitsplatzes“ muß man die politischen Anwälte der deutschen Wettbewerbsfähigkeit
nicht erst bekannt machen. Wenn sie bei ihrer Würdigung der Erträge der kapitalistischen Geschäftstüchtigkeit auf die vielen Arbeitslosen deuten und deren „Beschäftigung“ fordern, dann verlangen sie keineswegs einen Gebrauch von Arbeitskräften, der sich nicht lohnt, sondern wünschen, daß sich der Gebrauch von nicht rentabel einsetzbaren Arbeitskräften rentieren soll. Bei allen Beschwerden über seine praktischen Auswirkungen: Der Maßstab einer lohnenden Verwendung von Arbeit geht ihnen über alles. Die diagnostizierte Störung liegt darin, daß das geheiligte Geschäftsinteresse an so vielen brachliegenden Aspiranten auf wachstumsträchtige Benutzung nichts Ausnützbares findet – was sich auch umdrehen und so ausdrücken läßt, daß die es dann eben an der Tauglichkeit fehlen lassen, sich geschäftstüchtig gebrauchen zu lassen:
„Vieles in unserem Land ist gut geraten, aber wir alle müssen dennoch in manchen Bereichen umdenken. So sind Arbeitsplätze verglichen mit anderen Ländern bei uns zu teuer. Dies hat dazu geführt, daß in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr genügend investiert wird. Wir haben deshalb Maßnahmen beschlossen, die zu einer deutlichen Kostenentlastung führen und so die Zukunft unserer Wirtschaft sichern helfen.“ (Kanzler Kohl, Bildzeitung 25.4.96)
Tagtäglich belehren ihn seine eigenen Kapitalisten praktisch eines Besseren, wenn sie ihre Produktionsmittel und Arbeitskräfte zu den Preisen zusammenkaufen, wie sie gelten, und in ihren Betrieben immerhin schon so profitabel zu kombinieren verstehen, daß sich der Hüter des Standorts gleich als dessen Schöpfer fühlen möchte und sich – verglichen mit anderen Ländern
– mit seinem selbstgefälligen „Wohlgetan, Deutschland!“ im wirtschaftlichen Erfolg seiner Nation sonnt. Seine messerscharfe Analyse, daß in Deutschland die Arbeitsplätze einfach zu teuer
sind, resultiert aus dem Rückschluß, für den Arbeitslose einem Staatsmann allemal gut sind: Sie beweisen ihm untrüglich, daß sie zu teuer sein müssen - denn wären sie das nicht, würde sich ihre Anwendung auch gelohnt haben, und es gäbe sie erst gar nicht. Daher hält der Kanzler überhaupt nichts davon, den Arbeitslosen irgendwie Arbeit zu beschaffen, sehr viel dagegen von Maßnahmen zur Kostenentlastung, um die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen
(ebd.), wobei er natürlich überhaupt nicht eine Preissenkung von Rohstoffen und Produktionsmitteln im Auge hat. Ausschließlich die Kost hat es dem Kanzler angetan und drängt ihn auch zum praktischen Handeln, die Kapitalisten als Preis für die Arbeit zu entrichten haben, die sie verwenden. Dabei meint er nicht diesen oder jenen Unternehmer, der hier oder dort gerne mit billigeren Arbeitskosten kalkuliert hätte, sondern er meint das, was es als nationales Lohnniveau insgesamt in seinem Standort eingerichtet gibt. Und wenn er in Maßnahmen zu dessen Verbilligung die Grundlagen für ein gesundes dauerhaftes Wachstum in der Zukunft
(ebd.) und in denen das Fortkommen der deutschen Nation insgesamt verankert sieht, wird deutlich, daß hier ein Politiker den Standpunkt der kapitalistischen Rentabilität bemüht, um mit Nachdruck das Interesse ins Spiel zu bringen, das er am erfolgreichen Ausgang der Rechnungen seiner Wachstumsschöpfer hat. Obwohl die Wirtschaft in der Wirtschaft stattfindet
(Rexrodt), deren Kosten ihn also nichts anzugehen bräuchten, hält er sein Engagement für Kostenentlastung
überhaupt nicht für eine Einmischung in fremde Angelegenheiten. Vielmehr geht er als Vertreter des Staates davon aus, daß er bei der Bestimmung dessen, was der arbeitenden Klasse in seinem Standort insgesamt als Lohn für ihren Dienst allenfalls noch zuzugestehen ist, ohne gewisse regulative Eingriffe nicht auskommt: Der Staat selbst leidet unter einer „Beschäftigung“ verhindernden nationalen „Kostenstruktur“; bei „zu hohen Löhnen“ kommt er nicht mehr so recht zu den Diensten kommt, die er sich von seiner kapitalistischen Klassengesellschaft erwartet.
2.
Das staatliche Interesse am Lohn und an Beschäftigung
, für die Lohn bezahlt wird, beginnt nämlich keineswegs erst dann, wenn die Verantwortlichen mit Verweis auf die vielen Nichtbeschäftigten im Standort das herrschende Lohnniveau als Hindernis für dessen Wettbewerbsfähigkeit
ausfindig machen und ihre Maßnahmen zu dessen Beseitigung ersinnen. Zur Normalität des Klassenstaates gehört schon immer die Inanspruchnahme des gesamtgesellschaftlichen Lohneinkommens als monetäre Quelle für jede Menge Dienstleistungen, die der Staat in seiner Funktion des ideellen Gesamtkapitalisten für notwendig erachtet und für die er sich an den verdienten Löhnen bedient. So ist die Funktion, die der Lohn für das kapitalistische „Wachstum“ hat – er wird als rentable Kost gezahlt –, von Staats wegen ganz generell mit einer Reihe von Ansprüchen befrachtet, die einfach davon ausgehen, daß seine Bürger ihre arbeitsamen Dienste verrichten und entsprechend entlohnt werden. Insofern ist das staatlicherseits am Lohn geltend gemachte Zugriffsrecht, die Enteignung verdienter Privateinkommen zur Finanzierung von Staatsaufgaben, ein politischer Hoheitsakt, der mit der ökonomischen Kalkulation mit dem Lohn eben nur insoweit zu tun hat, als er ihr positives Ergebnis, die Rentabilität des Lohns für den, der ihn produktiv zu nutzen vorhat, voraussetzt, um sich an ihm zu bedienen. Daher kommt es, daß mit dem vermehrten Ausbleiben dieser Voraussetzung sich ganz viele Stimmen regen, die den Wegfall all der guten Dienste für den Standort Deutschland beklagen, für die die Entlohnung der Arbeiterklasse schon längst zuständig ist.
- Seinen allerersten Dienst für den Standort versieht der Lohn als Faktor des
Wachstums
. Das kommt an Arbeitsplätzen zustande, die sich dadurch auszeichnen, daß sierentabel
sind, der bezahlte Lohn also eine Kost ist, die sich rentiert und dadurch zum nationalen Wirtschaftswachstum beiträgt. Dabei kommt es weder auf eine bestimmte maximale Höhe des Lohns an noch auf einen dieser Kost unmittelbar zurechenbaren Wachstumsbeitrag: Der Dienst am nationalen Reichtum und dessen Wachstum ist praktisch erwiesen, wenn und solange diese Kost vom Kapital bezahlt wird – umgekehrt verhält es sich umgekehrt, und Leute ohne Lohn belegen einfach dadurch, daß sie nicht bezahlt werden, die Unrentabilität der Löhne, die sie nicht kriegen, und damit auch den Ausfall von potentiellem Wachstum. Die vielen, an denen inzwischen diese Kalkulation exekutiert wird und die sich für die Mehrung des kapitalistischen Wachstums als unbrauchbar erweisen, sind in der Optik der staatlichen Buchhalter des Wachstums nicht bloß das beweiskräftige Indiz dafür, daß sich der Gebrauch der Wachstumsquelle Arbeitskraft für ihre Anwender nicht rentiert, sondern kommen ihnen wie ein Heer potentieller, nur eben aktuell nicht in Funktion befindlicher Wachstumsfaktoren vor. In diesem Sinne legen sie sich die Krise, in der ihr Kapital ist, alsBeschäftigungskrise
, als mangelnde Indienstnahme aller vorhandenen und für Wachstum im Prinzip doch auch brauchbaren dienstwilligen und -fähigen Bürger zurecht; ihrem Wunsch, möglichst alle dazu Vorgesehenen möchten doch auch wirklich an der nationalen Reichtumsmehrung mitwirken, verleihen sie in der Forderung Ausdruck, es müsse fürBeschäftigung
gesorgt werden. Das ist der Titel, unter dem bei bleibender Anerkennung der Kalkulation, die über das Zustandekommen des nationalen Reichtums und seines Wachstums sowie den dafür zweckmäßigen Einsatz von Arbeitskraft entscheidet, vom Standpunkt der staatlichen Bilanz aus darüber Beschwerde geführt wird, daß „die Wirtschaft“ ihrem allerersten Daseinszweck zu wenig genügt. - Solange jemand nach der Kalkulation seines Betriebs zum Dienst am Wachstum zugelassen ist, erzielt er ein Einkommen, von dem er sich und seinen Anhang durchzubringen hat. Auch zu diesem Umstand gibt es eine weit maßgeblichere Sichtweise, die am Arbeitnehmerhaushaltsgeld dessen wahre ökonomische Funktion feststellt und damit über die auch hier entscheidende wirtschaftspolitische Interessenlage Auskunft gibt: Bei seiner Verausgabung für den privaten Lebensunterhalt hat er als
Kaufkraft
zu wirken. Besagte „Kraft“ hat ihre Funktion darin, einen Teil der ungeheuren Warensammlungen und mit denen den Profit zu versilbern, für den sie produziert wurden. Wenn nun in beträchtlichem Umfang Lohnzahlungen an Werktätige einfach nicht mehr stattfinden, geht dies natürlich an dieser „Kraft“ nicht spurlos vorüber. Es ist zwar ein und dieselbe kapitalistische Rechnungsweise, die mit ihren Methoden der Einsparung von Lohnkosten auf der einen Seite die gesellschaftliche Zahlungsfähigkeit beschneidet, die sie zugleich auf der anderen Seite für die Realisierung des kalkulierten Gewinns in Anspruch nimmt. Aber die auf die politischen Erträge des Wachstums bornierten Betrachter des Geschehens sehen das durch ihre funktionalistische Brille eben anders. Messerscharf diagnostizieren sie eineWachstumsschwäche
, die sie ebenso locker wie die vielen Konkurse und endgültigen Zusammenbrüche wertvoller kapitalistischer Wachstumsbemühungen dem Versiegen jener „Kraft“ zuschreiben, die doch fürs Aufkaufen des versammelten und gerade ziemlich schlecht verkäuflichen Güterhaufens da zu sein hätte. Andere Quellen, die dieselbe Funktion verrichten könnten, auswärtige Kunden mit ihrer „Kaufkraft“ nämlich – die den schätzenswerten Vorteil hat, nicht in anderer Hinsicht als nationaler Kostenfaktor verbucht werden zu müssen –, sind gleichfalls nicht zugänglich – beiläufig erfährt man in diesem Zusammenhang etwas über die ausschließende Natur des „Wachstums“, das sich derzeit eben nur einstellt, wenn man es anderen erfolgreich wegnimmt:„Wegen des gemeinsamen Währungsziels werde in den großen europäischen Ländern gleichzeitig gespart, staatliche Investitionen und privater Konsum seien rückläufig. Anders als in früheren Konjunkturflauten werde kein Staat die Nachbarländer mit hochziehen – im Gegenteil.“ (Industriepräsident Henkel, Der Spiegel 3/96)
Als Quelle der benötigten „Impulse“ für das Wirtschaftsleben wird folglich wieder
die Beschäftigung
ausgemacht; diesmal als Bedingung der Möglichkeit, mittels der ihr entspringenden Zahlungsfähigkeit das Wachstum wieder „anzukurbeln“ – als könnte ausgerechnet der Lohn, nämlich in seiner Eigenschaft als „Binnennachfrage“, die Folgen seiner Senkung, nämlich als Kostenfaktor, ungeschehen machen und dafür sorgen, daß sich die Anwendung von Lohnarbeit wieder vermehrt lohnt. - Insofern der Staat weit über 70% seines Steueraufkommens im Wege der direkten oder indirekten Besteuerung der „Masseneinkommen“ bezieht, kommt dem Lohn natürlich auch unter diesem Gesichtspunkt eine wichtige Funktion zu. Er dient als staatliche Geldquelle, und sein Ausfall in nennenswertem Umfang bedeutet unmittelbar einen Rückgang der Einkünfte des Fiskus, mittelbar die Beschränkung seiner Freiheiten des Verschuldens; denn daß seine vielen Schulden durch wirklich verdienten Reichtum, den er an sich zieht, als irgendwie abgesichert erscheinen können, möchte um der „Stabilität“ seines Kredits willen schon sein. Der Ruf nach
mehr Beschäftigung
meint insoweit also ganz banal eine Vergrößerung der Geldsumme, die der Staat per Steuern an sich ziehen kann, und trifft zugleich eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen den Einkommensarten, aus denen er sein Steueraufkommen schöpft: Wer sein Geld damit verdient, andere gegen Geld für sich arbeiten zu lassen, stiftet „Beschäftigung“ und darf in dieser segensreichen Tätigkeit nicht durch fiskalische Abschöpfung behindert werden; wer sein Geld nur verdient, um es anschließend privat aufbrauchen zu müssen, kann ohne negative Rückwirkungen auf die Summe der ausnutzbaren Geldquellen in der Gesellschaft und muß folglich dementsprechend geschröpft werden. - Empfindlich trifft der Ausfall von Lohnzahlungen die Funktion des Lohnes als Finanzierungsquelle der Sozialversicherung. Diesbezüglich hat sich der Staat zum Zwangsverwalter der Vergesellschaftung aller Risiken bestellt, die die Lohnarbeit so mit sich bringt. Er verstaatlicht einen Teil der Lohneinkünfte, die das Kapital zahlt, als Beiträge, die, soweit und weil ein Teil von ihnen direkt durch den Arbeitgeber an die Kassen überwiesen wird, „Arbeitgeberanteil“ heißen und insgesamt kritisch als „Lohnnebenkosten“ besichtigt werden. Solange sich das Kapital in Zeiten prosperierenden Wachstums des überwiegenden Teils der arbeitenden Klasse bedient, reichen deren regelmäßige Zahlungen nicht nur für den Unterhalt der Alten, Kranken und Arbeitslosen auf dem vom Staat nach seinen Kriterien festgelegten „Versorgungsniveau“. Aus dem einkassierten Geld finanziert der Staat unter Schonung seiner Kreditlinien schon auch blühende Landschaften im Osten, erspart Betrieben teure Sozialpläne, bezahlt die Verkleinerung und Verjüngung ihrer Belegschaften im Wege der Frühverrentung und macht so deutlich, daß das einzig „Versicherungsfremde“ bei seinem Umgang mit den Geldern der Sozialkassen die Vorstellung von Beitragszahlern ist, der
Generationenvertrag
sei so eine Art Versicherungspolice. Wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften vermehrt ausbleibt, fallen den sozialen Kassen recht viele Zahler weg – und genausoviele neue Anspruchsteller werden mit ihren wohlerworbenen Rechten bei ihnen vorstellig. Dies löstKostenexplosionen
auf allen Gebieten aus, die dem Staat nicht nur die Bedienung an diesen famosen Geldsammelstellen verwehren, sondern auch noch drohende Belastungen für seinen Resthaushalt bedeuten, soweit er von Rechts wegen mit diesem für die eingerissenen Defizite geradestehen muß. Und auch die Finanzierungsschwierigkeiten der Sozialkassen betreffend wissen die Sachverständigen schon wieder gleich, was der Staat am regelmäßigen Lohneinkommen seiner Bevölkerung hat, also auch schon wieder denselben Weg zur Lösung des Dilemmas:Nur mehr Beschäftigung kann die Misere der Sozialfinanzen beheben.
(SZ 9.2.96)
3.
Wo immer Vertreter des Staates selbst oder die Meinungsbildner seiner Öffentlichkeit sich den Problemen zuwenden, die die Arbeitslosen dem Gemeinwesen bescheren, haben sie im nächsten Zug also schon immer gleich die Lösung parat, die dem notleidenden Standort den Ausweg weist. Jede Menge Beschäftigung
heißt die, und das ist zumindest nach einer Seite hin logisch und konsequent. Die diversen, aus der zu verzeichnenden Beschäftigungslosigkeit resultierenden und laut gewälzten Probleme leiten sich nämlich allesamt aus den Ansprüchen ab, die der Staat aus Gründen einer von ihm definierten Zweckmäßigkeit an ein geregeltes Lohnarbeiterdasein – möglichst aller oder zumindest ganz vieler – seiner Untertanen knüpft. Zur wirklichen ökonomischen Zweckmäßigkeit, der der Gebrauch von Arbeitskräften gegen die Zahlung von Lohn unterliegt und die sich ganz an der Rentabilität einer als Kapital vorgeschossenen Kost bemißt, die einen Ertrag abzuwerfen hat, hat der Staat also durchaus ein doppeltes Verhältnis. In Bezug auf Gebrauch und Nichtgebrauch von Arbeitskraft tastet er weder die ausschließliche Kompetenz derer an, denen sie als Eigner von Kapital von selbst zufällt, noch steht er in irgendeiner Weise kritisch zu den kalkulatorischen Grundsätzen, die sie bei ihren Bemühungen um unschlagbare Rentabilität ihres Kapitals in Anschlag bringen: Das erfolgreiche kapitalistische Wirtschaften ist seine Grundlage, von der lebt er und an der bedient er sich, und beides vermag er umso besser, je erfolgreicher seine Wirtschaft ist. Die Umkehrung gilt natürlich auch; mit den Schranken des Wachstums gehen auch solche einher, die seine Mittel betreffen – und dann läßt er sich zu Reaktionen hinreißen, die nicht zu den Sachnotwendigkeiten passen, die er in seiner Ökonomie eingerichtet hat. An die Wirtschaft
, die nach ihren Kriterien mit dem Einsatz von Arbeit kalkuliert, ergeht dann, wenn der Staat sich von den Auswirkungen dieser Kalkulation negativ betroffen sieht, der Ruf nach Beschäftigung
, mit dem der Staat sein Bedürfnis anmeldet, sie möge – ohne an der ökonomischen Funktion des Lohnes für sie zu rühren – ganz viele private Geldeinkommen schaffen, damit all die Funktionen gehen, die er politisch an den Lohn geknüpft hat. Und beim bloßen Verlangen nach anderen, ihm genehmen Resultaten seiner Ökonomie beläßt er es nicht. Nicht, daß er mit Macht seinen Anspruch auf sprudelnde Revenuequellen in seiner Gesellschaft gegen sie durchsetzen wollte – er folgt schon ganz dem Prinzip, nach dem sein Lebensmittel funktioniert, wenn er die grundsätzliche Sanierung seines Standorts in Angriff nimmt. Dabei hat er nur eines im Visier: Wenn das Beschäftigen
schon davon abhängt, daß es sich für die Wirtschaft
auch rentiert, dann – so sein systemkonformer „Schluß“ – tut es dies ganz gewiß und genau in dem Maße mehr, in dem es rentabel gemacht wird. Auf diese Weise übersetzt der Staat sich sein Interesse am Lohn in den Auftrag, den Lohn, der im Standort verdient wird, zu senken, und macht in seiner Ohnmacht gegenüber den Sachzwängen seiner Ökonomie wenigstens von seiner Macht Gebrauch, ihr die Hindernisse wegzuräumen, die er ihrer weiteren Entfaltung im Standort und natürlich auch von außerhalb entgegenstehen sieht.
II. Die politischen Hebel und Maßnahmen im Kampf gegen den Standortnachteil „nationales Lohnniveau“
Wenn derzeit der Haushalt ein Loch nach dem anderen aufweist, wenn die Beiträge der zahlenden Mitglieder der Zunft zu den Sozialkassen nicht reichen, um die Ausgemusterten nach dem geltenden Sozialrecht zu versorgen, so ist allemal eine Korrektur am Verhältnis zwischen Ein- und Ausgaben vonnöten. Diese Veränderungen werden vorgenommen und sorgen in beiden Richtungen, bei den Einzahlern wie bei den Zahlungsempfängern, für eine sachgerechte Anpassung des Lebensniveaus.
Hierbei vollzieht die Sozialpolitik nicht bloß nach, was die Schmälerung der gesamtgesellschaftlichen Lohnsumme, die die am Standort tätigen Kapitalisten für die Erwirtschaftung von Gewinn noch aufwenden, an Verarmung erzwingt. Im Zeichen der Notwendigkeit, Chancen für Beschäftigung
zu schaffen, wird sie schöpferisch tätig. Nicht so, daß sie irgendwen zur Einstellung von Arbeitslosen zwingen würde – „die Wirtschaft“ findet ein für allem „in der Wirtschaft“ statt, und „die Politik kann keine Arbeitsplätze schaffen“. Deswegen bleiben die „Beschäftigungseffekte“ der getroffenen und geplanten Maßnahmen auch mehr ein Ideal ohne praktische Verbindlichkeit, und die Festlegung der Kanzlerrunde auf eine Halbierung der Arbeitslosenzahl ist ein politischer Mißgriff, der nur dadurch zu entschuldigen ist, daß sowieso kein erfahrener Demokrat Kohls Versprechen für bare Münze nimmt. Ohnmächtig ist die Staatsmacht dennoch keineswegs: Wenn die fürs Arbeitgeben zuständigen Unternehmer die Schaffung von Arbeitsplätzen unterlassen, die die Politik für dringlich erachtet, dann stehen dem Willen zur „Beschäftigung“ eben Hindernisse im Weg, für deren Beseitigung sie durchaus einiges tun kann. Wenn nämlich die Unternehmer per Rationalisierung ihre Kosten-Nutzen-Rechnung in Ordnung bringen, dann – so der sozialpolitische Umkehrschluß – senken sie nicht des Gewinns wegen die Lohnkosten über die Verringerung der Belegschaft; vielmehr reagieren sie auf zu hohe Löhne, was man auch an der Vorliebe für fremde Standorte sehen kann. Wenn sie den Sozialstaat damit in Schwierigkeiten bringen, dann beweisen sie recht besehen nur, um was für einen Abgrund von „Lohnnebenkosten“ es sich da handelt, die bloß die Entstehung nützlicher Einkommen verhindern. Wenn also die „Beschäftigungspolitik“ der Unternehmer den Sozialstaat in die Zwangslage bringt, mit geringerer Finanzmasse mehr Sozialfälle zu finanzieren, dann muß der Staat eben aus eigener Initiative vorauseilend seinen Zugriff auf die gesamtgesellschaftlichen Lohnkosten reduzieren und das Eingenommene entsprechend sparsamer zuteilen, also die Wirkungen der Unternehmenspolitik antizipieren, um so seine Handlungsfreiheit
zurückzugewinnen. Mit der Entlaubung des Sozialstaats, für die seine Macht in jedem Fall reicht, hat er seinen ersten und wichtigsten Beitrag zur Senkung der Lohnkosten zu leisten. Die positiven beschäftigungspolitischen Folgen können dann unmöglich immerzu ausbleiben…
1.
Zu den Grundlagen des Erfolgs einer „Wirtschaftsmacht“ wie Deutschland gehört, daß auch die soziale Frage
, die der Dienst am Wachstum des Kapitals regelmäßig aufwirft, von der Staatsmacht erfolgreich gelöst wird. Die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft an kapitalistische Unternehmer lebende Klasse muß den Dienst, für den sie vorgesehen ist, schon auch versehen können, weswegen sich die Staatsmacht dafür verantwortlich erklärt, den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit in eine gesellschaftsdienliche Verlaufsform zu bringen und für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Daß der Gebrauch der Arbeitskraft ihren Ruin ebenso regelmäßig nach sich zieht wie die Unmöglichkeit, vom Verkauf derselben den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können, drängt den Staat dazu, die Eigentumslosen mit Rechten auszustatten, auf daß sie mit ihren Anwendern wenigstens jenes Normalniveau von Verschleiß und Verelendung vereinbaren können, das einen insgesamt funktionalen Gebrauch der Arbeitskraft ermöglicht. Damit die eigentumslose Klasse im Ganzen auch dann tauglich und erhalten bleibt, wenn sich ihre Mitglieder wegen Krankheit, Alter oder Wegfall der Nachfrage über den Verkauf ihrer Arbeitskraft nicht mehr erhalten können, wurden im Standort Deutschland noch zusätzlich einige soziale Kassen eingerichtet. Mit denen requiriert der Staat einen Teil der Einkommen der lohnend Beschäftigten eigens dafür, die restlichen Mitglieder der Klasse auch in den Fällen am Leben zu halten, in denen sie es mit eigenen Mitteln gar nicht können. Mit dieser sozialen Umverteilung der Armut sorgt der Staat dafür, daß das Wachstum des Reichtums auf der einen Seite friedlich mit einem proletarischen Elend auf der anderen koexistiert, in dem die ganze Klasse in Gestalt von ganz verschiedenen Karrieren der Verelendung – vom frühverrenteten Kranken über die alleinerziehende Mutter bis zum Langzeitarbeitslosen – praktisch mit der Unmöglichkeit vertraut gemacht wird, vom Lohn, den sie verdient, leben zu können.
Wenn die Klasse selbst diesen schönen Dienst, mit eigenen Mitteln für ihren Erhalt zu sorgen, nicht mehr erbringen kann, weil die Kassen, die der Staat mit ihren Mitteln füllt, die Finanzierung der rechtlichen Ansprüche nicht mehr hergeben, die die Konjunktur des Wachstums in Gestalt von vielen Arbeitslosen hervorbringt, entsteht neben und zusätzlich zu der gelösten alten eine neue soziale Frage
. Aufgeworfen wird sie in Gestalt von Deckungslücken
und Fehlbeträgen
in den diversen sozialstaatlichen Fonds, die den Staat mit der Alternative konfrontieren, entweder sein Interesse am weiteren Funktionieren der eingerichteten sozialen Gerechtigkeit
aus dem im Wesentlichen der gleichen Quelle wie die Kassenbeiträge entstammenden „allgemeinen Steueraufkommen“, also auf Kosten anderer Notwendigkeiten des Haushalts zu finanzieren – oder umzudenken
. Die Hüter des deutschen Standorts haben sich bekanntlich zu letzterem entschlossen und die öffentliche Armut
, die sie als Folge der privaten Einkommensausfälle verzeichnen, zum Anlaß genommen, ihr Problem grundsätzlich anzugehen. In schöpferischer Weiterführung ihrer Diagnose, daß Arbeitslosigkeit ihren Grund ohnehin nur darin hat, daß die Arbeit zu teuer
ist, entdecken sie ihren politisch-rechtlichen Umgang mit den Klassen als ein einziges Verfahren, den Preis der Arbeit für die, die mit ihm kalkulieren, über Gebühr zu verteuern: Kaum scheitern sie mit dem netten Prinzip, mittels Umverteilung der Armut die Produktion des kapitalistischen Reichtums sozialverträglich
abzuwickeln, übersetzen sie die Kost, die die diversen öffentlichen Haushalte nunmehr für den Unterhalt der ganzen sozialstaatlichen Errungenschaften
zu tragen hätten, in Kosten, von denen sie die kapitalistischen Produzenten des Reichtums unbedingt entlasten müssen – und nehmen diese Kostensenkung in Angriff.
2.
Es fügt sich, daß bei genauer Betrachtung der Rechtslage, wie sie in dem sozialstaatlichen Dreiecksverhältnis zwischen Staat, Kapital und Arbeit nun einmal existiert, sich so gut wie alles, was sich als kostentreibendes Element für den Preis der Arbeit störend identifizieren läßt, umgekehrt natürlich auch gleichzeitig als Hebel verwenden läßt, den Störfall zu beseitigen. Ein Arbeitsrecht, das überaus penibel den Verschleiß der Arbeitskraft in einen rechtlich erlaubten Normalfall und in nicht gestattete Auswüchse
scheidet, läßt sich ja gar nicht anders auslegen, als daß mit ihm dem vorhandenen Interesse an einer freien Verfügung über die Arbeit je nach dem Bedarf ihrer Anwender Hindernisse entgegengestellt werden – also ist das Arbeitsrecht auch das Mittel, dem Kapital diesen freien Umgang mit der Arbeitskraft zu verschaffen, muß dazu überhaupt nicht ausgehöhlt
, sondern nur entsprechend modifiziert werden. Und wo das staatliche Sozialrecht die Finanzierung der sozialen Aufgaben so eingerichtet hat, daß sie über die Beschlagnahmung eines Anteils an der gesamtgesellschaftlich gezahlten Lohnsumme zustandekommt, ist der Staat auf seine Weise ja auch schon längst in dem Prozeß der Lohnfindung
eingemischt – so daß auch hier der Einsatz seines rechtlichen Instrumentariums die Methode ist, den Preis der Arbeit zu verbilligen: Die rechtlich verordnete Senkung der Beiträge fürs Soziale ist der kürzeste Weg der staatlichen Lohnsenkung und der gute Grund für die Leistungsbeschränkungen der Sozialkassen zugleich, die dann gleichfalls auf dem Rechtsweg erfolgen. Die einzigen Hindernisse, die dem Staat dabei entgegenstehen, sind die von ihm selbst eingerichteten Rechtsverhältnisse, ist der rechtsförmige Charakter des Anspruchswesens, das da zu verändern ist, und sind die bis ins Letzte aufeinander abgestimmten Finanzbeziehungen zwischen den verschiedenen Kassen. Deshalb ist die Sicherung und Festigung des Sozialstaats
(Bundesvereinbarung beim Bundeskanzler, 23.1.96) durch echten Sozialabbau
(Lambsdorff, Der Spiegel 4/96), drastische Einschnitte ins soziale Netz
(Schäuble, ebd.) und sonstige Zumutungen an die eigene Klientel
(Scharping, SZ 19.1.96) ein langwieriger Prozeß, der aber immerhin schon wie folgt ordentlich in Schwung gekommen ist:
- Im Bereich der Krankenversicherung hatte sich schon das
Aktionsprogramm
der Bundesregierung das Ziel gesetzt,den Beitragssatz … auf den Stand von 1995 zurückzuführen
. Um ein Stückstaatlich bedingter Lohnzusatzkosten
zu senken und dennoch mit den reduzierten Beiträgen auszukommen, wurde mit dem Sparpaket vom April 96 das schon seit Jahren laufende Programm der Leistungskürzungen fortgeschrieben: Die Zuzahlungspflicht von Patienten wird ausgeweitet, der Anspruch auf Kuren nach Häufigkeit und Dauer beschränkt. Die Abschreckung der Kranken von der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen durch Selbstbeteiligung oder gleich auf dem Verordnungsweg – die Beschränkung des Zugangs zu teuren Fachärzten anstelle der hausärztlichen Versorgung wird ebenfalls debattiert – geht offenbar davon aus, daß der Volkskörper elastisch genug ist, um auch bei reduzierter medizinischer Betreuung den Bedarf nach brauchbaren Arbeitskräften zu befriedigen – das Volk wird schon lernen, beim Anstehen nach knappen Arbeitsplätzen ein wenig hart gegen sich selbst zu sein. Die, die gegenwärtig arbeiten, dürfen sich darin auch schon üben, denn die Bundesregierung hält esfür notwendig, daß die Tarifpartner … Möglichkeiten zur Verminderung von Fehlzeiten in den Betrieben konkretisieren
(Aktionsprogramm) undregt an
, Regelungen zur Teilanrechnung von krankheitsbedingten Fehlzeiten auf Weihnachts- und Urlaubsgeld zwischen den Tarifparteien zu treffen. In ihrem Einsatz zur Verbilligung der Arbeitskosten hat es die Bundesregierung von Anfang an kaum in ihrem Zuständigkeitsbereich gehalten. Sie sah sich dazu veranlaßt, die Betriebe auf deren viel zu lasch behandelten Kostenquellen hinzuweisen, weil zwar die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall – sechs Wochen bis zum Einsatz des Krankengeldes – im Entgeltfortzahlungsgesetz vom Mai 1994 bestimmt wird, der Höhe nach aber gem. § 4 Abs. 4 des Gesetzes durch Tarifvertrag geregelt wird. Den staatlichen Kostensenkern ist der Gedanke wesensfremd, daß erhöhte Krankenstände ein Zeichen von Krankheit sein könnten und deren statistisches Absinken in Gebieten und Betrieben drohender Arbeitslosigkeit keines vonGesundheit
ist. Sie überziehen ihre Werktätigen mal eben so mit dem Generalverdacht der Drückebergerei, kritisieren die Betriebsführer für ihre lasche Handhabung des Skandals – und handeln sich eine extrem konstruktive Gegenkritik des BDI ein, der zum Thema gleich„noch auf etwas hinweisen möchte, was als große Lücke sowohl im Kanzler-Papier als auch in den Rexrodt-Papieren fehlt: das ist die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Sie wissen, daß wir auch hier inzwischen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im Krankfeiern sind… Es wird Schindluder damit getrieben.“ (BDI-Henkel, SZ 17./18.2.96)
Mit der Kundgabe von
Lücken
dieser Art rennt man hierzulande offene Scheunentore ein. Der DGB-Vorsitzende Schultesignalisierte
,mit den Arbeitgebern über die Fehlzeiten reden zu wollen
(SZ 9.4.96), und der Minister für Sozialverträglichkeitverlangte
eineKürzung der Lohnfortzahlung
(SZ 6./7.4.96) –notfalls
, d.h. für den Fall, daß die Tarifparteien sich über sie nicht einigen, eben durch die Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Dann kommt von der Änderung der Bemessungsgrundlage durch Außerachtlassen von Überstundenzuschlägen bis zur Einführung von Karenztagen alles ins Gespräch, was dem Skandal ein Ende bereiten könnte und die unerträglicheBelastung der Unternehmen durch Krankheitskosten der Mitarbeiter von 60 bis 70 Milliarden im Jahr zu halbieren
(SZ 6./7.4.96) verspricht. Und daneben auch noch unbedingt demgesunden Menschenverstand
eines Blüm einleuchtet, der einen beständigen Wechsel von Kurzarbeit und Überstunden für extrem vernünftig und gesund hält, aber es einfach nicht fassen kann,„daß jemand, der in Zeiten von Kurzarbeit krank wird, mehr Geld bekommt, als wenn er arbeiten würde. Wenn gar noch Überstunden in die Lohnfortzahlung eingehen, ist es clever, nach einer Überstundenphase erst einmal krank zu feiern“ (ebd.).
Ein Schösser vom DGB-Bayern hält es bei soviel Menschenverstand
für einen Gewerkschaftler für logisch
, die durch die Nichtanrechnung von Überstundenzuschlägen eingesparten Lohnfortzahlungsgelder durch die Einrichtungskosten eines durchschnittlichen Arbeitsplatzes zu dividieren. Herauskommt jede Menge neuerBeschäftigung
, woraus für ihn folgt, daß an der Kürzung der Lohnfortzahlung kein Weg vorbeiführt. Und nicht nur an der:Nicht nur die Lohnfortzahlung, sondern auch das Krankengeld, das die Kassen an Langzeitkranke
– auch so ein Beruf im Sozialstaat –von der sechsten Woche an zahlen müssen
(Der Spiegel, 16/96), bietet sich sogleich als Streichmasse an. Denn:„Von einer gesetzlichen Einschränkung der Lohnfortzahlung verspricht sich Blüm jedoch einen weiteren Effekt: Dann wäre es leichter, auch eine Kürzung des Krankengeldes durchzusetzen und so die Lohnnebenkosten zu senken.“ (ebd.)
Einmal den Standpunkt fest etabliert, daß geltendes Recht sich unter den Auspizien der gebotenen sozialen Gerechtigkeit im Standort wie eine Ansammlung von überkommenen
Besitzständen
ausnimmt, trägt jedeKürzung
ihre eigene Notwendigkeit in sich und die der nachfolgenden zugleich, weil die ja auch nur denselben gerechten Verhältnissen dient wie die erste. Daher war es in der Tat auch wirklich sehrleicht
, zusammen mit der Kürzung der Lohnfortzahlung – sie wird von 100 auf 80% des vollen Lohns gekürzt, wahlweise können bis zu 6 Urlaubstage angerechnet werden – auch die des Krankengeldes um 10% mitzubeschließen.Vielleicht war sie aber auch nur ganz logisch; denn so, wie das Finanzierungs-, Anspruchs- und Leistungswesen im Sozialstaat miteinander verzahnt ist, fallen mit der Lohnfortzahlung natürlich auch die Krankenkassenbeiträge weg. Das Minus, das die verordnete Lohnkürzung in den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung hinterläßt, gilt es also durch
gleichzeitige Entlastung an anderer Stelle
(Seehofer) aufzufangen. - Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wird die Altersgrenze für die Zahlung von Arbeitslosengeld länger als ein Jahr auf 45 Jahre angehoben – was dem Umstand weise Rechnung trägt, daß zunehmend rüstige Vierziger ihre Jobs verlieren und keine neuen mehr finden. Das neue Recht spart der Kasse in Nürnberg einige Zahlungen und soll Raum schaffen für die Stabilisierung bzw. Senkung der Beiträge. Es weist aber zugleich auch darauf hin, daß die Regierung selbst keineswegs an den Zweck glaubt, dem sie ihre Kostensenkungskampagne widmet: Wenn sie wirklich an ihr
Mehr Beschäftigung!
und an das baldige Ende des Zustroms vierzigjähriger Langzeitarbeitsloser dächte, bräuchte sie nicht den Betroffenen die verlängerte Leistungsdauer per Anhebung der Altersgrenze außer Reichweite zu räumen, um einemKostenrisiko
zu begegnen – mit dem rechnet sie offenbar schon auf Dauer.Sehr vorteilhaft an dieser Regelung zur tendenziellen Endlagerung älterer Arbeitsloser ist die Folge, daß der Anteil der Arbeitslosen größer wird, die schon vor Erreichen der Altersgrenze auf die für die Kasse billigere Arbeitslosenhilfe gesetzt werden können, was natürlich bei der dann Einsparungen nötig macht. Die Arbeitslosenhilfe muß dann natürlich lt. „Aktionsprogramm“ ebenfalls um 3 bis 5% gekürzt werden – dem Umstand, daß dadurch noch mehr AlHi-Empfänger als bisher unter Sozialhilfe-Niveau sinken, wird dann nach der gleichen Logik durch Verminderung der Sozialhilfe-Leistungen entsprochen.
Den die Arbeitslosenversicherung betreffenden Maßnahmen ist anzumerken, daß sie nicht mehr wie früher im Sozialstaat des
Modell Deutschland
auf Zwischenlagerung einer überschaubaren Anzahl vorübergehend nicht benützter Arbeitskräfte mit wenigstens gehaltsähnlichem Einkommen berechnet sind. Der Fanatismus der staatlichen Lohnsenkung trennt zunehmend den leitenden Kostengesichtspunkt von dem des Bedarfs, mit dem eine außer Betrieb gesetzte Arbeitskraft ihre materielle und moralische Form bis zu ihrem erneuten Einsatz halten kann, und dementiert damit praktisch die regierungsamtlich mit demBündnis für Arbeit
in die Welt gesetzten Erwartungen eines in absehbarer Zeit zu erwartendenBeschäftigungsaufschwungs
. - Im Bereich der Rentenversicherung entdeckt das Aktionsprogramm die jahrelang betriebene Finanzierung der Verjüngung von Belegschaften durch das
vorgezogene Altersruhegeld wegen Arbeitslosigkeit
für mittels Sozialplanfreigesetzte ältere Arbeitnehmer
nunmehr als korrekturbedürftigeFehlentwicklung
. Da die Unternehmen ausgiebig von der Gelegenheit zur billigen Entsorgungüberzähliger Endfünfziger
(Der Spiegel) Gebrauch machten, stiegen die Kosten der Frühverrentung für die Sozialkasse von ca. 1 Milliarde im Jahr 1992 auf erwartete 66 Milliarden im Jahr 1996, was auf die „Lohnkosten“, Abteilung Rentenversicherungsbeiträge, einigen Druck nach oben ausübte. Künftig werden sich daher Leute, die nach ihrem 55. Geburtstag arbeitslos werden, bis zum Alter von 63 als gewöhnliche Arbeitslose durchschlagen müssen, bevor sie eineAltersrente wegen Arbeitslosigkeit
bekommen – wenn sich nicht ihre Verwendung inAltersteilzeit
noch rentiert. Wer als Arbeitsloser schon mit 60 Rente beziehen will, muß Abschläge von derzeit geplanten 10,8% auf seine Rente hinnehmen (3,6% pro Jahr des Rentenbezugs vor dem Alter von 63 Jahren). Daß es sich aber auch bei einer Rente vor dem 65. Lebensjahr im Prinzip noch um eineFrührente
handelt, sieht man daran, daß –vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung
(Bündnis-Papier 23.1.96) – in Zukunft das generelle Rentenalter für Männer und Frauen auf 65 Jahre erhöht werden soll. Es führt natürlich überhaupt nicht und nicht einmal möglicherweise zu mehrBeschäftigung
für über Sechzigjährige, wenn heute schon massenhaft die Fünfzigjährigen und noch Jüngere aus den Betrieben gesäubert werden, sondern ganz gewiß zu mehr verbilligten Rentnern, und das ist auch genau die Absicht.Mit dem ausgemalten Szenarium von den
demographischen Risiken
des Rentensystems verwandelt der Staat seine Finanzierungssorgen des von ihm eingerichteten Rentenwesens in den Vorwurf, seine Bevölkerung weise eine verkehrte Alterszusammensetzung auf. Recht ungeniert beschweren sich da demokratische Politiker über ein Leben, das Leute führen, die nicht mehr arbeiten und der Allgemeinheit nur als Rentner zur Last fallen – und geben damit zu verstehen, daß sie ihren bisherigen Großmut, die ausrangierten Rackerer aufs Spesenkonto der Allgemeinheit zu setzen, für ziemlich übertrieben halten. Weil die einfach zu alt werden, sich im Verhältnis zu den noch Arbeitenden immer ungünstiger vermehren, also nicht gleich nach Dienstschluß, mit dem das Leben ja sowieso seinen Sinn verliert, ganz abtreten und deshalb dem Staat ebenso zu teuer sind wie die noch Tätigen, begründen die ein Arbeitsleben lang geleisteten nützlichen Dienste keineswegs mehr den Anspruch, wenigstens am Lebensabend in Ruhe gelassen zu werden: An diesen wie jenen wird das Urteil, im Prinzip unverdiente Kostgänger der Nation zu sein, durch Maßnahmen ihrer Verbilligung vollstreckt. Den zu vielen und deshalb zu teuren Alten gleichermaßen wie den zu teuren und deshalb zu wenigen Jungen wird von Staats wegen ein verringerter Lebensunterhalt zubemessen, wobei den jetzt Arbeitenden in der Neuordnung des Rentenrechts mitgeteilt wird, daß sie mit ihrem Arbeitsleben ganz bestimmt nicht mehr die bislang kodifizierten Ansprüche erwerben – an denen wird kräftig herumgekürzt – und eventuell gar keine mehr – „sicher“ ist die Rente nach allerhöchster Auskunft allenfalls noch für die derzeitige Rentnergeneration. Daß die Gerechtigkeit für Rentner, die darüber neu definiert wird, auch wirklich gerecht zu sein hat, wollte die Gewerkschaft dann eigens noch einfordern. Die IG Metall hat anläßlich der Abschaffung des vorgezogenen Altersruhegeldes für Arbeitslose einen kleinen Protesttag eingelegt, der sich überhaupt nicht gegen die künftig um mehrere Jahre verlängerten Arbeitslosenkarrieren ihrer älteren Mitglieder oder gegen die Abschläge von den ohnehin mickrigen Renten richtet, diedie Altersplanung der Rentner ins Wanken bringen
(SZ 1.4.96). Vielmehr wurde der Ohnmacht derer, die ihr praktisches Interesse nur als das Einlösen vonAnsprüchen
kennen, zu denen sie berechtigt sind, und daher zu dem Gnadenbrot, das ihnen der Staat gewährt, immer meinen, sie hätten es sich verdient, ein passendes Denkmal gesetzt: Für denVertrauensschutz
von denen wurde geworben, die sich unmittelbar vor der Abschaffung der Frühverrentung mit einer Sozialplan-Entlassung einverstanden erklärt hatten, im Vertrauen eben auf den Bestand der alten Regelung. Mit der kleinen und sogar erfolgreichenMobilisierung
für diesen Unter-Rechtstitel eines sozialverrechteten Arbeitslebens waren die Hauptsachen – Entlassung, verlängerte Arbeitslosigkeit und Rentenkürzung – erledigt und abgesegnet. - Im Bereich der Sozialhilfe ist nicht einmal dem Schein nach ein sachlicher Zusammenhang mit den Lohnnebenkosten über arbeitsplatzfressende Sozialversicherungsbeiträge herzustellen – Sozialhilfe wird nicht aus Beiträgen, sondern direkt aus Steuermitteln bezahlt. Ihre massive Kürzung tut also nicht einmal irgendwie der
Beschäftigung
gut, sondern ganz bestimmt nur dem staatlichen Steuersäckel und dem nationalen Gerechtigkeitshaushalt, der wie der materielle von den politischen Entscheidungsträgern – assistiert von einer hochsensiblen Öffentlichkeit – verwaltet wird.Wenn auch nach Auffassung von Experten der Armutsverwaltung – etwa des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes – die in der Sozialhilfereform enthaltenen
Hilfen zur Arbeit
und Androhungen von Zahlungskürzung bei Verweigerung einerzumutbaren Arbeit
praktisch belanglos sind, da es ohnehin keine Stellen für Sozialhilfeempfänger gebe, so kommt doch darin wunderschön der moralische Grundsatz der neuen deutschen Sozialpolitik zum Tragen:Wer arbeitet, muß sich immer besser stehen als derjenige, der – aus welchen Gründen auch immer – nicht arbeitet
. (Blüm, Der Spiegel 15/96) Wer essen will, soll auch dafür arbeiten, und wenn man es rückwärts liest, diktiert die Moral die rechte Tat – wer nicht arbeitet, soll in Zukunft jedenfalls weniger zu essen haben, und auch dafür sorgt schlicht eine kleine Änderung der Rechtslage: Der Alterszuschlag für über 65jährige entfällt künftig, die Sozialhilfe muß mindestens 15%Abstand
zur niedrigsten Lohngruppe einhalten, und die Anpassung der Sozialhilfezahlungen richtet sich in Zukunft nach dem Zuwachs der Nettolöhne. Die erhalten in ihrer Senkbewegung darüber einen weiteren Impuls in die gewünschte Richtung, insofern mit dem Sozialhilfeniveau ja schon so etwas wie die gesellschaftliche Untergrenze eines Einkommens vorgezeichnet wird, von dem sich leben lassen muß.Freunde der Wohltätigkeit, die die Ergebnisse sozialstaatlicher Fürsorge „vor Ort“ zu betreuen haben, merken dazu kritisch an, die neue Nettolohnbindung begründe eine Senkung der Sozialhilfe und stelle eine –
skandalöse
– Abweichung vom bisherigen Prinzip der Anpassung nach dem Bedarf dar. In der Tat, selbst das armselige Prinzip der „Bedarfsdeckung“, das alsBedarf
der Klientel nur das gelten ließ, was die Sozialämter in ihren Warenkörben jeweils vorgesehen hatten, erweist sich vor dem skeptischen Blick der staatlichen Prüfer noch als eine einzige Geldverschwendung. Die wird mit der Anbindung der Sozialhilfe an sinkende Löhne abgestellt. Dem Betroffenen bleibt es überlassen, aus der jeweiligen Geldsumme sein höchstpersönliches aktuelles „Existenzminimum“ herauszuholen und seinen Bedarf entsprechend einzurichten.Skandalös
finden die regierenden christlichen, freiheitlichen und sozialen Demokraten daran einzig den Zustand, den sie beenden. Mit moralischen Vorhaltungen lassen die sich auch dann nicht kommen, wenn sie Unterstützungen zurselbständigen Lebensführung
– d.h. in der eigenen Wohnung – für Schwerbehinderte beseitigen und diese in Heime verfrachten, weil sie dies billiger kommt. Sie handeln aufgrund einer staatlichen Notlage, also im Bewußtsein einer von Grund auf gerechten Mission: Nachdem die alte Beschäftigungslage mit den entsprechenden Zahlungen aus den erzielten Einkommen dahin ist, müssen nun die Leistungen, die auf Beschäftigung beruhen, dem Stand der Nicht-Beschäftigung angepaßt werden – vor allem die Einkommen ohne Arbeit, die aus den Beschäftigungs-Erträgen anderer finanziert werden. Denn anders kann es mit der „Beschäftigung“ nie wieder aufwärts gehen…Daß man im Bedarfsfall auch noch ganz anders könnte, deuten die Statements der mit der Materie befaßten
Sozialexperten
an, welche finden, sie hätten eineReform, behutsam und mit Augenmaß
hingekriegt und die Sozialhilfeempfänger endlich von einerteilweise aufdringlichen Fürsorglichkeit des Staates
(Ulf Fink, CDU) befreit. Warum sich die Staatsmacht so weise zurückzieht und die Elendskreaturen, die sie sich geschaffen hat, sich selbst überläßt, ist kein Rätsel: Noch mehr als in der Arbeitslosenversicherung gilt im Bereich der Sozialhilfe, daß diese nicht mehr nur einem relativ geringen Anteil der Bevölkerung für kurze Zeit das Überleben bis zur nächsten wachstumsdienlichen Verwendung das Überleben sichern soll. Die Sozialhilfe hat sich vielmehr zu dem großen Auffangbecken für einen wachsenden unnützen Bodensatz der Gesellschaft entwickelt, der nicht nur aus der gewöhnlichen tätigen Armut des Arbeitslebens herausgefallen ist, sondern auch aus sämtlichen sonstigen sozialstaatlichenAnspruchs
-Systemen. DerAbschied
von dem Gesichtspunkt dersozialen Wartehalle
(SZ 1.3.96) ist für diejenigen, für die dieWartehalle
zur Endstation geworden ist, also auch dann mit der Vergrößerung ihrer dauerhaften Armut verbunden, wenn diese nichts zur berühmtenSenkung der Lohnnebenkosten
für mehrBeschäftigung
beiträgt. An ihnen spart der Staat gerade, weil für die Masse der kostenverursachenden Sozialhilfebezieher eine Rückkehr in eine wachstumsförderliche Beschäftigung nicht erwartet wird – und die Verausgabung von Geld zur Pflege dieses toten Gewichts der Gesellschaft nichts anderes mehr als nutzlose Almosen darstellt.
3.
Nicht durch staatliche Lohndiktate
oder ein höchstförmliches Außerverkehrziehen der Koalitionsfreiheit, sondern allein durch die zweckmäßige Handhabung der Rechtsverhältnisse, die er zwischen sich und den Klassen gestiftet hat, verbilligt der Staat den Preis, der individuell wie kollektiv im Standort Deutschland zukünftig für Arbeit zu entrichten ist. Weil er gar nicht nur als Arbeitgeber seines öffentlichen Dienstes, sondern in den diversen Formen seiner sozialstaatlichen Verfassung längst als „Faktor“ bei der Bestimmung der nationalen Lohnsumme eine gewichtige Rolle spielt, schlagen sich die diversen Maßnahmen im Sozialstaat unmittelbar im Preis der Arbeit nieder – als dessen Definition von Staats wegen, die daher gerechterweise allein zwischen den Agenten der Staatsmacht, in der munteren wie vorwärtstreibenden Konkurrenz von Gesetzesvorlagen und Kabinettsbeschlüssen oder im Hin und Her zwischen Bundestag und Länderkammer abgewickelt wird. Daß dabei gleich einer ganzen Klasse eine neue Lebensgrundlage serviert wird und recht viele schlagartig mit einer Lage
vertraut gemacht werden, von der sie sich bis gestern nichts haben träumen lassen, ist kein Verstoß gegen die soziale Gerechtigkeit
, sondern der neue Inhalt, der ihr verliehen wird. Die leitet sich ja nach wie vor und ausschließlich aus der Funktion ab, die die für die Produktion des Reichtums Vorgesehenen zu verrichten haben, und wenn Wachstum
und Wettbewerb
, von deren Erfolg alles abhängt, es nunmehr gebieten, Kosten
zu senken, dann bleibt der Staat seinem Maßstab ganz treu und ist nach wie vor sehr sozial, wenn er seiner arbeitenden Gesellschaft die dafür nötigen Formen ihrer Dienst- und Brauchbarkeit aufzwingt. Nichts als sozial höchst gerecht ist es daher auch, wenn der Staat sein kleinliches Ausgabenregime bei den unproduktiven Kosten der Armut mit einer gewisse Großzügigkeit denen gegenüber kontrastiert, die nun einmal für das Herstellen von Wachstum
exklusiv zuständig sind. In den diversen Steuererleichterungen für Unternehmen, mit denen die Regierung in der anderen Abteilung der Klassengesellschaft auf Beschäftigung
hinwirkt, findet kein Rückfall auf Kapitalismus pur
oder einen Klassenstaat
statt. Erstens fand auch im späten
und sozialen
Kapitalismus des Standorts Deutschland noch nie etwas anderes statt als eben Kapitalismus. Zweitens macht nicht ein Wegfall von sozialer Gesinnung bei den Regierenden den Übergang zu einem Klassenstaat
aus – bei dem dann die Armen
und die Reichen
die Klassen
wären –, sondern der wird gleichfalls schon länger in der feinen Differenzierung kenntlich, die er im Zuge seiner Mittelbeschaffung bei seiner Gesellschaft walten läßt. Dem Umstand, daß es sich bei dem Wachstum
, von dem er lebt, um das Wachstum des Kapitals handelt, das die Quelle allen Reichtums ist und vom Staat entsprechend respektiert wird, trägt er nämlich keineswegs erst jetzt Rechnung. Daß seine steuerlichen Erleichterungen
für die Berufsgruppe derer, die mit der Mehrung von Eigentum befaßt sind, gerade so schön mit der Pauperisierung des Restes seiner Bevölkerung einhergehen, ist kein moralischer Skandal bei der Verteilung des Reichtums, sondern logisch und zeigt nur, wie unbedingt ernst es ihm mit dem Wachstum
ist und wie genau er dabei auf die unterschiedlichen Charaktere achtet, die er in seiner Gesellschaft zu dessen Produktion eingerichtet hat.
Die staatlich ins Werk gesetzte Verarmung der Bevölkerung durch die angestrebte Senkung der „Lohnnebenkosten“, die Anpassung
von Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherungsleistungen an das verringerte Beitragsaufkommen und die der Armenpflege an die dauerhaft entfallene Verwendbarkeit der bereits pauperisierten Bevölkerungsteile, sollen sich nach Auffassung der politischen Führung auch dann als unverzichtbare Maßnahmen zur Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit
des deutschen Standorts verstehen, wenn der Eintritt von Beschäftigungseffekten
nicht nur ungewiß ist, sondern ganz bestimmt nicht stattfinden wird. Auf den Titel einer Beschäftigungsförderung
für ihre Maßnahmen zur Lohnsenkung am Standort mag die politische Führung gleichwohl nicht verzichten. Noch möchte sie das Bündnis für Arbeit mit Wirtschaft und Gewerkschaften fortführen
(Kohl im Bundestag, SZ 27./28.4.96), weil sie die mit ihm einhergehende Ideologie von der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als generellen Berufungsgrund für die Notwendigkeit von sozialen Grausamkeiten
nicht missen will. Zudem sind ja auch schon aus der Kooperation der Partner konstruktive Beiträge erwachsen, die sich sehen lassen können.
III. Die restliche Abwicklung des politischen Auftrags durch die Standesvertretungen für Wachstum im deutschen Standort
Leider sind die aufgeblasenen Lohnnebenkosten nicht das einzige Hindernis für „die Beschäftigung“: Bei genauer Durchsicht des deutschen Arbeitslebens stellt sich heraus, daß das ganze Tarifsystem, die Arbeitszeitordnung und sonstiges Arbeitsrecht von einer maßlosen Überteuerung der Arbeit zeugen. Bei der bloßen Feststellung dieser skandalösen Fehlentwicklung des Standorts bleibt es freilich nicht. Daß die scharfe Kalkulation derer, die die Arbeitsplätze hinstellen, ohne praktische Korrekturen, die die Verantwortlichen zu leisten haben, nie im Leben aufgeht, versteht sich ohnehin von selbst. Daß sich auch die Interessenvertretung der deutschen Arbeiter dem Vorwurf, von ihrer Koalitionsfreiheit und Vertretungsmacht im Laufe der Vergangenheit verkehrt Gebrauch gemacht zu haben, überhaupt nicht verschließen, ist so selbstverständlich nicht. Von selbst versteht sich das nur für eine Standesorganisation, die sich vom Standort-Imperativ der Lohnsenkung von oben an nationale Pflichten erinnern läßt, die sie ohnehin anerkennt.
1.
Neben dem Sozialstaat, der zur standortpflegerischen Lohnsenkung nicht abgeschafft, sondern als Hebel im gewünschten Sinn funktionalisiert wird, erweist sich auch die zweite Einrichtung für denselben Zweck als sehr brauchbar, die sich der Staat zur Findung des nationalen Lohnniveaus eingerichtet hat. Von den zum Ausgleich der Interessensgegensätze zwischen Kapital und Arbeit
den Kontrahenten gewährten Freiheiten und Rechte, den Lohn im Wege einer vertraglichen Einigung zu vereinbaren, wurde ja schon immer so Gebrauch gemacht, wie sie ihrem Zweck nach gedacht waren, nämlich die Kollision der beteiligten Interessen sozialfriedlich
abzuwickeln und darüber den dauerhaften Dienst am Wachstum
sicherzustellen: Weder mit einer angedrohten Aufkündigung des „Lohnarbeitsverhältnisses“ noch mit einem irgendwie ernstgemeinten Entschluß, den mit dem Lohn hergestellten Ausschluß vom produzierten Reichtum zu eigenen Gunsten revidieren zu wollen, waren die Rechtereien um Lohnprozente jemals zu verwechseln. Wenn jetzt von politischer Seite bezüglich des nationalen Lohnniveaus nicht nur ein Korrekturbedarf nach unten geäußert wird, sondern mit Verweis auf die Wettbewerbslage des Standorts als unbedingtes Muß dekretiert und vom Staat – soweit es in seinen Händen liegt – auch gleich exekutiert wird, dann ist dies die Klarstellung, daß fortan alle im Standort an der Lohnfindung beteiligten Einrichtungen an diesem nationalen Interesse und an nichts anderem Maß zu nehmen haben. Das entspricht naturgemäß ganz dem Interesse, das eine der beiden Tarifparteien am Lohn von Haus aus hat – und definiert der anderen den Inhalt vor, auf den die ihr gewährte Freiheit der Tarifgestaltung hinauszulaufen hat: Vom Recht, das ihr keineswegs entzogen wird, hat sie so Gebrauch zu machen, wie das nationale Interesse es gebietet, also alle in ihrem Verantwortungsbereich liegenden Maßnahmen der Lohnsenkung – individuell und die Klasse insgesamt betreffend – zu ergreifen. Und so, wie die Korporation der deutschen Arbeiterschaft schon immer ihrem Auftrag nachgekommen ist und die Höhe des Lohns für die Beschäftigten in nationaler Verantwortung austariert hat, so zeigt sie auch jetzt, wie sehr sie auf das Gelingen aller Vorhaben fixiert ist, die die politischen Verwalter des Standorts für unabdingbar halten: Sie macht von den politischen Vorgaben auf ihre Weise Gebrauch.
So ließen schon die ersten Willenserklärungen der Gewerkschaft zur Ausgestaltung des Bündnis für Arbeit
erkennen, daß die angebotene Zusammenarbeit mit den Kapitalisten-Verbänden durchaus der Bekämpfung beschäftigungshemmender Löhne gewidmet war – hatte die IG Metall doch schon voriges Jahr, im Vorfeld ihrer epochemachenden Bündnisidee, eingeräumt, sie müsse sehr viel kooperativer sowohl zur Politik als auch zu den Arbeitgebern werden, weil die gesamte Gesellschaft enger zusammenrücken wird.
(IG Metall-Bevollmächtigter Mehrens, Frankfurter Rundschau 24.7.95) DGB-Chef Schulte verkündete denn auch nach dem ersten Treffen beim Kanzler froh, alle seien sich in den grundsätzlichen Zielen einig
(SZ 25.1.96), und: Jetzt kann es auch zwischen den Tarifpartnern richtig losgehen.
Die angesprochenen Partner von der Arbeitgeberseite hatten inzwischen ihr anfängliches Befremden zurückgestellt und gaben mit der Forderung nach einem grundsätzlichen Kurswechsel in der Tarifpolitik
(FAZ 8.1.96) kund, wie sie sich die Kooperation dachten. Getreu den Anregungen der Bündnisparteien beim Bundeskanzler solle sich der Lohn in Zukunft mehr an der internationalen Konkurrenzlage der jeweiligen Branche orientieren
; nötig wären Öffnungsklauseln in Tarifverträgen
, untertarifliche Einstiegslöhne für Arbeitslose
, neue Arbeitszeitregelungen
, Kürzung der Lohnfortzahlung bei Krankheit, befristete Arbeitsverhältnisse mit Verlängerungsmöglichkeiten (Kettenverträge
), Freigabe des Samstags als Regelarbeitstag ohne Zuschläge; wünschenswert wäre überhaupt eine Umstellung der Löhne auf ein neues Konzept gemäß dem Murmannschen Säulenlohn
, mit tariflichem Mindestentgelt
, gewinnabhängigem Weihnachtsgeld und leistungsabhängiger Sonderzulage.
Der größte Teil der Vorschläge stammt aus dem pragmatischen Gesamtkonzept des BDI für das Bündnis für Arbeit
(SZ 16.1.96), das die Anregungen
des vom DGB mitunterzeichneten Bündnispapiers fortentwickelt und das der DGB auch nicht rundweg ablehnen
mochte (FR 17.1.96), und zwar ganz zurecht. Denn erstens sind bereits weite Teile der Unternehmerforderungen wie die Lohnzurückhaltung
der Gewerkschaften, flexibilisierte Arbeitszeiten, verlängerte Maschinenlaufzeiten, Öffnungsklauseln und untertarifliche Bezahlung ohnehin in allen Ecken der Republik Wirklichkeit und bedürfen nur hie und da der tarifrechtlichen Bestätigung – wenn nicht Tarifverträge ohnehin noch nicht einmal ignoriert
werden (Muhrmann), wie dies im tarifpolitischen Niemandsland
(ZDF-Kommentar) Ostdeutschland der Fall ist. Und wenn die Gewerkschaft schon so viel wirtschaftspolitische Vernunft
gezeigt und die Erosion ihrer großen Errungenschaft einer flächendeckenden tarifvertraglichen Bindung der Arbeitgeber selbst schon so weit mitgetragen hat, ist es zweitens nur konsequent, sich als kooperativer Partner
bei der konsequenten Weiterführung des Projektes angesprochen zu fühlen, die restlichen, einer freien Verfügung des Kapitals über möglichst billige Arbeit noch entgegenstehenden tarifvertraglichen Hindernisse wegzuräumen.
Freilich: Es ist schon ein Widerspruch, die Verhandlungsmacht, die man als Vertreter der Arbeitnehmerinteressen
besitzt, ausgerechnet darauf verwenden zu wollen, die Schranken zu beseitigen, die man selbst dem Interesse der Gegenseite gezogen hatte – nur weil die nunmehr an so gut wie jeder Vereinbarung eine für sie unerträgliche Beschränkung entdeckt, zu der sie sich in der Vergangenheit unnötigerweise herbeigelassen hätte. Und einer Gewerkschaft, die sich als Gegenmacht gar nicht mehr aufbauen will, weil ihre eigene Einsicht in alle Notwendigkeiten einer durch nichts beschränkten rentablen
Benutzung der Arbeit in so ziemlich denselben Freiheiten resümiert, die die Vertreter des Geschäftsinteresses als ihr gutes Recht reklamieren – der wird dann eben auch irgendwann praktisch mitgeteilt, daß man sie als Partner
nicht einmal mehr wegen ihrer Unterschrift braucht.
2.
Nach einigem Hin und Her zwischen den Tarifparteien, in dessen Verlauf die Verhandlungen weitgehend auf regionale Ebene verlegt wurden, mit weiteren Lohnsenkungsforderungen der Arbeitgeber – …Senkung der Arbeitskosten um 20 Prozent
(Gesamtmetall-Stumpfe, SZ 8.3.96), …künftig ohne Aufgeld eine Stunde länger arbeiten, …Urlaub für Familienfeiern und Umzug streichen,,…Weihnachts- und Urlaubsgeld kürzen, ebenso unbedingt die Lohnfortzahlung…
(BDA-Murmann, SZ 11.3.96), …drei Nullrunden im öffentlichen Dienst und in der Metallindustrie einlegen…
(DIHT-Stihl, SZ 29.4.96) –, Drohungen an die Adresse der Gewerkschaften, daß bei einer Sechs-Prozentforderung (in der nächsten Tarifrunde) das Bündnis erledigt
sei und die Metallarbeitgeber aus dem Flächentarifvertrag aussteigen würden sowie Gegendrohungen der IG Metall mit Streik und Chaos
(Zwickel) und Warnungen vor einem Häuserkampf von Betrieb zu Betrieb
(Blüm), setzte sich im Laufe des März bei Politikern und Tarifparteien eine gespaltene Auffassung in Sachen Bündnis für Arbeit
durch: Gesamtmetall-Boß Stumpfe erklärte das Bündnis für Arbeit, so wie es die IG Metall vorgeschlagen hat
, für tot
(AZ 21.3.96). Dem schloß sich DIHT-Präsident Stihl an, ebenso Wirtschaftsminister Rexrodt mit dem Hinweis, man könne keine Arbeitsplätze auf Befehl von oben schaffen
und solle statt eines Bündnisses für Arbeit tausende von Allianzen für Vernunft und Augenmaß zwischen den Tarifpartnern
schließen. BDI-Henkel vermutete, das Bündnis sei bald
tot, Lambsdorff, FDP, dagegen hielt den Exitus schon für eingetreten, bekannte sich
aber zu der Leiche (SZ 22.3.96).
Die Verbreiter dieser Todesnachricht haben mit dem Hinweis, sie seien weder willens noch in der Lage, als Eigenleistung für die diversen Formen der Lohnsenkung die Schaffung von Arbeitsplätzen verbindlich zuzusagen, für keine der beteiligten Parteien etwas Neues mitgeteilt. Sie haben die von Regierung und Gewerkschaften gemeinsam gepflegte Ideologie des titulierten Bündniszweckes nur einmal mehr mit ihrem ökonomischen „Realismus“ konfrontiert, weil sie offenbar mit dem Umfang ihrer politischen Entschränkung unzufrieden waren und nicht länger einsehen mochten, warum das alles und mehr, das der Standort unstreitig sowieso braucht und deshalb – ebenso unstreitig – bekommen soll, im Rahmen eines vertragsähnlichen Bündnisses
, also verbunden mit dem Schein der Gegenleistung und einem Mitspracherecht der Gewerkschaft dem Kapital immer erst noch zugestanden werden soll – wo es angesichts der Unabweisbarkeit der fälligen Maßnahmen doch nur zu fordern hat.
Stumpfe stellte daher im Zusammenhang mit der Absage an das Bündnis
klar, daß die Metallindustrie zur Halbierung der Zahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2000 mit Sicherheit keinen Beitrag leisten könne
(SZ 21.3.96), und dementierte damit ausdrücklich die frühere Zielvorgabe
. Seine selbstbewußte Mitteilung, daß die IG Metall ihren angebotenen Beitrag zur Verbilligung der nationalen Arbeit abliefern, ansonsten aber nicht stören, sondern die Schnauze halten solle, wurde unterstrichen durch die Ankündigung, einen zweiten, nicht tarifgebundenen Arbeitgeberverband im Metallgewerbe zu gründen. Dessen Mitgliedsfirmen wären dann nicht mehr an Tarifverhandlungen beteiligt und an Tarifverträge nicht gebunden. Sie könnten dann einzelvertraglich oder auf Betriebsebene die Arbeitsbedingungen aushandeln, unter Berücksichtigung der aktuellen Lage am Standort, wonach nicht Lohn oder Freizeit, sondern ein Arbeitsplatz der wichtigste Besitzstand
(Stumpfe) sei.
Die Tarifbindung dieser künftigen Tarifaußenseiter
durch die im Tarifvertragsgesetz (§ 5 TVG) vorgesehene „Allgemeinverbindlich-Erklärung“ kann ohnehin nur erfolgen, wenn die – noch – tarifgebundenen Arbeitgeber mindestens 50% der unter den Geltungsbereich der Tarifvertrages fallenden Arbeitnehmer beschäftigen und im sog. „Tarifausschuß“ – drei zu drei paritätisch mit Arbeitgebern und Gewerkschaften besetzt – eine Mehrheit für die Allgemeinverbindlichkeit zustande kommt.
Alle Freiheiten des alten Tarifvertragswesens, bei dem die Betriebe während der Vertragslaufzeit an den Anwendungsbedingungen der zum Festpreis gekauften Arbeitskraft drehen konnten, nehmen sich natürlich als schiere Knebelung aus, wenn man gleiche und mehr Leistung gegen rapide sinkenden Lohn bekommen kann und der Hinweis auf die billigeren Konkurrenten und drohende Entlassungen wöchentlich neu überkommene Einkommensbestandteile als unerträgliche Belastung der Betriebe auf den Kostenprüfstand stellt. Weil also flächendeckende Tarifverträge angesichts der aktuell sich bietenden vielfältigen Gelegenheiten auf dem „Markt“ für Lohnarbeit den Metallarbeitgebern als zu teures Hindernis erscheinen, möchten sie eher auf den angeblich durch die Flächentarifverträge sehr teuer erkauften sozialen Frieden
verzichten und wählen kühl lieber ein bißchen weniger sozialen Frieden
(Stumpfe, SZ 23.3.96) – den Zwickel gerade noch als Standortvorteil
preist. (SZ 1.4.96) Der Mann geht davon aus, daß er in seiner Angeberei nicht blamiert wird. Er ist sich erstens sicher, daß aus dem Lager der Lohnarbeit kein Gegner antritt, der soziale Friede also nicht in Frage steht und die Drohung
der IG Metall mit Streik und Chaos
nichts weiter ist als die Pose eines verantwortungsbewußten Gewerkschaftsnationalisten, der mit solchen Sprüchen um seine weitere Anerkennung als Verhandlungspartner ringt. Und seine Sicherheit bezieht er zweitens aus all den praktischen Fortschritten, die gemäß der Maxime der IG-Metall – Auch wenn Gesamtmetall sich nicht auf unsere Vorschläge einläßt: die IG Metall wird alles dafür tun, damit das Bündnis gelingt
– dieser nationale Schulterschluß im Kampf gegen den Lohn bereits hervorgebracht hat.
3.
In der Chemieindustrie wurde rückwirkend zum 1. März ein Tarifvertrag mit dem schönen Titel Solidarpakt für Standort- und Beschäftigungssicherung
abgeschlossen, ähnlich in der Textil- und -Stahlindustrie und bei der Bahn-AG. Zu dem vermerkt ein Weltblatt zur Abwechslung mal vom Standpunkt der Gerechtigkeit: Die Beschäftigen werden mit zwei Lohnprozenten abgespeist, obwohl BASF, Hoechst und Bayer in den vergangenen fünf Jahren Pro-Kopf-Umsatzsteigerungen von 25 bis 30 Prozent erzielten…
und dieses Jahr die Aktionäre der Großchemie 40 Prozent mehr Dividende kassieren
(SZ 30./31.3.96) – zum Ausgleich soll
der Personalstand zwischen 1. Juli 1996 und 28. Februar 1997 gehalten
werden. Ziemlich unbeeindruckt davon, daß die Pro-Kopf-Umsatzsteigerungen der drei Großfirmen natürlich auch durch Personalkostensenkungen um 20000 Beschäftigte
in den letzten fünf Jahren erzielt wurden, setzt die Gewerkschaft mit ihrem Tarifabschluß auf weitere Lohnkostensenkungen und den Abbau von Überstundenvergütungen als Mittel der Beschäftigungsförderung
.
Das Bündnis für Arbeit
in der Textilindustrie zeichnet sich durch eine „Lohnerhöhung“ von 1,5% und eine Öffnungsklausel bei Entlohnung und Arbeitszeit
aus, die es einzelnen Unternehmen erlaubt, in schwieriger Lage
befristet von den Bestimmungen des Tarifvertrages abzuweichen. Eine ähnliche Öffnungsklausel wurde in der Stahlindustrie vereinbart. Eine Öffnungsklausel für Arbeiter in schwieriger Lage ist nicht vorgesehen. Sie bleiben schon durch den Flächentarifvertrag gebunden, was als Vorbild für die künftige Entwicklung des Flächentarifs gelten kann.
(SZ 29.3.96)
Daß man mit der Gewerkschaft erreichen kann, was Gesamtmetall anstrebt, ohne das Bündnis
totzusagen, ohne also die sinnstiftende Ideologie der ganzen Lohnsenkungskampagne offiziell aus dem Verkehr zu ziehen und gleich noch den Flächentarif auf den Müllhaufen der Tarifgeschichte zu werfen, zeigen all diese Abschlüsse. Die IGM-Gewerkschafter z.B. „hoffen, daß in den nächsten zwei Jahren betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden können. Der Stellenabbau wird weitergehen, sagen die Arbeitgeber...“ (SZ 30./31.3.96). Eine Methode, bei ebenfalls weitergehendem Personalabbau
(Bahn-Chef Dürr) in einem Jahr durch einen weiteren Beschäftigungspakt
(jubelnd die SZ, ebd.) 13.000 Arbeitsplätze zu retten
, hat die Bahn-AG zusammen mit den Eisenbahngewerkschaften gefunden: Das Unternehmen hatte im Februar schon die Entlassung von 20000 Leuten angekündigt, setzt tatsächlich aber – wg. Beschäftigungspakt! – nur
ca. 7000 an die Luft – und schon sind 13000 Arbeitsplätze gerettet
.
Ihre eigene, tatkräftige Mitwirkung bei der Umsetzung der neuen politischen Geschäftsbedingungen für die Arbeit in den Betrieben sehen die Gewerkschaften allerdings nicht immer ausreichend gewürdigt. Ausgehend von dem Wunsch nach mehr Arbeitsplätzen für ihre Mitglieder, die – selbstverständlich – rentabel
zu sein haben, machen sich die Bündnis
-Erfinder zusammen mit den Unternehmern an die Durchsetzung neuer Kalkulationsbedingungen, die die Rentabilität der Arbeit immer erst herstellen müssen, und sind so als alternative Rationalisierungskünstler einmal mehr ganz auf der Seite der kapitalistischen Anforderungen an die Arbeit gelandet, die sie den Arbeitern – darin gar nicht alternativ – als einzige Chance verkaufen. Manchmal können sie mit ausgeklügelten Arbeitszeitmodellen
und Verrechnungskunststücken auf Arbeitszeitkonten
bei einzelnen Betrieben landen. Im allgemeinen werden aber solch übermäßig intelligente Lösungen
von der Gegenseite nicht übermäßig geschätzt. Kapitalisten richten sich ihre Betriebe auf Grundlage der neuen politisch eingeräumten Freiheiten lieber selbst ein, und ihre Rationalisierungsanforderungen an die Arbeit bestechen durch den schlichten Grundsatz, daß sie länger, schneller, jederzeit verfügbar und billiger stattfinden soll, und das alles natürlich gleichzeitig. Und wo die Botschaften des Bündnisses für Arbeit
von der grundsätzlichen Unverträglichkeit von Lohnzahlung und Arbeitsplatzsicherheit und von der Alternativlosigkeit der Unterwerfung unter die Ansprüche des Betriebs so gründlich gesellschaftliches Allgemeingut geworden sind, da erscheint nicht immer, aber immer öfter sogar noch der gewerkschaftliche Gestus vom Geben und Nehmen
(Schösser, DGB) als störend: Der politische Auftrag wird ganz zurecht als Freibrief verstanden, die notwendigen Korrekturen ohne Rücksicht auf geltende tarifrechtliche Vereinbarungen und offen gegen die bislang herrschende Rechtsauffassung, es gäbe da überhaupt etwas, worüber mit einem Tarifpartner zu verhandeln wäre, durchzuziehen. Und so lebt das Bündnis
dann:
„Riester (IG Metall): Das Bündnis ist nicht tot, in den Betrieben lebt es weiter. Und nur dort kann es realisiert werden.
Spiegel: Aber nicht immer so, wie Sie sich das vorstellen.
Riester: Natürlich nicht. Aber wir können die Betriebsräte nicht anweisen: Ihr macht das so und nicht anders. Die sind von den Belegschaften gewählt…“ (Der Spiegel 16/96)
Eine erfreut zustimmende Öffentlichkeit wird u.a. mit folgenden beschäftigungssichernden Bündnissen versorgt:
„Gegen die Rückkehr zur 39-Stunden-Woche einschließlich zwei Stunden ohne Lohn, Streichung aller übertariflichen Leistungen sowie Halbierung sämtlicher Schicht- und Feiertagszuschläge gibt das Unternehmen sämtlichen Mitarbeitern … eine Beschäftigungsgarantie bis zum Jahr 2000. Ohne nähere Prüfung“ – das ist der Einwand! – „übernahm die Betriebsratsmehrheit die Version der Geschäftsleitung, es müßten 400 Arbeitnehmer entlassen werden, wenn nicht 30 Millionen Mark pro Jahr an Personalkosten eingespart würden.“ (FR 6.5.96, in einem Bericht über Burda)
Wer nicht unterschreibt, wird mit Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche ohne Lohnausgleich bestraft, und IG-Medien-Chef Hensche nimmt das Ergebnis seiner unterlassenen Gegenwehr – demnächst beschreitet er den Rechtsweg – entsetzt als einen Verstoß gegen die Sitten des lauteren Wettbewerbs unter Kapitalisten zur Kenntnis:
„…nacktes Sozialdumping mit der Folge, daß Belegschaften anderer Betriebe gleichen Pressionsversuchen ausgesetzt sind und umgekehrt Burda mit Wettbewerbsvorteilen am Markt konkurrieren kann, die andere nicht haben.“ (Ebd.)
Im Falle der Heizkessel-Firma Viessmann hatte die Betriebsleitung ihre Belegschaft mit der Drohung, ansonsten einen Teil der Produktion ins billigere Tschechien zu verlegen, vor die „Wahl“ gestellt, künftig unentgeltlich drei Wochenstunden mehr zu arbeiten oder tendenziell den Job zu verlieren – Sie müssen entscheiden, wo künftig Arbeitsplätze entstehen sollen: in Deutschland oder in Tschechien
(Viessmann-Brief an die Belegschaft). Der Betriebsrat, auf dessen Anregung das Mehrarbeitsangebot zur Abwendung der Betriebsverlegung zurückging, und die Belegschaft legten Wert darauf, das mit jedem einzelnen Belegschaftsmitglied einzelvertraglich und ausdrücklich unter diesem Titel abgeschlossene Bündnis für Arbeit
ohne jede Beteiligung der vom Fabrikherrn nicht erwünschten IG Metall abzuschließen, die hinterher klagte: Auch die IG Metall war zu Zugeständnissen bereit, aber es redete keiner mit ihr.
(Der Spiegel 15/96)
Aber auch dort, wo mit ihnen geredet wird – wie noch in der Bauindustrie –, interessiert sich für das unter Einsatz eines Schlichters in wochenlangen Verhandlungen vereinbarte Tarifabkommen einer 1,8-prozentigen „Lohnerhöhung“ und einer Senkung des bisherigen Mindestlohnes praktisch eigentlich kein Schwein:
„Bei den Bauunternehmen im Osten ist es nämlich inzwischen gang und gäbe, die Tarifverträge zu unterlaufen, Stundenlöhne von 13 Mark sind an der Tagesordnung. … So offenbart die mühsame Bauschlichtung das Kuriosum, daß die Billigkonkurrenten im eigenen Lande ein fast ebenso großes Problem sind wie die ausländischen Subunternehmer, die ihre EU-Werker mit fünf bis zehn Mark Stundenlohn abspeisen.“ (SZ 12.4.96)
Damit das auch so bleibt, hat sich inzwischen die Arbeitgeberseite entschlossen, dem tarifvertraglich gesenkten Mindestlohn im Tarifausschuß beim Arbeitsministerium die für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung notwendige Zustimmung zu verweigern, weil er doch noch immer so unverantwortlich hoch ist. Damit bleibt zugleich das von der Bundesregierung projektierte „Entsendegesetz“ gegen Billigstlöhner auf dem Bau blockiert.
Mit oder ohne eigene Mitgestaltung der vielen Bündnisse
zeigen also die deutschen Gewerkschaften, wozu sie taugen. Ihr vorbildlicher Einsatz für Beschäftigung
wirkt mit bei der gewünschten Durchlöcherung aller eingerichteten Bräuche und Verfahren, die im Standort Deutschland den Lohn auf seine für unerträglich befundene Höhe gehievt hatten – und zieht darüber alle Schranken aus dem Verkehr, die das eingerichtete Tarifwesen gegenüber dem kapitalistischen Zugriff auf die Arbeit gezogen hatte.
Doch auch einem Verein zur nationalen Lohnfindung, der auf seine verantwortliche Funktion so versessen ist, daß er auch noch den allmählichen Entzug seiner Geschäftsgrundlagen mitgestalten
will; der daneben die Opfer seiner Machenschaften Arm in Arm mit den anderen öffentlich-rechtlich anerkannten Apologeten des Elends mit einer Sozialcharta
bedenkt und gegen die Schwarzarbeit
im Standort kämpft, weil er die nicht für einen Ausdruck von Not, sondern wegen verweigerter Zahlungen für die sozialen Kassen für so etwas wie einen Sozialklau
von unten hält – auch diesem Haufen ist womöglich noch ein Streik
zuzutrauen. Aus nationaler Verantwortung natürlich, als Demonstration gewissermaßen, daß solche Scheißvereine sogar dann noch meinen, für das Gemeinwesen und den Staat unentbehrlich zu sein, wenn der gerade unterwegs ist, ihnen alle Formen zu untergraben, in denen sie ihren Vereinszweck wahrnehmen.
***
Es gibt auch einige, die mit der Linie ihrer Gewerkschaft nicht einverstanden sind und das bei passender Gelegenheit laut demonstrieren. Wenn sie sich allerdings unter der Parole: Generalstreik gegen Sozialabbau!
versammeln, machen sie deutlich, daß sie von dem Verein, dessen Führung sie kritisieren, einfach nicht loskommen. Auch sie haben es sich gründlich abgewöhnt, vom Lohn zu verlangen, daß er sie ernährt, wenn sie die Einrichtungen zur sozialen Betreuung der Armut als ihr Lebensmittel verteidigen. In einer Politik, die keine Zweifel daran läßt, daß für sie die Sanierung des Standorts über den Angriff auf den Lebensunterhalt seiner Insassen zu gehen hat, sehen sie nur einen Angriff auf den Sozialstaat, den sie für eine Errungenschaft des kämpferischen Einsatzes ihrer Gewerkschaft halten. Deswegen bauen sie sich unter Berufung auf die vielen sozial Schwachen
im Land mit einer Demonstration auf, die ihre Führung an ihren Auftrag erinnern soll, für soziale Gerechtigkeit
zu sorgen. Die sozialen Härten
, die die politische Offensive gegen den Lohn schafft, sind für sie der Anlaß, nach einer alternativen, eben „sozialen“ Berücksichtigung des Elends zu verlangen – und ausgerechnet dieser, in jeder Hinsicht defensiven Reaktion wollen sie dann mit dem Hinweis auf das Mittel Gewicht verleihen, mit dem eine aufgeweckte Arbeiterschaft einen Umsturz macht! Immerhin hat der radikale Gestus dieser unernsten Drohung sogar bei einigen in der gewerkschaftlichen Führungsetage Anklang gefunden, die dann das Wort „Generalstreik“ sogar in Zeitungsmeldungen einrücken ließen. Das hat die Bonner Regierung dann sehr wörtlich genommen. Nach dem Motto: Generalstreik paßt in eine Diktatur, nicht in eine Demokratie
(Blüm, SZ 17.5.96), wurde von der Gewerkschaft öffentliche Distanzierung verlangt, andernfalls sie sich ja wohl selbst aus dem demokratischen Konsens ausschließe. Das traf genau ins Herz, und seitdem überbieten sich die Angesprochenen in ihren Treueschwüren auf Demokratie und Parlamentarismus. Antreten gegen ein Parlament
, gegen demokratische Mehrheitsentscheidungen
, gar gegen eine frei gewählte Regierung
? „Nie!“, Niemals!
(DGB), kein Thema!
(ÖTV). Bei ihren Äußerungen dieses Unworts wollten die einen überhaupt nicht von einem Generalstreik gesprochen
(SZ 17.5.96) haben; andere versuchten, sich mit der Hilfskonstruktion eines Generalstreik-Charakters
ihres Protestes
aus der Affäre zu ziehen – der darin zu sehen sei, daß die nächsten Großkundgebungen während der Arbeitszeit stattfinden
. (SZ 15./16.5.96) Vollständige Entwarnung kam dann noch von einem gewerkschaftlichen Gutachten zur Einschätzung des Kräfteverhältnisses, wonach eine revolutionäre Lage in Deutschland nicht gegeben
sei – da ist der Kanzler ja gerade noch einmal davongekommen!
IV. Armut als Sachzwang und Waffe der Konkurrenz im Standort Europa
Die Klage über die Erwerbslosigkeit von Millionen, die den Staat belastet, mündet zielstrebig in die Offensive gegen den Erwerb, dessen sich die „Arbeitsplatzbesitzer“ schuldig machen. Rentable Löhne braucht das Land, um der internationalen Konkurrenz Herr zu werden, die heute „Globalisierung“ heißt. Armut ist – dafür stehen Demokraten gerne ein – keineswegs ein alle sieben mageren Jahre anstehendes „Schicksal“, eine Folge – ebenso bedauerlich wie unvermeidlich – des schleppenden Geschäftsgangs. Sie wird ausdrücklich als Waffe der Konkurrenz gehandelt, in der sich Nationen und ihre „Wirtschaft“ umtreiben. Der internationale Vergleich der Arbeitslöhne hat Hochkonjunktur, weil sich alle Nationen auf den Preis der Arbeit als Waffe verlegt haben.
Die Wachstumskrise des Kapitals haben sich die Hüter des deutschen Standorts als das Fehlen rentabler Arbeitsplätze
zurechtgelegt. Damit fassen sie ihre Diagnose zusammen, daß die Erträge der Konkurrenz auf den Märkten in Europa und im Rest der Welt für sie zu gering ausfallen, und geben zugleich kund, wo und wie sie sich den Hebel vorstellen, die Nation aus ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage zu manövrieren. Mag dies auch nur ein Faktor sein, der in die Rentabilitätsrechnung des Kapitals eingeht – sie jedenfalls sind sich ganz sicher, in den Kosten der Arbeit im Standort den Faktor ausfindig gemacht zu haben, der über Sieg und Niederlage in der Konkurrenz der Standorte entscheidet. Entsprechend rigoros und grundsätzlich nehmen sie dann auch die Wiederherstellung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit in die Hand, und behandeln ersatzweise für die Schranken und die vielen Abhängigkeiten
, unter denen die die deutsche Wirtschaft
auf den Weltmärkten so zu leiden hat, den Erwerb im Land als Beschränkung, von der sich die Nation unbedingt freimachen muß: Pauperisierung der Arbeitenden und die Behandlung des restlichen Volkes als überzählige, abzuschreibende Masse von zu Alten, zu Kranken und zu Faulen ist der von ihnen vorgesehene und beschrittene Weg, den Standort zum Erfolg zu führen.
Ob der sich auch so einfinden wird wie gedacht, wird die Konkurrenz dann zeigen – daß er sich einzufinden hat, ist der politischen Aufsicht über den deutschen Standort jedenfalls einiges an Not seiner Insassen wert. Ein anderer Erfolg dieser Aufrüstung Deutschlands zum Billiglohnland hat sich allerdings schon eingestellt. So, wie diese Nation ihre Konkurrenzlage gegenüber anderen Standorten in Europa und anderswo definiert und sich an die Behebung der diagnostizierten Defizite an der Arbeitsfront macht, so zwingt sie diesen im Namen ihrer Wettbewerbsfähigkeit
dieselben Prinzipien ihrer Sanierung
auf. Der staatlich (nach)vollzogene internationale Vergleich der Arbeitslöhne mit seinem notorischen Verweis auf die niedrigen Arbeitskosten
jenseits der deutschen Grenzen machte einen Konkurrenzvorteil anderer Standorte beim Kampf ums Wachstum ausfindig, um das es geht; diesen entdeckten Vorteil der anderen gilt es einzuebnen – und damit eine Standortkonkurrenz um den Preis der Arbeit als Grundlage und Quelle für mehr Wachstum zu eröffnen, das die eigene Nation auf Kosten der anderen erzielt. Und wie man sieht, lassen sich die europäischen Konkurrenten Deutschlands da nicht bitten: Überall wird mit derselben Vorgabe an der Verbilligung der zu teueren (europäischen) Arbeit
gearbeitet, wird durch Lohnsenkung, Senkung der Sozialversicherungsquote, um Beschäftigung anzuregen
(El País 28.2.96), und Kürzung von Sozialleistungen unter dem Titel der Beschäftigungsförderung gegen den Lebensunterhalt der Leute vorgegangen.
Längst ad acta gelegt sind in Frankreich die im Wahlkampf der Konservativen lancierten Vorstellungen, durch den Einsatz staatlichen Kredits das Wachstum zu fördern, etwa durch zusätzliche Eingliederungshilfen für Arbeitslose ihre Anwendung wieder lohnender zu machen und so einen Ausweg aus dem Darniederliegen der nützlichen Beschäftigung zu finden. Wie ihre europäischen Kollegen hat sich die französische Regierung inzwischen überwiegend auf die kostensenkende Wirkung ihrer Sparmaßnahmen bei den Sozialleistungen geworfen. Ihre Rentenversicherung will sie vom Umlageverfahren auf ein Kapitaldeckungsverfahren umstellen, möchte künftig also offenbar nicht mehr den Generationenvertrag
, für dessen Erfüllung die Regierung mit defizitfüllenden Steuermitteln einstehen mußte, sondern die Märkte
, an denen sich die Beiträge als Kapital herumtreiben sollen, für die Finanzierung der Renten sorgen lassen und die Schulden der Kasse von ca. 56 Milliarden DM (Handelsblatt 25.4.96) durch eine neue Steuer ausgleichen. Einige vom staatlichen Sozial- und Lohnsparen betroffene und infolge der Privatisierungspläne der Regierung im Energie-, Telekommunikations- und Eisenbahnbereich von Arbeitslosigkeit bedrohte Mannschaften – vor allem im öffentlichen Dienst – hatten in einer sympathischen Aufwallung von Unmut einiges im Lande lahmgelegt. Die Regierung, die ihre Pappenheimer kennt, hat sich zunächst wochenlang hart gezeigt, um zu beweisen, wie nötig ihre Maßnahmen waren, hat dann an einigen Punkten, insbesondere bei der Altersversorgung der öffentlichen Dienste, nachgegeben. Inzwischen steht das Kassenwesen unmittelbar unter politischer Verwaltung und werden die jeweiligen Kostenrahmen auf dem Verordnungsweg erlassen – die jeweils betroffenen Stände und Berufsgruppen demonstrieren dann anschließend ein wenig Unmut.
Die Regierung in Holland verabschiedet gleich ganze Abteilungen der Sozialversicherung, die Lohnfortzahlung bzw. Krankengeldversicherung und die Berufsinvalidenversicherung, aus dem öffentlichen Versicherungswesen und läßt diese künftig von den Unternehmen bezahlen, die dadurch hübsche Rückversicherungsgeschäfte in Gang bringen und die Beiträge für die Rückversicherung von der Steuer absetzen dürfen.
In Spanien wurde im Vorfeld der Parlamentswahlen vom März von allen maßgeblichen Parteien ein „Gran Pacto“ zwischen Staat, Unternehmerschaft und Gewerkschaften zur Schaffung von Arbeitsplätzen gefordert sowie Steuersenkungen, Senkung der Staatsquote und der Sozialversicherungsbeiträge als Mittel hierzu in Aussicht genommen. Nicht versäumt wurde, die Sicherheit der Renten
zu betonen, was auch in Spanien ein schlechtes Zeichen sein dürfte.
In Italien hat gleich der übergreifende Maßstab eines für Europa tauglichen Überlebens der Nation den Umfang der für nötig erachteten Reformschritte angegeben. Die „scala mobile“, die automatische Angleichung der Löhne an die Preissteigerungsrate, ist schon seit längerem gestrichen; tarifliche Normallöhne orientieren sich nach unten an Leih- und Teilzeitarbeitern, deren Lohnniveau niedriger angesetzt ist; wer im Süden des Landes arbeitet, braucht – staatlich dekretiert – weniger Geld zum Leben, so daß der mezzogiorno nicht vergessen ist; bei schlechter Geschäftslage können Betriebe den Lohn kürzen; dem Übergang in die staatliche Arbeitslosenverwaltung sind neue Hindernisse in den Weg gelegt; bei niedrigeren Rentenbezügen ist das Rentenalter auf 65 Jahre angehoben, und das Gesundheitswesen wird gestrafft
. Dieses nationale Rettungswerk haben Politiker problemlos in der Phase hingekriegt, als ihr Land gerade regierungsunfähig
war. Und auch ein Erfolg der Gewerkschaft ist noch zu vermelden: Aus nationaler Verantwortung um das Zustandekommen dieser Regelungen haben die parteipolitisch verfeindeten Richtungsgewerkschaften zu einer neuen Einheit gefunden.
Der österreichische Staat ist eine Art institutionalisiertes Dauerbündnis für Arbeit und erledigt die vertrauensvolle Zusammenarbeit der arbeitenden Klasse mit Staat und Kapital mittels der Zwangsmitgliedschaft jedes Arbeiters und Angestellten in den Arbeiterkammern, die das Kollektivvertragsrecht an den ÖGB abgetreten haben, gleichsam als Aufgabe der inneren Verwaltung. Die geht die neugewählte Regierung mit einem Sparpaket
an, das den Österreichern die Konsolidierung des Haushalts, eine neue Offensive gegen Arbeitslosigkeit und für Österreich als Wirtschaftsstandort
androht. (SZ 18.3.96)
Die größte Begeisterung pflegen regelmäßig Spar-Nachrichten aus dem früheren sozialstaatlichen Musterland Schweden auszulösen, dessen neuer Regierungschef mit seinem harschen Sparkurs
(SZ 23./24.3.96) voll auf gesamteuropäischer Linie liegt. Er gibt ein schönes Beispiel dafür, daß ein Übermaß an Sozialstaat keinem Arbeitsmarkt, keiner Konkurrenzfähigkeit, keinem Staatshaushalt und letztlich auch keinem Schweden guttut, weil man ihn ihm am Ende doch wieder wegnehmen muß.
England ist schon dort, wo die anderen unbedingt hinwollen: Das Lohnniveau ist schon seit längerem
„insbesondere im Vergleich zu Deutschland niedrig… Arbeitsverhältnisse – viel flexibler als in Deutschland – sind relativ leicht zu kündigen… Gewerkschaften leichter in Schach zu halten … das allgemeine Niveau von Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Gesundheitswesen ohnehin niedriger als in Deutschland… Unter dem Strich ist England dadurch“ – dadurch! – „zu einem der attraktivsten Standorte Europas geworden.“ (Handelsblatt 25.4.96)
Also, Völker, hört die Signale: Nichts wie hin!
[*] Dieser Artikel setzt Klarstellungen fort, um die sich unsere Zeitschrift in ihren Berichten aus dem „Alltag im Klassenstaat“ in GegenStandpunkt 1-95, S.65 und GegenStandpunkt 3-95, S.87 bemüht hat.