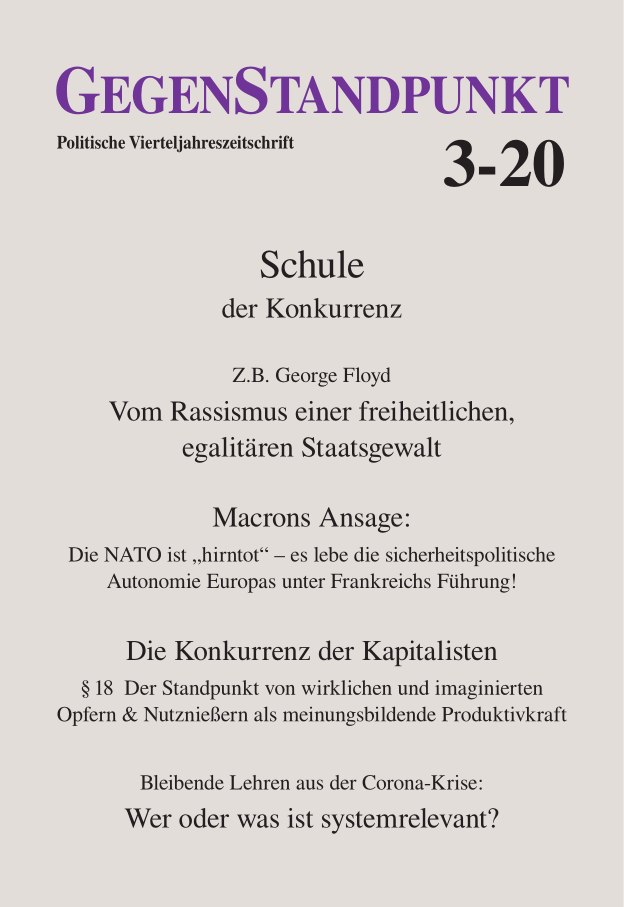Schule der Konkurrenz
Zahllose Bildungs- und Lehrplanreformen hin, PISA-Testate und Schulevaluierungen her, so richtig zufrieden ist die ‚Wissensgesellschaft‘ mit ihrem hochgeschätzten Schulwesen darüber nicht geworden – im Gegenteil. Die Schule ist, gerade weil man den von ihr eröffneten „Bildungschancen“ enorme Wichtigkeit zuschreibt, permanent Gegenstand von Klagen über und enttäuschten Erwartungen an sie.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Schule der Konkurrenz
Zahllose Bildungs- und Lehrplanreformen hin, PISA-Testate und Schulevaluierungen her, so richtig zufrieden ist die ‚Wissensgesellschaft‘ mit ihrem hochgeschätzten Schulwesen darüber nicht geworden – im Gegenteil. Die Schule ist, gerade weil man den von ihr eröffneten „Bildungschancen“ enorme Wichtigkeit zuschreibt, permanent Gegenstand von Klagen über und enttäuschten Erwartungen an sie.
Karrierewillige Abiturienten greifen sich z.B. an den Kopf, dass sie Gedichtinterpretationen in mehreren Sprachen verfassen müssen. Unternehmerverbände sind mit dem ‚praxisfremden‘ Output der Bildungsanstalten, den sie in ihren Betrieben nicht brauchen könnten, notorisch unzufrieden. Diesen Vorwurf wollen wiederum die Anhänger einer soliden ‚Allgemeinbildung‘ und einer Erziehung des ‚ganzen‘ Menschen nicht auf der Schule sitzen lassen, die sich von der Unternehmerlobby schon viel zu viel von ihrem Auftrag habe abkaufen lassen. Den einen ist die Schule immer ‚viel zu rückständig‘, um den akuten Erfordernissen der Gesellschaft zu genügen, den anderen läuft die Schule allzu oft ‚jedem Trend‘ hinterher. Für die einen lernen Schüler ‚immer weniger‘, für die anderen viel zu viel ‚unnötigen Wissensballast‘. Mitfühlende Pädagogen und Eltern monieren, dass Schule ‚krank macht‘, weil ihre Kinder zu hohem ‚Leistungsdruck‘ und ‚Notenstress‘ ausgesetzt werden, andere sehen eigentlich nur eine ‚Inflation guter Noten‘, die das gute, alte Abitur entwertet. Chronisch der Vorwurf, dass die Schule Bildungschancen ‚ungerecht‘ vergibt, weil der schulische Erfolg viel zu sehr am sozialen Status der Eltern hängt. Und auch der staatliche Dienstherr selbst zeigt sich unzufrieden, wenn die Schule entweder zu lange oder zu kurz dauert oder sie im internationalen Vergleich nur die mittleren Tabellenplätze belegt.
So verschieden und kontrovers die Beschwerden über das staatliche Ausbildungssystem sind – eines eint die Beschwerdeführer: Ihre Kritik entspringt einem Standpunkt zur Schule, einem privaten oder gesellschaftlich-politischen Interesse oder Ideal, was Schule und Unterricht eigentlich leisten sollten – und in der Realität immerzu schuldig blieben. Irgendwie macht es die Schule keinem recht. Auf einem ganz anderen Blatt steht, was die Schule in ihrem stinknormalen Alltag tatsächlich macht. Daraus geht ihr wirklicher Zweck klar genug hervor.
I. Lehren, um zu unterscheiden – lernen, um zu konkurrieren
1. Wer verdient wie viel Bildung?
Der moderne Staat macht mit seiner Schulpflicht für alle seine angehenden nützlichen Mitglieder die Aneignung von Kenntnissen, theoretische Bildung, gleichermaßen verbindlich. Es geht ihm um Volksbildung, und ein privates Schulwesen duldet er nur in Unterordnung unter sein Schema. Mit seiner Schulpflicht stellt der Staat klar, dass die Vermittlung von Wissen nach Inhalt, Art und Umfang eine gesellschaftliche Angelegenheit und keine Privatsache ist. Für seine und der Wirtschaft Zwecke ist ein Volk heutzutage nur dann für nützlich zu erachten, wenn es mit Wissen ausgestattet ist. Für die demokratische Klassengesellschaft steht fest, dass sie ein konkurrenztüchtig ausgebildetes Volk braucht und anwendet. Nicht fest steht jedoch, für wen wie viel Wissen notwendig ist.
Wenn Wissen und Können der Jugend nahegebracht werden, sind sie zugleich der Prüfstein dafür, wie sich der Lernende bei seiner Aneignung bewährt. Zu diesem Zweck werden all die Wissensinhalte jeweils als das Quantum Lernstoff festgelegt, als das Pensum, das in entsprechend vorgegebenen Zeitintervallen zu unterrichten und abzuprüfen bzw. aufzunehmen und zu präsentieren ist. Diese Zumessung des Wissens erstreckt sich über die gesamte Zeitschiene der Beschulung, gliedert sich also in Jahresstufen, diese in thematische Abschnitte, die meist mit den Prüfintervallen zusammenfallen.
Über die Konfrontation mit dem Lernstoff werden die Schüler auf ihre Lernfortschritte hin gemustert, über die einerseits ein sachliches Urteil zu fällen ist, nämlich als Abgleich des vorgewiesenen Wissens mit dem Soll. Dieses Urteil bildet andererseits die Grundlage dafür, es in eine Bewertung in der behördlich festgelegten Form der Notengebung zu übersetzen. Diese Bewertung quantifiziert den Lernerfolg, dokumentiert, wie viel vom Lernstoff gewusst ist, wobei für den Erwerb wie für die Präsentation des Wissens Zeitlimits gesetzt sind: Es gilt, den Stoff innerhalb einer vorgegebenen Frist zu erlernen und in der für die Prüfung abgesteckten Zeit zu beweisen, in welchem Umfang man ihn – schon oder noch – beherrscht. Somit fasst die Benotung die Wissensaneignung als Lernleistung, als geistige Anstrengung pro Zeit. Nur als solche sind die diversen Inhalte und Arten der Geistestätigkeit kommensurabel, sind sie messbare Leistung und in Notenstufen zu differenzieren. Konsequent ist, dass die bewerteten Wissensinhalte in der Notenziffer selbst verschwinden, woran auch deren Verbalisierungen von „sehr gut“ bis „ungenügend“ nichts ändern.
Der zeitliche Rahmen tut, weil immer eng bemessen, das Seine zum konstanten Leistungsdruck: Nach der Probe ist vor der Probe, mit der Einforderung mündlicher Leistungsnachweise ist in jeder Schulstunde zu rechnen. Die Lerndauer ist zwar der Qualität der geistigen Aktivität an sich so äußerlich wie die Notenziffer – was heißt es für das Wissen schon, ob man es sich schneller oder langsamer angeeignet hat? Darauf kommt es in der Schule aber sehr an. Das Lerntempo ist ein entscheidendes Kriterium, die Erpressung mit der Zeitknappheit ein maßgeblicher Hebel, die Lernenden im Sinne der schulischen Leistungsbereitschaft zu disziplinieren.
Anhand der gemessenen Lernleistung werden die Schüler miteinander verglichen. Die diversen Mängel und Lücken des Wissens, die sich auftun, wenn alle Lernenden über den Leisten des terminierten Lehrplans geschlagen werden, sind für den Lehrer und Prüfer die Materie, an der er die Bewertung der Leistungsunterschiede festmacht. Bemühungen seitens der Lehranstalt, die Lücken zu schließen, arbeiten, soweit sie – wiederum im Rahmen des zeitlichen Korsetts – stattfinden, diesem Zweck zu: Einer fundierten Leistungsmessung hat die eine oder andere insistierende Mühe des Beibringens, mitunter nach Leistungsstand differenzierten Einübens vorauszugehen, die Wissensvermittlung ist schließlich die eine Seite des Geschäfts. Aber am Ende jeder Konfrontation mit dem Stoff, spätestens im Jahres- und ganz zuletzt im Abschlusszeugnis, wird eben abgerechnet. Wo sich ergibt, dass die Bemühungen der Schule um den Lernerfolg beim Schüler nicht gefruchtet haben, kommt die Bildungsanstalt zu dem Urteil, dass die Wissenslücken, die sie produziert, den lernenden Subjekten als Defizite ihrer Leistungstauglichkeit anzulasten sind. [1]
Dieses Urteil fällt die Schule praktisch, wenn sie ihre Entscheidungen trifft und die bekannten Konsequenzen aus vergleichsweise „mangelhaften“ oder „ungenügenden“ Leistungen zieht: Der Schüler hat das Jahr zu wiederholen, die nächsthöhere Stufe des Lernens ist ihm aufs Erste verwehrt; im wiederholten Fall des Scheiterns wird er „abgeschult“, so das Fachwort dafür, ihn in die niedrigere Schulform zurückzusetzen. Wegweisend schlägt das Prinzip dieser Auslese mit der Weichenstellung nach vier Jahren Elementarstufe, mit dem heute so genannten „Grundschulabitur“ zu: Während die einen an einer Schule verbleiben, wo – höflich gesagt – kein wesentlicher Zugewinn an Wissen mehr stattfindet, steht den anderen derselbe zu. Die Volksbildung stellt somit einen Katalog der Allgemeinbildung auf, um diejenigen zu ermitteln, die einen weiterreichenden Durchgang durch diesen Katalog verdienen. Von daher ist es in diesem Bildungswesen nicht paradox, sondern nur folgerichtig, dass die Schüler, die die größeren Wissensdefizite vorweisen, genau die sind, denen man weitere Bildung „erspart“.
So organisiert dieses Schulsystem mit Noten und Zeugnissen die einer „Leistungsgesellschaft“ verpflichtete Lernkonkurrenz und entscheidet, für wen wie viel Wissen nötig ist, indem es alle dem selektiven Zirkel unterzieht, dass Leistung zu mehr Leistung berechtigt, umgekehrt umgekehrt. Das so mit der Hierarchie von Schulabschlüssen erzeugte Resultat macht offensichtlich, dass die Schule zwar unterschiedslos für alle Pflicht ist, aber eine Volksbildung im Programm hat, die man mit der Herstellung eines gebildeten Volkes nicht verwechseln sollte.
2. Der/die Fächer der geistigen Anstrengung
Die „gebildete Persönlichkeit“, auf die die Schule hinarbeitet, ist Objekt einer Leistungsmessung, die die Betätigung des Geistes im Kanon aller Schulfächer erfasst und quantifiziert. Der Lernstoff will aufgenommen und reproduziert sein, verlangt dem Schüler aber auch eigene Schlussfolgerungen und Urteile ab. Er muss sich dabei immer der doppelten Herausforderung stellen, nämlich sich auf die spezifischen Anforderungen an den Geist einlassen, wie sie im jeweiligen Fach im Vordergrund stehen, und das unter den stets sehr gleichen Bedingungen der Lernleistungskonkurrenz. Für Art und Umfang des verabreichten Wissens bleibt das nicht folgenlos:
Da sind etwa im Rechnen zuerst mechanische Fertigkeiten verlangt, es sind Automatismen zu erlernen, die helfen, Sicherheit im gleichförmigen Umgang mit dem Zahlenmaterial zu gewinnen, die Anwendung der Regeln will geübt sein. Diese Geübtheit hat allerdings nicht nur ihre sachgemäße Seite; vielmehr schlägt gerade an ihr das Kriterium Aufgabe pro Zeit zu, kaum dass man sich mit den Grundlagen der Materie vertraut macht. Wer in diesen geistigen Operationen der mechanischen Art zu langsam, d.h. langsamer als der Durchschnitt der Klassenkameraden ist, schließt sich, sollte er über dieses Fach in die Haupt-/Mittelschule hinaussortiert werden, schon an den Grundlagen des Rechnens vom weiteren Wissen über sie aus, braucht also mit der Mathematik gar nicht erst Bekanntschaft zu machen. Dass auch er im Alltag auf die Finger als Zählhilfe verzichten kann, darf die Schule sich als nachhaltig vermittelte „Voraussetzung für die Bewältigung lebensweltlicher Fragestellungen“ (Lehrplan Grundschule Mathematik) gutschreiben.
Fächer wie Biologie, Chemie oder Physik führen laut Lehrplan in „Erkenntnisse“ ein, die „maßgeblich die Gestaltung der modernen Lebenswelt prägen und für die technische und wirtschaftliche Entwicklung von grundlegender Bedeutung sind“. Auch an solcher Materie differenziert sich im Schulbetrieb schnell, wie weit die theoretische Durchdringung reichen muss: Führt die rudimentäre Bekanntschaft mit dem Naturwissen bei einigen kaum über die aufgeklärte Ahnung hinaus, dass in der Natur Gesetze obwalten, so behilft sich der Schüler aus dem Mittelfeld jener Normalverteilung mit der Merkleistung von „Beispielen“, ohne genau durchblicken zu müssen, wofür sie stehen. Wählt er die betreffenden Fächer rechtzeitig ab, braucht er sich mit dem Naturwissen gar nicht weiter zu „belasten“. Man kann es also auch in höhere Schulstufen, ja bis zum Abitur schaffen, ohne nennenswerte Naturgesetze begriffen zu haben. Letzteres schaffen wiederum wenige und erleichtern sich so den Lernerfolg.
In den Fremdsprachen sind vorderhand Anstrengungen des Gedächtnisses und die Disziplin eines zähen Übungseifers gefragt, um Vokabeln in zunehmender Menge und grammatische Formen auf Abruf zu haben und zu halten, das verlangt die Sache. In der Schule freilich liefert das Eintrichtern z.B. unregelmäßiger lateinischer Verben einen Prüfstoff der – wie dafür gemacht – selektionsträchtigen Art, was einem „Durchfall-Fach“ seinen gefürchteten Ruf beschert. Um bis zu idiomatischen Feinheiten der diversen Sprachen vorzudringen, darf einer wiederum nicht an den Hürden der gemessenen Paukleistungen hängen geblieben sein.
Die Schule hat also alle möglichen, fächerrelevanten Anstrengungen des Geistes im Programm und fordert sie heraus, aber der Fortgang zu vertiefenden Geistesleistungen ist, soweit er einer aufbauenden Systematik folgt, gekoppelt an die ausschließende Hierarchie des schulischen Leistungsbetriebs selbst und ist somit weitgehend den höheren Schularten vorbehalten. Auch auf dieser Bildungsstufe bleibt die Schule ihrem Prinzip treu: Sie eicht das Interesse des Lernenden darauf, es so zu dosieren, wie er sich das vorgegebene Quantum in der vorgegebenen Frist eintrichtern will und kann. Entwickelt er darüber hinaus oder getrennt davon ein Interesse am Lerngegenstand selbst, wird es in der Bildungsanstalt vereinnahmt – oder als wenig zielführend ausgeschieden. Jedenfalls ist es kein Zufall, dass die Schule so manchem, den sie mit dem Leistungslernen auf den jeweiligen Stufen drangsaliert, den Spaß, den das Begreifen machen kann, nachhaltig austreibt.
3. Eine intellektuelle Tüchtigkeit eigener Art
Das schulische „Leistungsprinzip“ schlägt im Nebeneinander und in der Gesamtschau der Fächer erst so richtig zu: Wie die Benotung bereits in jedem Fach sachlich inkommensurable Wissenselemente als Bestandteile der Lernleistung quantifiziert und so zu einer Bewertung verrechnet, bringt die Aufrechnung unterschiedlicher Fachnoten zu einem Notendurchschnitt diese Abstraktion konsequent auf den Punkt, wobei sie nicht nur disparateste stoffliche Kenntnisse, sondern auch die verschiedenen Arten geistiger Anstrengung zu einem Gesamtbefund zusammenwirft: zu einem Konglomerat aus Konzentrationsvermögen, Übungseifer, Gedächtnis, Kombinationsfähigkeit, Schlussfolgern, Urteilen usw.
Die Schule ist nämlich nicht zufrieden damit, dass der in den einzelnen Fächern herausgeforderte Verstand die den Inhalten jeweils angemessene Aktivität entfaltet, hier mehr memoriert, dort mehr kombiniert usw.: Weil sie scharf darauf ist, aus all den sachbezogenen Leistungen des Intellekts so etwas wie eine intellektuelle Leistungsfähigkeit zu extrahieren, konstruiert sie sich diese Fähigkeit aus jenem Aggregat geistiger Potenzen, die der Schüler an bestimmten Gegenständen und vermittels derselben erwirbt und vorzuweisen hat.
So konstruiert diese intellektuelle Tüchtigkeit eigener Art ist, so real macht die schulische Leistungsschau diese Abstraktion in ihrem Bildungsladen, und zwar nicht erst mit den Zeugnisnoten. Die Schule organisiert den Lernbetrieb selbst als Dauertest auf diese von konkretem Können abgehobene Befähigung. Die darf sich schon am „Sachzwang“ des Schultags trainieren, im Dreiviertelstundentakt die Fächer zu wechseln. Gefragt ist die Flexibilität, zwischen disparaten Geistesübungen je nach Vorgabe zu switchen, so etwas wie eine Schultauglichkeit für sich, die den Schüler darauf trimmt, Interesse und Aufmerksamkeit für den Gegenstand genau so einzuteilen, wie Stundentafel und Stundentakt es erfordern.
Zudem operationalisiert die Schule den Lernbetrieb für das Gesamturteil, auf das alles zulaufen soll, indem sie es den Lehrkräften zur Vorschrift macht, stets – also schon in jedem Fach, möglichst in jeder Prüfung für sich – so etwas wie einen Querschnitt aus diversen Anstrengungen des Geistes einzufordern. Diese „Aufgabendifferenzierung“, die der Lehrer in seiner Praxis als „Einser- und Sechser-Bremse“ handhabt, d.h. als bewährtes Instrument kennt, den Notenschnitt im üblichen Rahmen zu halten, soll im Sinne der Auflage ein Spektrum von Geistesleistungen abbilden. In diesem Spektrum definiert die Schule gemäß ihrer Vorstellung von intellektueller Leistungsfähigkeit zugleich eine Rangfolge, mit der sie in den Aufgabenstellungen schon die Selektion der Prüflinge antizipiert: „Memorieren/Reproduzieren“ sollten etliche Schüler hinkriegen, „Transfer“ und „Problemlösen“ sind etwas für die Leistungsspitzen. [2]
Freilich gilt immer: Ob der Schüler seine Leistung nun mehr mit Verständnis oder mehr mit Pauken zuwege bringt, am Ende und in der Summe schlägt sich alle Bemühung eben in einer Note nieder. Die darin vollstreckte grundsätzlich gleiche Gültigkeit von Inhalt und Art des Wissens produziert eine diesbezügliche Gleichgültigkeit aufseiten der Prüflinge, die die geforderten Geistesleistungen, so gut sie können, auf den Prüfungserfolg ausrichten und im Bedarfsfall durcheinander ersetzen: Wer die Jahreszahlen oder Vokabeln nicht im Kopf hat, kann vielleicht anderweitig punkten, vor allem aber umgekehrt: Über die Versuche, auch noch Aufgaben des Begreifens mit auswendig Gelerntem hinzubekommen, bringt es das Kurzzeitgedächtnis zu Höchstleistungen. Der Veranstalter dieses Lernbetriebs, der solche schülertypischen Berechnungen produziert, sanktioniert freilich die Haltung, sich die geforderten Lernanstrengungen möglichst zu ersparen. Schon gar nicht lässt er sich die findigen Bemühungen gefallen, den Lernerfolg zu fingieren, auch wenn oder gerade weil all die kleinen Betrugsmanöver Stilblüten seines Systems sind. Es ist nichts als der im System eingerichtete Instrumentalismus des Lernens für Noten, wo der Wissenserwerb eben Mittel der Schulkarriere ist, auf den sich die Lernenden einlassen und der an den Stätten der Bildung diese berechnende bis explizit theoriefeindliche Haltung zum Wissen erzeugt, wie sie aus dem so populären wie verkehrten Urteil spricht, dass man sich all den „bloß theoretischen Kram“ sowieso „bloß für die Prüfung“ eintrichtert. [3]
Welche Berechnungen, Vorlieben und Umgangsweisen der Schüler sich auch zurechtlegen mag: Letztlich basiert der Schulerfolg darauf, dass er es schafft, sich gemäß den Vorgaben des Lehrplans prinzipiell gleichgewichtig den Herausforderungen aller Fächer zu stellen. Wenn zum Abitur hin das eine oder andere Fach abgelegt werden darf, kommt das den – von Pädagogen gern hofierten – „individuellen Neigungen“ des Schülers insoweit entgegen, als die Bildungsanstalt ihm ein bisschen Spielraum für notentaktisches Erfolgskalkül gestattet. Wenn die Schulordnung mit dem Notenausgleich gar „individuelle Schwächen“ zugesteht, so wird derselbe eben nur gewährt, wenn die schlechte Note kraft überdurchschnittlicher Zensuren in anderen Fächern „kompensiert“ wird und der Schüler es auch in seinem schwachen Fach nicht etwa an der rechten Einstellung zur Leistung hat fehlen lassen. Somit unterstellt auch diese – auf Lehrerkonferenzen Fall für Fall lebhaft erörterte – pädagogische Konzession die Austauschbarkeit der Fachleistungen und macht klar, wie sehr es bei allem auf dasselbe hinausläuft: darauf nämlich, dass der Schüler sich als insgesamt lernfähige und leistungswillige Person beweist. [4]
Die Schule lügt also nicht, wenn sie behauptet, die „Gesamtperson“ zu beurteilen, ist es doch nichts anderes als die von ihr geschaffene Gesamtperson. So schulintern konstruiert jene „Gesamtperson“ ist, so real gültig ist die – bis auf zwei Stellen hinter dem Komma exakte – Definition ihres Werts, mit dem sie am Ende in die Konkurrenz der Berufshierarchie entlassen wird. Mit der Gesamtnote macht die Schule ihre hauseigene Abstraktion einer individuellen Befähigung schlechthin wahr. Sie will einen Wert ermittelt haben, den der Schüler sich redlich erarbeitet hat und somit gerechterweise als Person verdient. Zumal er ihr eine generelle Erfolgstüchtigkeit bescheinigt, die nicht auf die Schule beschränkt ist, sondern ihre Laufbahn prägende „Prognosekraft“ hat. Diese Prognose, zu deren Bewahrheitung die Schule selbst mit dem Abschlusszeugnis das Ihre tut, ist einfach zu haben: Man braucht nur die Leistungen des Schülers, die die Anstalt ihm auf- und abnötigt, als genau das gesamtpersönliche Leistungspotenzial zu interpretieren, das, wenn sie es „hervorholt“, in ihm drinstecken muss.
Diese Sorte ‚Rückschluss‘ auf Wert und „Eignung“ der Person hat ihre auch populäre ideologische Fassung: Die Theorie von der unterschiedlichen Begabung hat als Generalrechtfertigung der Konkurrenzergebnisse bei Eltern wie bei Pädagogikprofessoren nach wie vor ihre festen Anhänger. Auch der Lehrer hat diese Verkehrung, dass all die schulische Leistungsmesserei und Unterscheiderei eine Art passiver Vollzug ist, der letztlich die von der Natur oder sonst wem unterschiedlich verteilten Anlagen freilegt, im Repertoire seines beruflichen Selbstbewusstseins. Die Routine seiner Selektionstätigkeit begleitet er mit dem geschulten Blick fürs Rohmaterial, dank dem er dem Schüler recht schnell anmerkt, wie weit es bei ihm reicht und vor allem nicht reicht. Keine „pädagogische Empfehlung“ auf Klassenkonferenzen, den Schüler an der Probezeit oder Versetzung scheitern zu lassen, gibt er ab ohne den Zusatz, dass es doch der Schüler ist, dem nicht geholfen sei, wenn man ihn in Regionen der Bildung schleift, für die er einfach nicht veranlagt ist. Und am Ende glaubt eben noch der Schüler selbst an seine (fehlende) Begabung, sodass Erfolg und Misserfolg schon ihre „Wahrheit“ haben werden – in seiner mehr oder weniger werten Person. [5]
4. Moralität als Lernerfolg
a) Erfolgsmoral – oder: Die Macht der Gewohnheit
Schüler lernen nicht bloß allerhand Stoff gemäß vorgegebenem Kanon und in Zeitintervallen, die für den Durchschnitt geistiger Aufnahme- und Leistungsfähigkeit eher knapp bemessen sind. Über die sinnreiche Kombination von Bildungselementen, Leistungsstress und Benotung lernen sie zugleich, worauf es ankommt – in der Schule und im Leben überhaupt. Sie lernen – nicht als zusätzlichen Stoff, nicht als Lerneinheit, sondern im Sinne einer Selbstverständlichkeit, die eine tagein tagaus geübte Praxis für sie annimmt – ihre schulischen Leistungen im Lichte ihrer in Noten festgeschriebenen Bewertung als die gültige, als die wirkliche und wesentliche Verobjektivierung ihrer Geistestätigkeit zu verstehen. Schließlich lässt der Staat keinen Zweifel daran, dass er seine zum Leistungswillen erzogenen Jungbürger durch diese Brille betrachtet und entsprechend sortiert; so kommen die gar nicht umhin, diese Beurteilung als das Urteil über ihre Person zu nehmen. Die Schule hält ihnen in Form von Zensuren und Zeugnissen den Spiegel vor, in dem sie sich als fachgerecht gebildete Persönlichkeiten wahrnehmen. Der einzelne Schüler mag sich persönlich für alles Mögliche interessieren, seine Aufmerksamkeit auf alles Mögliche richten und auf den Schulstoff nur sehr bedingt. Aber was für das schulpflichtige Individuum zählt, nämlich als seine gesellschaftlich entscheidende Qualifikation und persönliche Qualität, das ist das, was in seinen Zeugnissen steht: das Urteil der Institution über seine Fortschritte als leistungsfähiges und -williges Subjekt. Die Schule lässt ihm keine Alternative dazu, dieses Urteil als verbindlich anzuerkennen, sich – so oder so, affirmativ, kritisch oder selbstkritisch – danach zu richten, es sich zu eigen zu machen. Der Schulunterricht vermittelt seinen Zöglingen den Standpunkt, dass ihre wesentliche, jedenfalls praktisch maßgebliche Identität als brauchbare Persönlichkeit sich im erfolgreichen Abarbeiten vorgegebener Leistungsanforderungen bildet; erfolgreich in einem permanenten Vergleich, den eine gegebene Instanz nach ihren Kriterien vornimmt.
Natürlich ist es allemal drin, dass ein Schüler sich der Zumutung, sich so definieren zu lassen und daran aktiv mitzuwirken, verweigert. Der von der Schule produzierte Normalfall sieht aber so aus, dass die in Bildung begriffene Schülerpersönlichkeit am Gesamtbild ihrer schulischen Bewertungen eigenwillige Akzentsetzungen vornimmt, manche Fächer und Prüfungsergebnisse weniger oder unwichtig findet und sich so, unter Vorbehalt und mit eigenen Vorlieben und Abwägungen, dann aber doch in nichts als dem täglich abgeforderten Mitmachen affirmativ einrichtet. Der freie Schülerwille wird nicht negiert: Er wird praktisch daran gewöhnt, sich den zwingend vorgegebenen Zweck des Schulunterrichts in aller Freiheit zum eigenen Zweck zu machen, und so dahin geführt, sich den objektiv gültigen Erfolgskriterien nicht bloß berechnend zu akkommodieren, sie vielmehr zu verinnerlichen. Der Schüler ist damit in den Grundfehler moralischer Praxis eingeführt: den Selbstbetrug, sich das Zurechtkommen mit den Zwängen als selbstgesetzte Absicht seines Willens und folglich die Grade des Zurechtkommens als unterschiedlich gelungene Willensleistung zurechtzulegen.
Diese Lehre: dass das Leben eines geistig aktiven Subjekts eine frei übernommene Bewährungsprobe für Willen und Verstand ist und die vergleichende Bewertung der Ergebnisse durch eine höhere Instanz herrschende Realität – die Lehre überdauert die Schulzeit und soll das auch. Sie bleibt haften, auch wenn alle sonstigen Bildungserfolge über kurz oder lang auf das kleine Einmaleins, ein paar Fremdsprachenkenntnisse und eine ungewisse Ahnung von der Existenz der Naturgesetze zusammenschnurren.
Die Schule lehrt also die nachwachsenden Generationen die Moral, die sie fürs Erwachsenenleben brauchen. Sie biegt ihnen bei – der umgangssprachliche ist hier der passendste Ausdruck –, dass es darauf ankommt, Willen und Verstand auf die Bewältigung vorweg definierter Leistungsanforderungen zu richten, um die damit programmierte Auslese zu bestehen. Die Vermittlung dieser Stellung, die Ausbildung der Gewohnheit, den Weltlauf im Allgemeinen, die nächste menschliche Umgebung im Besonderen, schließlich und vor allem sich selbst von diesem Standpunkt her zu beurteilen, ist der unausbleibliche allgemeine Kollateralnutzen des Unterrichts in den diversen Schulfächern. Und der ist dort überall, in jedem Leistungskurs und Prüfungsvorgang, so präsent und von solcher Wichtigkeit, dass am Ende die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Erkenntnisse und herrschenden Ansichten sich wie Hebel für die Ausrichtung von Willen und Verstand auf die Disziplin des Konkurrierens ausnehmen. Denn letztlich liegt darin der tiefe Sinn der Schule: in der Bildung einer gesellschaftlich wertvollen Gesamtpersönlichkeit.
b) Anstand – oder: Alles eine Frage der Gerechtigkeit
Ganz von selbst stellt sich dieses Ergebnis freilich nicht ein. Mit der Gewöhnung an den Schulalltag geistiger Leistungsansprüche, die auf Überforderung des Durchschnitts zwecks Unterscheidung und Sortierung angelegt sind, und selbst mit der „innerlichen“ Übernahme der Erfolgskriterien sind die Gegensätze zwischen dem im Bildungswesen institutionalisierten staatlichen Interesse an kapitalistisch brauchbaren Konkurrenzsubjekten und, auf der anderen Seite, den zwischen Bedürfnissen, Launen und Interessen schwankenden Vorstellungen des Nachwuchses über ein zufriedenstellendes Tun und Lassen keineswegs erledigt. Bekanntlich reichen der Schultag und seine Zwänge – mit Fortdauer einer Schullaufbahn zunehmend – über die Schulstunden hinaus und in die gar nicht so frei verfügbare Zeit hinein. Die Pflicht zur Hausaufgabe und Vorbereitung schon abgezogen: Noch und gerade die Sphäre, die Schüler-Individuen dafür reservieren, dass endlich sie auf ihre Kosten und die Neigungen zu ihrem Recht kommen, ist stark begrenzt sowie befrachtet mit den Notwendigkeiten der Erholung und dem sich umso stärker einstellenden Begehren nach Entschädigung. Gerade im Falle schulischer Misserfolge werden nicht selten auch noch die Freiräume dem Beweis gewidmet, dass man doch eine zum Erfolg berechtigte Persönlichkeit ist. Mit den Programmen privater Kompensation werden die Schüler freilich den Widerspruch, der ihr Grund ist, nicht nur nicht los; vielmehr verschärft sich dieser zum Gegensatz zwischen der mangels Alternativen eingesehenen Pflicht, sich zu fügen, anzustrengen, einzuordnen – und dem Anspruch auf eine außerschulische Entschädigung für diese Zumutungen, zu denen man jeden Schultag aufs Neue antreten darf.
Mit solcher Anstrengung privater Moral zum Aushalten der Gegensätze üben die angehenden Konkurrenzbürger schon in der Schulzeit für die spätere, dann lebenslängliche Aufgabe, die eigene Existenz in die Bewältigung beruflicher Konkurrenzzwänge und eine teils der puren Reproduktion, teils dem kompensatorischen Vergnügen gewidmete Privatsphäre aufzuteilen, was auch letzterer nicht gut bekommt. Schon der beschulte Nachwuchs ist fremden Zwecken, letztlich dem Regime unterworfen, das sich an den von Staats wegen etablierten Konkurrenznotwendigkeiten orientiert. Das bleibt Grund und Grundlage der Disziplin, die die Schüler sich selbst antun, und lässt sich nicht einfach wegstecken. Es bleibt diese dauernde Diskrepanz zwischen schulischer Pflicht und individuellen Neigungen; und nicht nur das: Zwischen dem Selbstbild, das die nachwachsende bürgerliche Persönlichkeit, nicht zuletzt aufgrund ihres bewiesenen Leistungswillens, für sich verfertigt, und dem Spiegelbild, das die Schule ihr unter anderem in Form von Zeugnisnoten vorhält, tun sich immer von Neuem Gegensätze auf. [6]
Aufgrund solcher Diskrepanzen versuchen Schüler, sich den Regeln des Fortkommens zu entziehen, indem sie den schulischen Erfolg mittels Unterschleif hinkriegen oder aber zu diesem Erfolg kommen wollen, indem sie berechnend besondere Fügsamkeit demonstrieren oder Interesse vorspiegeln; denen wird klargemacht, dass die Schule sich Wissen nicht durch Bravheit abhandeln lässt. [7]) Wenig originell, vielmehr so stereotyp wie der Schulalltag sind ebenso die Formen, in denen die beschulten Individuen auch mal widerspenstig werden und sich zu wehren versuchen: Frechheiten im Unterricht, demonstrative Verachtung von Inhalt und Ablauf der Schulstunde bzw. der Lehrperson, offensives Schwänzen oder stillschweigender Boykott...
Für die Wahrnehmung und die konstruktive Verarbeitung aller derartigen Kollisionen, die den Schulalltag so langweilig auflockern, enthält die Moral der Anpassung einen höheren Gesichtspunkt, mit dem die Schule die durch alle Fächer sich durchziehende Lerneinheit Was gehört sich?!
vollendet. Für die Leistungskonkurrenz, die sie veranstaltet, nimmt sie nicht bloß wie selbstverständlich in Anspruch, dass sie sich für diejenigen, die sich ihr aktiv unterwerfen, auszahlt, wo auch immer sie in der Hierarchie der Karrieren landen. Wenn sie die individuellen Konkurrenzergebnisse individuell benotet, reklamiert sie außerdem für sich, dass sie gerecht verfährt, keine Willkür, sondern sachliche Kriterien walten lässt und deswegen im Recht ist, wenn sie Könner von Versagern scheidet, den einen damit bessere Lebensperspektiven eröffnet und den anderen entscheidende Aussichten verbaut. Dieser Anspruch: das Versprechen, beim Bewerten individueller Leistungen und beim Sortieren der Schüler unparteiisch, sachlich und unvoreingenommen zu sein, kommt bei den Zöglingen voll an: bei den Guten, die zu ihrem Erfolg das Attest bekommen, ihn sauber und redlich verdient zu haben, wobei der Konkurrenzerfolg so manchen, der sich soeben noch durch die Prüfung gezittert hat, mit entsprechendem Selbstbewusstsein ausstattet – wie bei den Erfolglosen, die ihr Leiden am Verfehlen des maßgeblichen Unterrichtsziels zielsicher in die zweifelnde Frage überführen, wie gerecht und vor allem wie ungerecht das Urteil ist, das die Schule und deren Agenten über sie fällen. Gerechtigkeit ist die Norm, auf die die Schule sich verpflichtet, an der sie sich ideell von ihren Zöglingen auch messen lässt. [8]
Das schöne Recht, die Noten der Schule mit einer kritischen Benotung der Schule zu kontern, enthält für die freien Kritiker freilich eine Verpflichtung, nämlich auf eben die Kriterien gerechter Gleichbehandlung, an denen die Institution sich selbst ideell misst. Wenn also ihr höchstpersönliches Selbstbewusstsein den Schülern über ihre werte Individualität etwas anderes erzählt, als was die Anstalt ihnen als nicht bloß praktisch verbindliche, sondern sachgerechte Wahrheit über ihre gebildete Persönlichkeit attestiert, dann gilt als einziges schlagkräftiges Argument der Vorwurf, dass die Urteilsinstanz sich an ihre eigenen Normen nicht hält. Schon eine ernsthafte Unzufriedenheit mit der eigenen Bewertung, erst recht jedes Aufbegehren dagegen muss und will sich gegen die Berechtigung, die die Schule für ihre Behandlung des Nachwuchses reklamiert, ins Recht setzen, lebt also von der Berufung auf den Geist der Leistungs- und Auswahlkriterien des staatlichen Schulwesens selbst. An diesem Geist fairer Konkurrenz, am Ethos der Sachlichkeit, Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit, Ehrlichkeit muss daher jeder Beschwerdeführer sich selbst messen lassen, muss ihn sich überprüfbar zu eigen gemacht haben, wenn die Beschwerde glaubwürdig sein soll.
Im Normalfall wird aus dem Bedürfnis, in Kollisionen mit den Anforderungen des Betriebs Recht zu behalten, eine permanente Schulung des Gewissens, ohne dass praktisch mehr als ebendas daraus folgt: des guten Gewissens, wenn einer sich mit seiner selbstbewussten Individualität in Übereinstimmung mit den wahren Normativen gerechter Leistungskonkurrenz weiß; des schlechten, wenn nicht; in jedem Fall einer „Stimme“, die dem Zögling sein Leben lang erzählt, was es mit den Friktionen zwischen ihm und der Welt der staatlich gehüteten Konkurrenz in Wahrheit auf sich hat. Im negativen Fall kann das moralische Rechtsbewusstsein – und nur ein solcher Standpunkt! – dazu führen, dass enttäuschte Schüler in ihrer Unzufriedenheit mit dem ganzen Schulwesen und dem, was es ausgerechnet ihnen an Unrecht antut, radikal werden und nach Möglichkeiten zur Rache suchen.
Lange bevor es zu extremen Ausreißern des Selektionsbetriebs kommt, erfährt das Konkurrenzgebaren seine pädagogische Kontrolle: Die Schule liefert als Organisator der Leistungsselektion auch noch das – seinerseits moralische – Dementi ihrer Gleichung von Leistungsbewertung und menschlichem ‚Wert‘ eines Individuums mit: Sosehr die Schüler, vom Klassenprimus alias ‚Sieger-Typ‘ bis zum Aussortierten alias ‚Loser-Typ‘, Derivate der Leistungskonkurrenz sind und mit ihrem jeweiligen Abschneiden adäquat umgehen, indem sich Selbsteinschätzung und Zeugnisnote in etwa decken – der Zusammenhalt in der Klasse darf über diese Sortierung nicht verloren gehen, die Fiktion der schönen „Gemeinschaft“ will als Ideal der Konkurrenz gepflegt sein. Ihre Wichtigkeit wird in den „Bildungszielen“ der Lehrpläne penetrant beschworen, die „Wertschätzung“ und der „Respekt“ der in gute und schlechte geschiedenen Mitschüler füreinander sind allerhöchste Werte, „Respektcoaches“ neuerdings im Einsatz. Hierfür lässt sich die Legitimation der Konkurrenz mit der verschiedenen Natur, den vielfältigen Talenten des Individuums bei Bedarf auch trostreich für die Verlierer buchstabieren: „Auch ohne Abi bist du wer“; „Der Mensch zählt mehr als die Leistung“ – und andere passende Verlogenheiten für den leistungsgerecht ermittelten Ausschuss.
II. Demokratische Werteerziehung: Moral als Schulfach
Moralität ist nicht nur der Lernerfolg, der bei der Bewährung in der Leistungskonkurrenz fächerübergreifend inbegriffen ist. Um den angehenden Staatsbürger der sittlichen Reife zustreben zu lassen, wird die Moral in den einschlägigen Fächern als solche zum Unterrichtsgegenstand, zum Thema und Ertrag einer eigenen Geistesleistung, wenn Herz und Charakter
[9] der Zöglinge von der Schule bearbeitet werden. Einerseits zeichnen sich die sittlichen Werte bekanntlich dadurch aus, dass sie über allem stehen und fraglos gelten; andererseits verlangt die Schule dem Nachwuchs Bemühungen des Verstandes ab, welche den Schüler „werteinsichtig“ machen – in dieser gelungenen Wortschöpfung drücken die Lehrpläne den Widerspruch aus. Benotet wird diese Einsicht jedenfalls genauso wie das Bruchrechnen, auch an der Moral als Lerninhalt wird man sortiert.
1. Das Fach Deutsch
Das Kunststück, den unbedingten, an und für sich gültigen Wahrheiten der Moral argumentative Berechtigung zu verschaffen, ist der genuine Inhalt jener Moralfächer. In ihnen soll sich der Verstand einerseits daran gewöhnen, einen Gegenstand nicht einfach gut zu finden oder abzulehnen, nicht einfach das unmittelbare, unreflektierte Urteil gelten zu lassen, sondern aufgrund von Argumenten zu einer Stellung zu kommen. Andererseits besteht der Lehrplan mit der größten Selbstverständlichkeit darauf, dass der Argumentierende ein geistiges Sorgerecht für die Sache übernimmt und seine Überlegungen von dieser Verantwortlichkeit leiten lässt. Diese Art, die Urteilsfähigkeit zu fördern, verlangt den Widersinn, die Distanz, die der Intellekt zum Urteilen benötigt, zum Hebel der Affirmation zu machen. Eine Kulturtechnik bürgerlichen Denkens, die der junge Mensch elementar im Kernfach Deutsch einübt, das er ob der ihm zugemessenen Wichtigkeit schultyp- und länderübergreifend bis zum Abitur nicht mehr loswird.
Wer die Auslese am ABC übersteht, der erfährt in diesem Fach die Grundlagen und den Feinschliff geistig-moralischer Reife. Beim sogenannten Erörtern, der Denk- und Schreibform des Problemaufsatzes, schult der Nachwuchs seine Mündigkeit, ist er angehalten, zu allen möglichen Dingen „begründet Stellung zu nehmen“. Aber wie. Die erste entscheidende Weiche stellt schon das Thema, das man bekanntlich nicht verfehlen sollte. Es lautet nie: Was ist, warum und wozu gibt es Facebook, Homoehe oder Vorratsdatenspeicherung? Erörtern heißt also nicht, die Sache selbst zu bestimmen, ihr als solcher auf den Grund zu gehen und über die Erklärung zum Urteil über sie zu kommen. Vielmehr macht die vorangestellte Schablone Erörtere / Diskutiere / Für und Wider ... aus der jeweiligen Sache ein Problem. Und zwar eines, das den Aufsatzschreiber, ob er es selbst hat oder nicht, auf jeden Fall etwas angeht und ihn auf den Standpunkt der gedanklichen Betreuung oder Bewältigung verpflichtet. Klar ist natürlich: Nicht einmal dann, wenn für die Unter-/Mittelstufe so scheinpraktische Fragen zu wälzen sind wie, ob ins Skilager gefahren oder in Deutsch Lyrik gelesen werden soll, entscheidet der Schüler irgendwas. Nur: So albern und fiktiv diese einzunehmende Warte theoretischer Zuständigkeit oder Verantwortlichkeit auch ist, so zwingend affirmativ ist damit die Stellung zum Problem, das einem aufgemacht wird. Und da haben es bereits solche Themen aus dem Sandkasten schülernaher Fragestellung in sich, man lernt: Eine Position begründen heißt nicht, einen Grund vorzubringen, den man hat, sondern einen guten Grund für (oder gegen) sie zu finden. Verlangt ist der methodische Schritt vom eigenen Interesse, das man einbringen mag, hin zu einem anerkannten, auf jeden Fall allgemein anerkennungsfähigen Grund: So wenig ein Statement wie „Skilager ist mir egal, weil mir Wintersport nicht zusagt“ eine gelungene Stellungnahme ist, so wenig reicht für eine Befürwortung das bekundete Interesse an der Skigaudi: Ein geheucheltes „Der Unterrichtsausfall ist zu bedenken“ oder aber „Skilager ist gut fürs Klassenklima, weil wichtiges Gemeinschaftserlebnis“ sollte einem da schon einfallen. [10] Dieses Anlegen eines übergeordneten Betrachtungsmaßstabs und das entsprechende Übersetzen der eigenen Position auf die Ebene gültiger Gesichtspunkte bilden somit das Grundmuster allen „Argumentierens“. Es übt und bewährt sich bis in die oberen Klassenstufen, wo dann über drängende Fragen unserer Zeit wie Frauenquote, Genmais, Studiengebühren ... räsoniert werden darf. Sprach für das Skilager der Wert der Klassengemeinschaft, so spricht gegen die Studiengebühren, dass das Gemeinwesen seinem Rohstoff Bildung, also sich selbst im Weg steht und sich obendrein an unser aller Wert der Gerechtigkeit vergeht. Die sogenannte „steigernde“ Anlage dieser Aufsatzart erreicht man also, indem man von der Niederung einzelner Interessen zur Vogelperspektive des Gemeinwesens wechselt, um am Höhepunkt Wortmeldungen aufzufahren, die sich um dessen hohe und höchste Werte sorgen, die immer eine feste Bank sind. So lernt der junge Bürger das Prinzip, vom Staat her zu denken, sich aus der Perspektive der Herrschaft und ihres Regelungsbedarfs zu betrachten, um sich so in einem ideellen Wir gemeinsamer Verantwortung mit den wirklich zuständigen Herrschaften zusammenzuschließen. [11]
Die Fiktion, die disparatesten Standpunkte unter den Hut eines Problems zu bringen, an dem die Betroffenen wie die regelnde Instanz angeblich gemeinsam laborieren, findet in jener Fassung der Erörterung ihr adäquates Niveau, die Deutschlehrer „dialektisch“ nennen. Das altgriechische Wort ist hier der gewählte Ausdruck für die Lebensweisheit, dass alles seine zwei Seiten hat, und macht die Abhandlung des Gegenstandes nach Vor- und Nachteilen zur Denkvorschrift, auf eine Sache mit mindestens zwei Meinungen loszugehen. Wer ihr folgt, beurteilt die Standpunkte ihrerseits so wenig wie die Sache selbst; vielmehr relativiert er sie im Für und Wider von Gesichtspunkten aneinander, die, so disparat bis miteinander unverträglich sie sein mögen, alle ihr Recht haben und in ihrer Gleichgültigkeit aufgeführt werden – auch dann, wenn sie zur Vorführung der Kunst dialektischen Erörterns („Mir fehlt noch ein Kontra“) frei erfunden sind. [12] Gleichgültigkeit ist da im doppelten Sinn des Worts zu verstehen: Der Schüler lernt, dass, wer einen Standpunkt, mit welchen guten oder schlechten Gründen auch immer, ernsthaft gegen andere zu behaupten sucht, auf dem Sprung ist, (s)eine Sichtweise zu „verabsolutieren“, und damit die elementare Anstandsregel des Diskutierens missachtet. Auch für die gegensätzliche Meinung ist inhaltsloser Respekt angesagt, und wer seine Argumente nicht auf diese Stufe der Gleichgültigkeit herunterbringt, fängt sich die ebenso inhaltsleere „Kritik“ ein, nur einseitig zu denken.
Die Nagelprobe auf diesen Dogmatismus des um Argumente unbekümmerten Hin- und Herwägens ist die Synthese, in die das dialektische Erörtern einzumünden hat. In ihr soll der Schüler ein „ausgewogenes“ Urteil formulieren, d.h.: Er darf zwar eine persönliche „Gewichtung“ vornehmen, die eine oder andere Seite favorisieren, aber auch im Resümee sollte ein Einerseits-Andererseits bezeugen, wie komplex und „problembewusst“ er denkt. Ein subjektives „meiner Meinung nach“ davorgesetzt gehört sich sowieso und untergräbt diese „Objektivität“, die einen Aufsatz lang aus nichts als parteilichen Standpunkten und am Ende in der passenden Selbstrelativierung des eigenen Urteils besteht, in keiner Weise.
Abiturtauglich und einserverdächtig ist es, zu guter Letzt ein nie aufzulösendes Dilemma von Realität und Ideal zu konstatieren, wobei es gerade der Jugend gut ansteht, sich kritisch auf die Seite des Ideals zu schlagen. Der Gesellschaft den Spiegel der eigenen Ideale vorzuhalten, diese grundaffirmative Verwechslung aller gültigen Zwecke und Interessen mit den sittlichen Werten, die sie für sich reklamieren, ist die Höchstform, zu der die Kritik eines geistig reifen Staatsbürgers aufläuft – nicht nur im Abitur. Das kritische Getue entdeckt allenthalben Verstöße gegen die Gebote eines fried- und liebevollen Zusammenlebens der Menschen und Völker, eines gerechten und toleranten Umgangs aller Schichten und Altersgruppen miteinander, die eigentlich nicht sein müssten – aber wohl solange nicht aufhören, wie wir alle nicht engagierter gegen Macht- und Profitgier, Aggression und Ungerechtigkeit aufstehen ... so die Schlusssätze mit (das verbürgen wir) Musterlösungsqualität.
Die schon in der Einleitung gar nicht peinliche Wichtigmacherei, mit der der Prüfling erstens so tun soll, als dränge es ihn persönlich, die ihm vorgesetzte Frage zu wälzen, und zweitens die Warte des Sachwalters in Entscheidungsfragen dieser Gesellschaft bzw. die ihres Sittenwächters einnimmt, ergänzt sehr gut die Belanglosigkeit und Gleichgültigkeit des Meinens, in der der reife Staatsbürger sich übt, wenn er die demokratische Kardinaltugend der Toleranz verinnerlicht.
Der Vorteil des Literaturaufsatzes – im Grunde auch eine Art Erörterung – ist, dass man bei der Dichtkunst keine Nachteile finden muss. Ganz im Gegenteil: Der Widerstand oder das Desinteresse, den oder das so mancher Schüler bei dieser Materie zu überwinden hat, ist in grundsätzliche Wertschätzung zu verwandeln, mindestens durch den Standpunkt zu ersetzen, dass Literatur interessant und wichtig ist. Was an den Dichterwerken das Interesse verdient, wird – jedenfalls nach der negativen Seite hin – schnell klar: Wer ein Buch einfach nur spaßig, spannend, bzw. mehr oder weniger unterhaltsam findet, hat das Wesentliche verpasst: Dass es im Leben eigentlich und letztlich um höhere Prinzipien und Werte geht oder gehen sollte, gilt nicht nur in Erörterungen, sondern für die schöne Literatur im Besonderen. Zeugen ihre Werke doch vom ewigen Ringen um Freundschaft, Aufopferung, Liebe, Treue, Ehre, Charakterstärke, Toleranz, Gerechtigkeit, Freiheit ... – ein Kampf, zu dem immer das jeweilige Gegenteil antreten muss, damit das Spiegelgefecht schön dramatisch wird. Dass sich all diese Produkte der moralischen Phantasie im tiefen Grunde immer irgendwie um dieselben Fragen drehen, belegt im Literaturunterricht nur deren existenzielle Gültigkeit, ein Dogma, das sich selbst noch im Dementi als wasserdicht erweist: Das ist ja das Schöne und moralisch Erbauliche an den Werten, dass man sie in der realen Welt der schnöden Interessen immerzu vermissen kann. So lässt sich die „Gegenwelt“ der literarischen Fiktion, in der jene Werte endlich einmal die Hauptrolle spielen, auch noch als Kritik am Werteverlust lesen, unter dem der reale Mensch leidet.
Weil der tiefere Sinn der Sache im Falle der Literatur in ihrer sprachlichen Form verpackt ist, ist er eben auch dieser abzuringen. Die methodische Kompetenz der Interpretation besteht von daher immer in dem Zirkel, die moralischen Abstraktionen an jedes Stück Literatur heranzutragen („Deutungshypothese“), um sie der verfremdeten Form wieder abzulauschen. Dem Auftrag, dem Kunstgebilde so einen Tiefsinn zu entlocken, kommt keiner aus, und tut er sich schon hart, ein Reimschema zu erkennen, so nimmt er zumindest eine Ahnung davon, dass da eine ziemliche Botschaft dahinter ist, mit nach Hause. Man kann sich wundern oder es bewundern, wenn die Lehrkraft noch in jedem Gedichtlein ein Geflecht aus weltanschaulichen, zeitgeschichtlichen und biographischen Anspielungen entdeckt. Zum Einser kommt nur, wer es versucht ihr gleichzutun, was im Erfolgsfall auch erkennen lässt, dass ein klarer Fall von Bildung vorliegt: Diese spiegelt in der staunenden Hochachtung davor, was alles in der Literatur drinsteckt, sich selbst.
Nicht zuletzt: Selbstredend geht es dem Unterricht in deutscher Literatur, der die Moral in Form des Kunstgenusses eingängig machen will, um den Wert des nationalen Kulturerbes als eines Teils deutscher Identität. Diesen Wert beweist der Deutschlehrer allein dadurch, dass er das Erbe pflegt, also die Schüler durch den Literaturkanon von Gryphius bis Grass schleust, weil all die Glanzleistungen deutscher Kultur schon als solche verbürgen, dass wir einem nationalen Kollektiv angehören, das – über Jahrhunderte und Epochen hinweg – immer schon der Hort der hohen Werte ist, die als das Gute, Wahre & Schöne in Form der künstlerischen Phantasie an Staat und Nation mitwirken.
2. Das Fach Geschichte
Dass man diesem Gemeinwesen, seiner Nation nicht einfach so angehört, sondern sich mit gutem Grund zugehörig fühlt, diesem obersten Lernziel arbeitet auch der Unterricht in Geschichte zu. Das Fach steuert dafür seine eigene Anschauungsweise bei und lehrt: Diese unsere Nation, ihr politisches und wirtschaftliches System, das gibt es nicht einfach so, wie es ist, sondern hat eine lange Geschichte, aus der es hervorgegangen ist. Allein dieser scheinbar schlichte Befund ist nicht ohne. Er ist insofern bereits mehr Botschaft denn Befund, als er sagen will: Was durch die Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, entstanden ist, hat eine tiefere Notwendigkeit. Von daher erwirkt
„die Beschäftigung mit Zusammenhängen zwischen Vergangenheit und Gegenwart die Orientierung der Schüler in ihrer eigenen Lebenswelt. Um die Zukunft mitzugestalten, bedarf es der Erkenntnis, dass die Gegenwart historisch bedingt ist. Ein vertieftes historisches Bewusstsein ist somit wesentlicher Bestandteil einer soliden politischen Bildung.“ [13]
Schüler, die zu dieser „Erkenntnis“ gebracht werden, werden mit einer Zumutung konfrontiert. Nicht einer Zumutung im Sinn ihrer Beschwerde: „Wozu bitte brauche ich die alten Römer?“, sondern mit einer Zumutung an den Verstand, der sich im heutigen Gemeinwesen zurechtfinden, es begründet wertschätzen, gar künftig mitgestalten soll, indem er sich nicht mit ihm befasst: Die Erarbeitung eines historisch fundierten Verständnisses der Gegenwart führt ihn von dieser weg. Besonders sinnfällig wird dieser Umweg, wenn die historischen Anläufe jeweils auf diversen Jahrgangsstufen bei den alten Griechen einsteigen:
„Das moderne Europa hat seine Wurzeln in der Antike. Griechen, Römer und das Christentum schufen die Grundlagen der europäischen Kultur. Unsere heutige Auffassung von gerechter Herrschaft basiert auf den Erkenntnissen antiker Staatsphilosophie und dem Vorbild der Demokratie Athens.“ [14]
Das Gütesiegel, gerecht zu sein, ist in der anvisierten Betrachtung unserer historischen „Wurzeln“ als sozusagen zeitloses Ideal jeder regierenden Gewalt einfach unterstellt. Die Gleichsetzung politischer Herrschaft mit einer Art kulturphilosophischem Höchstwert erlaubt es, die antike und moderne Staatsform über die Jahrtausende hinweg locker zusammenzuschließen. Dass die eine Staatsform auf der anderen „basiert“, ergibt sich zwanglos daraus, dass „unsere heutige Auffassung von gerechter Herrschaft“, sprich: unsere Wertschätzung für das heutige System, in die Vergangenheit zurückverlegt wird. Mit einer so erschwindelten Identität zwischen Gegenwart und Vergangenheit – in dem Fall: Demokratie damals wie heute – lässt sich dann jede gewollte Schneise quer durch die Geschichte schlagen, wobei sich stets bestätigt: Die haben vor ewigen Zeiten, wenn auch anders, aber im Grunde schon dasselbe gewollt, womit eben für unser Staatsgebilde spricht, dass es diese lange Geschichte hat. [15]
Die Botschaft des Konstrukts besteht also darin, dass unsere heutige bürgerliche Herrschaftsform der Zielpunkt einer letztlich notwendigen Entwicklung ist. Als solche steht die Geschichte nämlich über den Akteuren, sie erhält ihren eigenen, subjektlosen Zweck, den kein Geschichtsteilnehmer bewusst zu verfolgen braucht. Als dessen Erfüllungsgehilfen aber ehrt die der Geschichte angedichtete Teleologie sowohl die alten Griechen als auch ihre vermeintlichen Erben. Letztere vor allem, denn was das antike Athen im Keim angelegt hat, haben wir vollendet:
„Viele Menschen, z.B. die Frauen, blieben [im antiken Athen] jedoch ausgeschlossen. Dennoch ... ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung der Demokratie, die heute die Staatsform in den Ländern der Europäischen Union ist.“ [16]
So gratuliert sich unsere heutige Demokratie am Ende zu sich selbst, was jene vereinnahmten griechischen Philosophen mehr theoretisch ausgedrückt wohl als billige Tautologie durchschaut hätten. Das Dogma des Fachs, dass die Gegenwart das Produkt der Geschichte ist, ist umgekehrt zu lesen: Die Gegenwart schafft sich so ihre Geschichte, auf die sie, wie es passend heißt, „zurückblickt“ – mit der moralischen Botschaft, dass das, was sich am Ende durchgesetzt hat, im Recht ist und deswegen Parteinahme verdient.
Dieser Zugriff auf die Geschichte, der die Nation heute als das Resultat ihrer wie weit auch immer gefassten Vorgeschichte erscheinen lässt, ist so absichtsvoll wie unbeirrbar. Wenn die deutsche Nation selbst in der näheren Vergangenheit noch auf alles andere als auf diesen heutigen Endsieg von Rechtsstaat und Demokratie zugesteuert ist und alle aufrechten Demokraten im Konsens behaupten, dass der nationalsozialistische Faschismus das blanke Gegenteil der hier und heute waltenden bürgerlichen Herrschaftsform sei: dann ist das eben als Bruch ins Kontinuum unserer deutschen Geschichte einzubauen. Was deutsche Bundespräsidenten vorbuchstabieren, fassen deutsche Geschichtslehrer denkbar fachgerecht: Sie erklären die nationalsozialistische Herrschaft zum „dunkelsten Kapitel“ der deutschen Nationalgeschichte, das gerade der Unterricht nicht verdrängen darf, sondern dem er sich stellen muss:
„Keine historische Phase ist so belastend im kollektiven Gedächtnis der Deutschen eingebrannt wie die nationalsozialistische Herrschaft mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Die Beschäftigung mit dieser Phase, ihren Wirkkräften und ihren Abgründen, ist unverzichtbar für das politische Bewusstsein jedes Deutschen.“ [17]
Der heranwachsende Staatsbürger lernt den politmoralischen Kunstgriff, gerade die Distanzierung von den Untaten der Nation zum Hebel der Identifikation mit ihr zu machen. Diese sogenannte „Aufarbeitung unserer Vergangenheit“ verlangt den Schülern ab, sich als Deutsche für etwas zu schämen, was sie – von wegen „eingebrannt“ – nur aus der Geschichte überhaupt kennen; sie sollen moralisch-ideell Verantwortung übernehmen für Millionen Opfer des Nazi-Regimes und haben mit dieser eigentümlichen Betroffenheit einen wesentlichen Teil des Lernziels erreicht: Sich nämlich gerade im schuldhaften Eingeständnis der eigenen negativen Geschichte als Deutsche zu bekennen. Das zerknirschte Bekenntnis zur „deutschen Schuld“ – nicht umsonst pflegen es die politischen Führer des Landes – erlaubt es einem, sich als Angehöriger eines Kollektivs zu fühlen, das in der Gegenwart stolz sein darf, weil es damit umso geläuterter und offensiver als das glaubwürdigste Korrektiv der nationalen Vergangenheit auftritt.
Mit dem in der moralischen Betroffenheit enthaltenen Bekenntnis zur Nation allein lässt sich freilich keine Prüfungsarbeit bestehen. Das Schulfach verlangt dem Verstand eine Erklärung jener NS-Diktatur ab. Dabei stellt der Gegenstand auch in dem Sinne ein „dunkles“ Kapitel deutscher Vergangenheit dar, als er schwer fassbar, im Grunde unerklärlich sei. So fragt man gar nicht erst: Warum haben die Nazis das gemacht? Vielmehr stellt man die fachgerecht in der Vorgeschichte nach „Wirkkräften“ suchende Frage gleich so: Wie konnte es nur dazu kommen? Die Suche nach dem Grund wird in die nach Voraussetzungen, und die sogleich in das Rätsel übersetzt, wie es zu jenen „Abgründen“ kommen konnte, die doch in dieser werthaltigen Nation der Dichter und Denker eigentlich gar nicht denkbar sind.
So von der Sache und ihrer Erklärung weg- und in die Spur der Aufarbeitung gebracht, darf der Schüler sich der Schuldfrage zuwenden, gemäß der schrägen Logik: Wie ist, was nicht hätte passieren dürfen, trotzdem passiert? Zur Beantwortung im Angebot ist ein Sammelsurium von „Faktoren“, deren Leistung in der Regel negativ gefasst wird, nämlich so, dass sie den Faschismus bewirkt, weil sie ihn nicht verhindert haben: Die Weimarer Demokratie war nicht gefestigt; den verlorenen Ersten Weltkrieg hätte Deutschland besser nicht mit angefangen; die Siegermächte hätten besser nicht so harte Friedensbedingungen diktiert; so hätte es die faschistische Propaganda nicht so leicht gehabt, deutsche Patrioten aufzuhetzen; ... sodass das Unheil nicht aufzuhalten war – oder aber auch seinen von der Geschichte angebahnten Lauf nahm, weil die Nazis fortsetzten, was in der Vorzeit tief verwurzelt war:
„In der Weimarer Zeit setzte sich die Entwicklung fort, die in der Kaiserzeit und im Ersten Weltkrieg begonnen hatte: Die Juden sahen sich mit einem wachsenden Antisemitismus konfrontiert, der sich überdies radikalisierte.“ [18]
So oder so schlägt die ‚Logik‘ historischer Denkart zu: In ihr „entsteht“, „ergibt sich“ der Nationalsozialismus am Ende irgendwie aus dem Zusammenspiel vieler vorfindlicher oder fehlender Wirkkräfte, aus einem Konglomerat von Vorgeschichte, aus dem sich damit die Sache selbst „erklärt“. Nicht zu übersehen ist, dass, wo immer der Geschichtsunterricht nach dem fahndet, was das „Unfassbare“ ermöglicht oder nicht verhindert hat, doch einiges Verständnis mitschwingt – für diese „Entgleisung“ des von Misserfolgen gebeutelten Nationalvolks: Insbesondere die gängige Redeweise vom durch geschickte Propaganda verführten Volk, vom Missbrauch seines patriotischen Wir-Gefühls, wahrt das Kontinuum des im Grunde guten deutschen Volkscharakters.
Der über den Nationalsozialismus historisch aufgeklärte Schüler kommt ohne jedes an diesem selbst ermittelte Urteil aus, warum sich eine faschistische Bewegung formiert, welches politische Programm sie durchsetzen will, wenn sie mit dem Ziel der Machtergreifung antritt. Dafür lernt er, mit dieser Abmischung aus Entsetzen und Verständnis jedes Moment der dunklen Zeitgeschichte mit der Botschaft zu beleuchten, auf die diese Sorte Aufklärung zuläuft: dass diese Zeit ein einziger Ruf nach dem ist, worauf wir Deutsche heute zurecht stolz sind: unsere „wehrhafte Demokratie“. So hat die Geschichte eine Lehre für ihn parat, die als politisch-moralischer Auftrag die Schularbeiten überdauern soll und die angehenden Staatsbürger in die Verantwortung fürs gegenwärtige und zukünftige nationale Kollektiv nimmt.
Der Lauf der Welt ist in dieser Geschichtsbetrachtung vom Sieg griechischer Freiheitskämpfer gegen die Perser bis zum – nicht zuletzt in der deutschen Wiedervereinigung vollstreckten – Sieg der Freiheit über den Kommunismus eine ewige Schlacht des Guten mit dem Bösen, die andauert. Der Schüler darf es sich als persönliches Glück zurechtlegen, in dieser seiner heutigen Nation und damit auf der richtigen, erfolgreichen Seite gelandet zu sein – und soll sich dem verpflichtet wissen, als wäre es ein Geschenk der Geschichte. So vervollständigt der Unterricht in Geschichte die Einübung in die staatsbürgerliche Verantwortlichkeit, welche der Deutschunterricht vor allem als Denkmethode lehrt, um den Inhalt nationaler Identität.
*
Wenn es der Schüler nicht schon dem ständigen Geschwafel vom ‚Ernst des Lebens‘ entnommen hat, der ihm irgendwann blüht, so merkt er spätestens nach dem Schulabgang, dass er bisher überhaupt nicht ‚fürs Leben‘, sondern für die Schule gelernt hat und dass das eine vergleichsweise gemütliche Geschichte war. Das Prinzip, das nun noch einmal und mit der Härte, die ‚die Praxis‘ mit sich bringt, an ihm geltend gemacht wird, hat er sich allerdings längst notgedrungen zu eigen gemacht: In den Schulen der Nation und der darauf folgenden Berufsausbildung geht es um Qualifikation. Diese Errungenschaft einer gelungenen Ausbildung ist alles andere als eine Kenner- und Könnerschaft, mit der man auf die Welt losgehen und sie nach seinem Bilde gestalten könnte. Die persönlichen Kenntnisse und Fertigkeiten sind umgekehrt dadurch charakterisiert, dass sie einen Menschen dazu befähigen, Ansprüchen zu genügen, auf die er von seinem Interesse her nie und nimmer freiwillig gekommen wäre – in der Schule den Ansprüchen der Schule und jetzt anderen, handfesteren, die ihm als wirtschaftlicher und staatlicher Bedarf nach dieser und jener Fähigkeit gegenübertreten. Zu diesen Anforderungen muss einer nach seiner Ausbildung passen, und „passen“ heißt: auf sie muss er sich persönlich einstellen, sonst hat er von Haus aus keine Chance auf Verwendung und entsprechende Karriere. [19]
Irgendeine Sicherheit auf irgendein Berufsleben ist mit dem Schulabschluss freilich nicht verbunden. Mit keinem Zeugnis ist das Ziel erreicht, für das sich die Inhaber des Zeugnisses abgemüht haben; und der Output der Bildungsstätten entspricht nie so recht genau dem Input, den die Arbeitswelt als ihren Bedarf anmeldet. Das eine wie das andere begründet die stereotypen Beschwerden: die Klagen über die Untauglichkeit der Schule für die Anforderungen der modernen Welt wie für die Karrierebedürfnisse der Absolventen. Beide Vorwürfe braucht sich das staatlich eingerichtete Bildungswesen jedoch nicht gefallen zu lassen. Erstens leistet es einiges, um die bedarfsgemäße Verteilung des Nachwuchses zu gewährleisten. Die Absolventen der verschiedenen Bildungsstufen sind sauber vorsortiert. Zweitens sind die Schulen der Nation zwar mit Auslese befasst, auch mit der Herstellung von Qualifikationen, aber keineswegs die Instanz, die darüber entscheidet, was eine Qualifikation ist. Mit der Qualifikation hat es nämlich so seine eigene Bewandtnis. Sie ist nur zum einen Teil eine Befähigung; viel wichtiger an ihr ist die Frage ihrer Brauchbarkeit. Und noch nicht einmal das stimmt; denn die Brauchbarkeit ist eben auch nur eine Voraussetzung, die keinem ihrer Inhaber etwas nützt, solange sich kein Anwender einfindet. In der wohlgeordneten Schülerhierarchie haben die öffentlichen wie privaten Arbeitgeber einen Anhaltspunkt für ihre Entscheidung, wem sie die anstrengenden und schlecht bezahlten Jobs reservieren und wem sie die besser bezahlten, von körperlicher Anstrengung und Stumpfsinn befreiten Jobs der Elite zuweisen. Der Ausschluss von Karrieren, die Verteilung des nationalen Nachwuchses auf die von den Unternehmern geschaffene Hierarchie der Berufe findet also gründlich statt, und ganz nebenher sorgen die sozialen Voraussetzungen, mit denen die Schüler in die Schule eintreten, dafür, dass die Kinder der unteren ‚bildungsfernen‘ wie der oberen ‚bildungsaffinen‘ Schichten nach der Schullaufbahn ziemlich regelmäßig wieder dort landen, wo sie herkommen.
Auch das wird der Schule bisweilen zum Vorwurf gemacht: Sie sei ungerecht, weil der schulische Erfolg viel zu sehr vom sozialen Status der Eltern und nicht von der individuellen Leistung des Schülers abhängt. Dieser Vorwurf sieht darüber hinweg, dass es schon die Arbeitgeber sind, die mit ihrer Einrichtung und Bezahlung der Arbeitsplätze diese Berufshierarchie festlegen, auf die die Schule den Nachwuchs mit ihrer eigenen Auslese vor-verteilt. Die kritische Sicht geht in der Affirmation gerechter Leistungsselektion so weit, dass sie den rechtfertigenden Schein der Veranstaltung mit deren Zweck verwechselt: gerade so, als wäre die Berufshierarchie das naturgemäße und nur leistungsgerechte Abbild einer per Bildung erfolgten Sortierung der Talente, die sich in dieser „Wissensgesellschaft“ tummeln. So treten kritische Begleiter des bürgerlichen Bildungswesens als die Anwälte von dessen zentraler Ideologie auf: Ein jeder sollte am Ende an der Stelle in der Hierarchie der Berufe und Einkommen landen, die er sich in seiner Bildungskarriere selbst erarbeitet und damit „verdient“ hat; und damit wäre die Gesellschaft insgesamt auch am besten bedient.
Die Verwechslung gelungener Schulausbildung mit einer Gewähr für einkommenswirksamen Einsatz der Absolventen, andererseits mit einer Garantie für ihre staats- und wirtschaftsdienliche Benutzung verkennt gründlich die Freiheit, welche die Bildungsinstitutionen denen verschaffen, von denen wirklich alles abhängt. Wegen dieser Freiheit der Arbeitgeber hat der Staat seine Bildungsschuppen getrennt von Fabrik und Büro eingerichtet und auf so eigenständige Kriterien der Sichtung, Unterscheidung und Prüfung festgelegt, dass darüber eine ganze pädagogische Wissenschaft entstanden ist. Auf die konjunkturell wechselnden Bedürfnisse der Arbeitswelt stellen sich die Verwalter des Bildungswesens schon deshalb immer ein, weil sie ihre Unabhängigkeit allemal nur als Gnade und als Auftrag verstehen, welcher sie auf eine Erziehung verpflichtet, die den Bedürfnissen der Gesellschaft, den Anforderungen der Zukunft oder schlicht: der ‚Praxis‘ genügt. Wenn vom Schulmeister bis zum Studenten alle dem Ideal einer praxisnahen Ausbildung hinterherrennen, so erreichen sie es zwar nie im Sinne der Vorstellung, dass die am Nachwuchs erzeugten Fertigkeiten mit den nachgefragten zusammenfallen. Dass bei den Nachfragern kein Mangel entsteht, garantieren das Bildungsangebot und die Auslesekünste jedoch sehr wohl. Bildungschancen gibt es also mehr als genug. Gründe für den Glauben, dass das Lernen, ein Leben lang womöglich, eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit und für den Erfolg in der Berufskarriere sei, gibt es keine.
[1] Ob nun der pädagogisch engagierte Idealist den Übergang zu individueller Nachhilfe macht oder der Kollege Zyniker gleich abwinkt und seine Sprüche vom verlorenen Hopfen und Malz bzw. Spreu und Weizen aufsagt: Es ist der objektive Zweck des Leistungsvergleichs, der die populäre Unterscheidung jener Lehrertypen ziemlich irrelevant macht. – Dass der Lernbetrieb unmissverständlich auf die Unterscheidung der Lernenden dringt, stellt der Dienstherr eigens und ausdrücklich mit seiner kultusbehördlichen Auflage klar, die ermittelten Noten am Ende innerhalb einer Klasse möglichst unter breiter Streuung auf alle Stufen der Skala „normalzuverteilen“. Wie ein Test mit vielen schlechten Noten den Lehrer nicht von vorne beginnen lässt, so dokumentiert ein Test mit vielen guten Noten keineswegs die gelungene Wissensvermittlung, sondern nur, dass entweder der Test selbst oder das falsch angesetzte Maß der Bewertung seinen selbstverständlichen Zweck verfehlt hat: nämlich die Getesteten zu scheiden.
[2] Die pädagogische Wissenschaft arbeitet der Selektion und den in ihr praktizierten Abstraktionen mit didaktischen Modellen einer „Kompetenzhierarchie“ zu und liefert den passend instrumentellen theoretischen Unsinn: Daraus, ob einer etwa eine Schlussfolgerung zustande bringt oder nicht, soll sich die Kompetenz des Schlussfolgerns ableiten lassen. Auch bei den didaktischen Erfindungen namens „Transfer“ oder „Problemlösen“ handelt es sich nicht um wirkliche Qualitäten geistiger Tätigkeit, sondern bereits um deren ideologische Fassungen seitens der Pädagogik, was aber das praktische Geschäft der Unterscheidung nicht zu stören braucht.
[3] Heutzutage bieten – oder besser: biedern sich im Internet „Lernhilfen“ an, die ne geile Mathenote
als Motivation in Aussicht stellen, sich den ganzen Quark
anzueignen (SZ, 25.7.17).
[4] Einer vergleichbaren Logik verdankt sich das Zugeständnis der sogenannten Legasthenie
oder Dyskalkulie
(Lese- und Rechtschreib- bzw. Rechenschwäche) als einer so diagnostizierten persönlichen Störung
, die den Leistungswillen nicht am Konkurrieren hindern soll, wenn er sich ansonsten als konkurrenztüchtig erweist. An einer „Krankheit“ soll ein im Kern gesunder Leistungs- und Aufstiegswille der „Gesamtperson“ nicht scheitern. Der dafür erlaubte Nachteilsausgleich
ruft wiederum die Warnung vor Trittbrettlegasthenikern
auf den Plan – eine schwierige Aufgabe für die Fachleute
gerechter Selektion. (SZ, 7.6.15)
[5] Die Einrichtung von separaten Klassen nur für Hochbegabte
– was vormals nach Elitenerhaltung, nach Kaderschmiede für die Leistungsgesellschaft roch
– wird heute als zutiefst demokratisch
befürwortet, weil so die Kinder gefunden werden, die nicht wegen ihrer Herkunft herausstechen, sondern wegen ihrer Anlagen
(SZ, 25.2.19). Generell werden Bedenken laut, dass das Gymnasium, eine ehemalige Eliteneinrichtung, die in Deutschland seit einigen Jahren für die Hälfte eines Jahrgangs oder sogar mehr geöffnet wird
, die Anforderungen sinken
lässt und so in seiner Selektionsfunktion versagt, womit die gereizte Erwartung gedeiht, die Schule dürfe vor allem keine Chancen verbauen
(SZ, 11.5.19).
[6] Das ist auch dann der Fall, wenn Schüler dank penetranter psychologischer Vorbildung schon mit dem Standpunkt antreten, in ihrer Persönlichkeit besäßen sie das entscheidende Instrument ihrer Erfolgskarriere und hätten das entsprechend einzusetzen. Die moderne Schule baut diese Art des affirmativen Umgangs mit Konkurrenzvorgaben zwar gerne in die Unterrichtsgestaltung ein und perfektioniert damit ihr moralisches Erziehungsprogramm. Die Konsequenz fällt dann aber oft genug so aus, dass die heranwachsenden Selbstoptimierer ihr falsches Selbstbewusstsein selbst nur unter Einsatz psychologischer oder auch pharmazeutischer Lebenshilfen aushalten. Letztere lassen die ehrgeizigen Eltern ihnen verschreiben – und müssen sich ihrerseits von einem Bildungsforscher übersteigerte Notengier
nachsagen lassen, wenn sie so tun, als wäre das Leben zu Ende, wenn das Kind den Durchschnitt für den Übertritt nicht schafft und auf die Realschule gehen muss
(SZ, 24.11.18).
[7] Die spezielle Heuchelei von Interesse, die sich Schüler angewöhnen, trifft auf und bedient eine spiegelbildlich sympathische Art, zu der es die Spezies des Lehrers bringt: Ausgerechnet er, dem das Benoten und Bewerten im Laufe seines Berufslebens leicht zur zweiten Natur gerät, mokiert sich im Lehrerzimmer über Schüler, die sich nur für Noten interessieren – und nicht für die Bildungsperlen, die er tagtäglich umsonst in den Saustall wirft.
[8] Das illustriert eine neue „App“ namens Lernsieg
: Sie soll das Missverhältnis ausgleichen, dass Schüler es zwar unentwegt mit Lehrern zu tun bekommen, die ihr Verhalten und ihre Leistungen benoten, sie selbst aber keine institutionalisierte [!] Möglichkeit haben, auch ihre Sicht auf den Unterricht, das Können, die Persönlichkeit der Lehrer kundzutun. Ihren Unmut, sei er berechtigt oder nicht, können Schüler allenfalls als persönliche Einzelkämpfer äußern, indem sie sich aggressiv oder resigniert der Schule verweigern, deren Repräsentanten als ihre Feinde empfinden und sich damit oft selbst am meisten schaden.
Und wonach benoten die Schüler dann die Lehrer? Die Kriterien, die auf einer Skala von einem bis zu fünf Sternen bemessen wurden, waren etwa Pünktlichkeit, Vorbereitung, Motivationsfähigkeit. Geduld, Fairness.
(SZ, 13.12.19) Der Sieger solch institutionalisierter Rache steht fest.
[9] Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.
(Art. 131 Bayerische Verfassung)
[10] In der Lernhilfe G8 Turbo Teacher Deutsch – Schnell zu besseren Noten: Lerne, was du wirklich brauchst
(!) wird zum Thema Klassenfahrten folgende Musterlösung angeboten: Sicherlich ist einzuräumen, dass der Unterricht zu häufig ausfällt. Dies ist in der Tat zu beklagen, schließlich sollen wir in der Schule etwas lernen. Es fragt sich nur, wofür der Unterricht ausfällt.
Dann der geniale synthetische Einfall: Klassenausflug ins KZ Dachau
!
[11] Wenn Schüler Fridays for Future veranstalten, also zur Rettung des Weltklimas und ihrer Zukunft während der Unterrichtszeit auf die Straße gehen, dann verbucht das die öffentliche Meinung als gelungene Moralerziehung, wie der Respekt zeigt, den sie dem Protest gönnt. Man lobt die Jugend dafür, dass sie sich einer ideellen Verantwortlichkeit stellt und im Namen so fragloser Werte die wirklichen, die politischen Verantwortungsträger an ihre Pflichten erinnert. Der vereinnahmende Applaus gilt dem moralischen Prinzip des Engagements, ein Wohlgefallen, in das sich der inhaltliche Gegensatz, der den Beschwerden an der amtlichen Klimapolitik zugrunde liegt, auflösen sollte, spätestens, wenn man die jugendlichen Idealisten vor- und fürsorglich auf den Wert des Kompromisses mit der Realität verpflichtet. Ansonsten rechtet die Öffentlichkeit nach dem Muster von Pro und Kontra – Wettstreit zwischen zwei Werten: Bildung und Klimaschutz
(SZ, 1.6.19) – über die Frage, ob man dafür Schule schwänzen darf. Zu oft jedenfalls nicht – Schulpflicht bleibt Schulpflicht.
[12] Weil in dieser verkehrten Art, über Gott und die Welt nachzudenken, nicht die Sache oder das Subjekt, das sie ins Werk setzt, die Identität der Gesichts- und Standpunkte stiftet, kommt es vor, dass bei in der Öffentlichkeit realiter strittigen Themen wie der Vorratsdatenspeicherung völlig fiktive Aspekte dahergebracht werden und der Schüler versucht, mit so einem Blödsinn wie „Ein Pro ist, dass die Datenspeicherung Arbeitsplätze schafft“ (weil Arbeitsplatz so gut wie immer guter Grund) ein „Argument“ zu landen. Für das Lernziel ist das aber ziemlich egal, weil das Thema nur der Stoff ist, an dem diese Denkmethode sich ihre Argumentationsform konstruiert. An der Willkür dieser Aspekte-Konstruktion liegt es auch, dass Schüler sich oft selbst nicht sicher sind, ob sie gerade ein Pro- oder Kontra-Argument (Vor- oder Nachteil für wen?) aufschreiben. – Dass die Schule die allzu freihändigen Einfälle neuerdings steuert, indem sie – materialgestützte Erörterung
– anerkannte Statements und Standpunkte als „Material“ vorgibt, entbindet den Schüler weder vom Einbringen eigener Gesichtspunkte noch bringt es eine Spur Objektivität in diese Denkart. – Im auf nationaler Schulebene durchgeführten Wettbewerb „Jugend debattiert“ müssen die Teilnehmer die Position, von der sie überzeugen sollen, sinnigerweise kurz vor der Debatten-Runde auslosen.
[13] Selbstverständnis des Fachs Geschichte, in: Lehrplan Geschichte, Gymnasium Bayern – gilt für alle Schulstufen
[14] Geschichte und Geschehen, Berufliche Oberschulen, 2012, S. 12
[15] Die Willkür solcher Geschichtskonstruktion zeigt auch die Geschichte der Geschichtsbilder selbst, wobei diese je nach System oder Nation wechseln: So lernten Schüler im Dritten Reich passenderweise, dass wir nicht Athen, sondern Sparta unser Abendland verdanken. – Die heutige Schuldidaktik unterstellt ganz selbstverständlich, dass jede Nation sich das ihr passende Geschichtsbild zurechtzimmert, sodass die damit ebenso selbstverständlichen Gegensätze im Namen der Integration ausländischer Schüler als nette „Vielfalt“ zu tolerieren sind: Was bedeutet Prinz Eugen für eine aus Deutschen, Ungarn und Türken gemischte Lerngruppe: ‚Befreier‘, ‚Unterdrücker‘ oder ‚Eroberer‘? Die Antwort hierauf lautet wohl, dass sie lernen müssen, kulturelle Vielfalt auszuhalten [!] und zu akzeptieren.
(bpb: Interkulturelles Lernen im Geschichtsunterricht, 2009)
[16] Geschichte, Jahrgangsstufe 6, lehrplanplus.bayern.de
[17] Buchners Kolleg Geschichte 11, Neue Ausgabe Baden-Württemberg, Bamberg 2010, S. 190
[18] Forum Geschichte 11, Berlin 2009, S. 181
[19] Zeitgemäß hat sich diese Grundeinstellung zu den Anforderungen vom Inhalt der gelernten Qualifikation zu emanzipieren: Natürlich kann heute niemand genau wissen, wie sich die Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Doch in einem Punkt sind sich die Fachleute einig: Beschäftigte werden andere Qualifikationen benötigen, um Beschäftigte zu bleiben.
(SZ, 27.12.17) Oder: Heute müssen Lehrer ihre Schüler auf Technologien vorbereiten, die erst noch erfunden werden müssen.
(SZ, 16.7.17) Wenn im Lehrplan steht: In einer Wissensgesellschaft ist Bildung von zentraler Bedeutung, Kompetenzentwicklung ein lebenslanger Prozess
, dann heißt das als Erwartung an Fachkräfte, dass die Fähigkeit, sich immer wieder in neue Herausforderungen einzuarbeiten, eine absolute Basiskompetenz
(ebd.) ist. Diese „absolute Basiskompetenz“ selbst ist also nicht fachlicher, sondern moralischer Natur, sie versteht sich als der Sammeltitel für Tugenden, wie Kapital und Staat sie gerne sehen und erzwingen: Flexibilität und Anpassungsbereitschaft, Leistungsorientierung unter welchen Vorgaben auch immer.