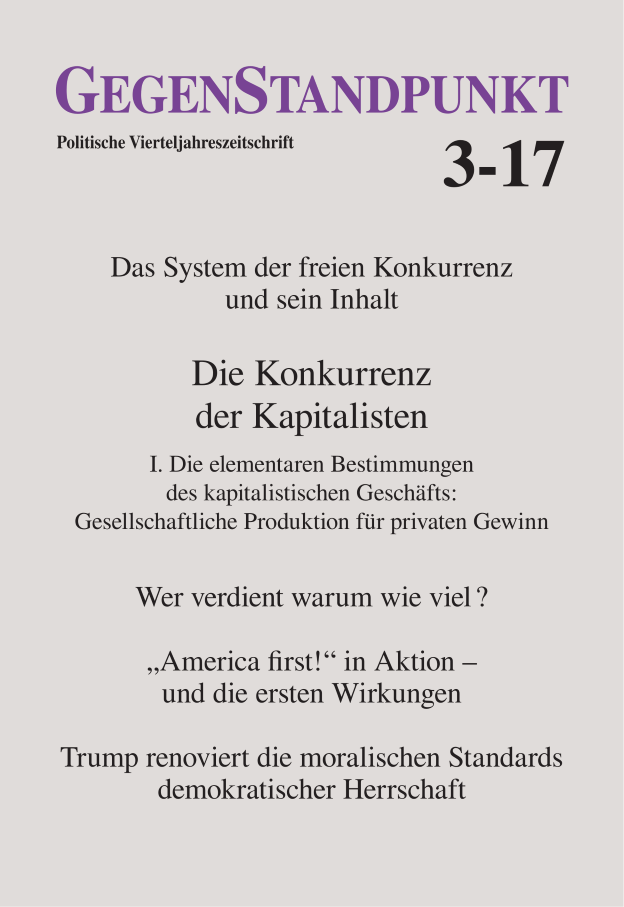Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Das ‚Potsdamer Modell‘ der IG BCE und die Ausdehnungsvereinbarung der IG Metall in Sachen Zeitarbeit
Kleine aber feine Fortschritte deutscher Tarifpolitik
Ein gutes Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung hat sich die IG BCE ein hohes tarifpolitisches Ziel gesetzt, nämlich die Angleichung der Regelarbeitszeit in der ostdeutschen Chemie-Branche von 39 Stunden auf das West-Niveau von 37,5 Stunden, und das bei vollem Lohnausgleich. In diesem Unterschied zwischen Ost und West macht sie den entscheidenden Grund dafür dingfest, dass im Osten die Chemie nicht stimmt. Im Mai 2017 ist es dann nach insgesamt zweijährigen Verhandlungen endlich so weit, in Potsdam werden alle Ziele „zu 100 % erreicht“ und die IG BCE kann in ihrer Kampagnenzeitung frohlocken: „90 Minuten mehr Freizeit: Jetzt stimmt die Chemie!“
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Das ‚Potsdamer Modell‘ der IG BCE und
die Ausdehnungsvereinbarung der IG Metall in Sachen
Zeitarbeit
Kleine aber feine Fortschritte deutscher
Tarifpolitik
Das ‚Potsdamer Modell‘
Ein gutes Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung
hat sich die IG BCE ein hohes tarifpolitisches Ziel
gesetzt, nämlich die Angleichung der Regelarbeitszeit in
der ostdeutschen Chemie-Branche von 39 Stunden auf das
West-Niveau von 37,5 Stunden, und das bei vollem
Lohnausgleich. In diesem Unterschied zwischen Ost und
West macht sie den entscheidenden Grund dafür dingfest,
dass im Osten die Chemie nicht stimmt. Im Mai 2017 ist es
dann nach insgesamt zweijährigen Verhandlungen endlich so
weit, in Potsdam werden alle Ziele zu 100 %
erreicht
und die IG BCE kann in ihrer
Kampagnenzeitung frohlocken: 90 Minuten mehr Freizeit:
Jetzt stimmt die Chemie!
Eine einzige Erfolgsgeschichte also. Abhaken muss man
dafür nur, dass zum einen eine derart aus dem Rahmen
fallende Errungenschaft hier und heute nicht anders zu
haben ist denn in Gestalt der Aussicht auf ihre Umsetzung
in realistischen Drittelportionen von 2019 an, bis in
sechs Jahren dann die Chemie endgültig stimmt: 2023:
In diesem Jahr wird der letzte materielle Unterschied
zwischen den Beschäftigten der Chemie in Ost und West
wegfallen.
Und zum anderen darf man die 90 Minuten
mehr Freizeit
keineswegs damit verwechseln, dass 37,5
Stunden von 2023 an so etwas wie eine Regelarbeitszeit
wären. Das hieße nämlich, die Verfügbarkeit ostdeutscher
Chemie-Arbeitskraft zu beschränken, und dazu hat der
Verhandlungsführer der Gegenseite gleich zu Beginn das
Nötige klargestellt: Wenn alle weniger arbeiten,
bräuchten wir auf einen Schlag mehr Arbeiter, wo sollen
wir die herbekommen?
(Thomas
Naujoks, rbb-online.de, 21.11.16) Diese Sorge
erspart das ‚Potsdamer Modell‘ den Arbeitgebern mehr als
gründlich, indem es gleich überhaupt die Tradition
einer brancheneinheitlichen Arbeitszeit zur Restgröße
macht
:
„Im Normalfall sollen künftig Betriebsrat und Geschäftsführung festlegen, welche Wochenarbeitszeit jeweils als Vollzeitarbeit gilt, abhängig davon, was sich die Beschäftigten wünschen und welches Arbeitszeitvolumen der Betrieb benötigt. Je nach Höhe variiert dann auch der Monatslohn. Die Grenzen setzt ein neuer tariflicher Korridor von 32 bis 40 Stunden je Woche. Auch für einzelne Betriebsteile oder Arbeitnehmergruppen, etwa Schichtarbeiter, soll die vereinbarte Vollzeitarbeit unterschiedlich ausfallen können. Daneben sollen die Betriebsparteien zusätzlich einen ‚individuellen Korridor‘ einführen können.“ (FAZ, 10.5.17)
Der große Erfolg der Kampagne Keine Zeit zu
verschenken
heißt also im Klartext: Zwischen dem
nahezu Fünffachen von 90 Minuten mehr Freizeit
–
mit entsprechenden Abschlägen – und der Überschreitung
sogar der bisherigen 39 Stunden als neue
Normalarbeitszeit ist alles drin. Und was am Ende
praktisch für die verschiedenen Beschäftigten der
einzelnen Betriebe herauskommt, welches Arbeitsvolumen
der Betrieb in seinen verschiedenen Abteilungen nämlich
jeweils gerade benötigt, das teilt ihnen ihr Betriebsrat
mit... Dass sich die Umsetzung der errungenen
Arbeitszeitreduzierung derart einsinnig als flexibles
Disponieren der Betriebe über die Arbeitszeit ihrer
Angestellten buchstabieren kann, ohne größere
Irritationen auszulösen, hat seinen einfachen Grund
darin, dass diese Freiheit in Potsdam nicht erst
hergestellt wird, sondern der Einigung als ‚Normalfall‘
längst vorausgesetzt ist. Ein kleiner Überblick über die
Arbeitszeitmodelle der Vor-Potsdam-Ära:
„Durch Vereinbarung auf betrieblicher Ebene kann für einzelne Betriebsteile oder größere Arbeitnehmergruppen eine längere oder kürzere Wochenarbeitszeit festgelegt werden. Hierfür steht ein Korridor zwischen 35 und 40 Wochenstunden zur Verfügung. Bezahlt werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden... Die festgelegte Wochenarbeitszeit muss nicht in jeder einzelnen Woche, sondern kann im Rahmen eines ‚Verteilzeitraums‘ von bis zu 36 Monaten durchschnittlich erreicht werden... Mehrarbeit – also Arbeitsstunden, die über die vereinbarte Wochenarbeitszeit hinausgehen und nicht im Rahmen eines Verteilzeitraumes (s.o.) ausgeglichen werden – wird gemäß Chemietarifvertrag nicht mehr bezahlt, sondern durch Freizeit ausgeglichen. Wenn der Zeitausgleich innerhalb eines Monats erfolgt, fällt auch kein Mehrarbeitszuschlag an. Dadurch gibt es in der Chemie praktisch keine bezahlten Überstunden mehr... Die verschiedenen Flexibilisierungsmaßnahmen können weitgehend miteinander kombiniert werden.“ (www.bavc.de)
Die Beschäftigten der Chemie-Branche sind also bereits
gut vertraut mit einem eher losen Zusammenhang der von
ihrer Gewerkschaft ausgehandelten Wochenarbeitszeit und
ihrer eigenen Arbeitswoche, damit nämlich, dass so viel
oder so wenig gearbeitet wird, wie ihr Betrieb ansagt –
und bezahlte Überstunden kennen sie nur noch vom
Hörensagen. Was da in den Betrieben längst am Werk ist,
ist nicht einfach Wildwuchs, sondern die Anwendung des
bestehenden Flächentarifvertrags, den die IG BCE im
Zusammenspiel mit ihrem Sozialpartner in den letzten
Jahren mittels Flexibilisierungen, Öffnungen und
Optionen
zu dem absurden Konstrukt eines
ausgeklügelten Systems der Abweichungen von der
branchenverbindlichen Regelarbeitszeit ausgearbeitet hat.
Auf dieser soliden Grundlage fußt der
gestalterisch-modellbildende Fortschritt, den die IG BCE
sich zugutehält: Mit dem Potsdamer Modell haben wir
einen zukunftsweisenden Abschluss. Arbeitszeit
betrieblich innerhalb fester Leitplanken bedarfsgerecht
festzulegen, ist bundesweit einmalig.
(Peter Hausmann, Verhandlungsführer der IG BCE,
9.5.17) Das Eigenlob ist wirklich gekonnt: Die
Gewerkschaft hat einen zukunftsweisenden Abschluss
erreicht, der vorsieht, die Arbeitszeit
betrieblich festzulegen! Den Schein universeller
und verbindlicher Zuständigkeit für diese Frage, bis eben
mühevoll in Form flächendeckend zugestandener
Ausnahmeregeln aufrechterhalten, behandelt die IG BCE
einfach als Geschwätz von gestern und stellt das Resultat
entschieden konstruktiv vom Kopf auf die Füße: Dann ist
eben die praktisch ohnehin von den Arbeitgebern errungene
betriebliche Freiheit der Arbeitszeitgestaltung der
positive Ausgangspunkt, und der betriebliche Bedarf
avanciert in aller Form zum flexibel-normsetzenden
Kriterium für „Vollzeit“ – natürlich nur unter dem
Schutzschirm einer garantiert zukunftsfesten
gewerkschaftlichen Regelungsmacht, die dafür
feste Leitplanken setzt. Und die sind schon ein
interessantes Bild, unterstellen sie doch – einmal ernst
genommen – den betrieblichen Umgang mit der Arbeitszeit
als irgendwie unbekömmliche Praxis, die es einzuhegen
gilt. Diese eher rückwärtsgewandte Sicht verschwindet
ganz hinter der zukunftsweisenden Deutung der IG BCE,
dass ihre Leitplanken die Sache im guten Sinn regeln; sie
ist bei den Betriebsparteien in besten Händen, sind doch
deren Festlegungen quasi automatisch ‚bedarfsgerecht‘ für
beide Seiten – andernfalls würden sie sich ja nicht
darauf einigen.
Wenn die von der IG BCE gesetzten Leitplanken den
Spielraum dessen abgeben, was am Ende für die
Arbeitnehmer an Arbeitszeitmodell herauskommt, definieren
sie recht betrachtet auch den Freiraum für deren
bedarfsgerechte Flexibilität
. Insofern ist die
Ausweitung, die die alten Korridore im Zuge ihrer
Umwidmung zu nun aber wirklich festen Leitplanken
erfahren, gleichzeitig eine Erweiterung der Möglichkeiten
der Arbeitnehmer, für die die Gewerkschaft den ganzen
Aufwand schließlich betreibt, und die
Gewerkschaftsfunktionäre stehen nicht an, den
Beschäftigten zu erklären, welche Perspektiven sich ihnen
damit auftun. Z.B. der Landesbezirksleiter Nordost im
Selbstinterview der Kampagnenzeitung:
„Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich nach der Ausbildung in der chemischen Industrie übernommen wurde. Da steht man plötzlich vor der Frage, ob man bis zur Rente in einer gleichbleibenden Wochenarbeitszeit arbeiten will. Dabei ist doch klar, dass es Phasen gibt, in denen ich mal weniger arbeiten will. Wenn ich mich zum Beispiel um meine Kinder oder Hobbys kümmern möchte. Oder ich möchte wieder mehr arbeiten, wenn die Kinder aus dem Haus sind und Langeweile aufkommt. Hier brauchen wir einfach mehr Flexibilität. Wie schafft der neue Manteltarifvertrag diese Flexibilität? Indem er die Möglichkeit schafft, dass Betriebsrat und Arbeitgeber im Betrieb oder in Betriebsteilen eine betriebliche Arbeitszeit festlegen können. So können sie zum Beispiel gesundheitsschonendere Schichtsysteme entwickeln.“
Wenn das tatsächliche Ausschöpfen der großartigen neuen
Möglichkeiten, Beruf und Familie mittels Lohneinbußen
besser vereinbar, Schichtarbeit länger aushaltbar und das
Rentenalter durch lebensphasengerechtes Haushalten mit
der vorgegebenen Lebensarbeitszeit am Arbeitsplatz
erreichbar zu machen, dem Betriebsrat überantwortet wird,
dann ist gleich zweierlei garantiert. Erstens natürlich,
dass dieses Gremium, nach entsprechenden
gewerkschaftlichen Schulungen mit richtig guten Ideen
und Projekten
ausgestattet, in der Umsetzungsphase ab
2019 auch wirklich das Beste für die Arbeitnehmer
herausholt. Und zweitens die Beachtung der entscheidenden
Prämisse aller guten Ideen: Verantwortungsvolle
Arbeitnehmervertreter vor Ort wissen auch ohne Blick in
das Betriebsverfassungsgesetz, dass Gesundheitsschonung
und die Möglichkeit zur Hobbypflege im Betriebswohl ihr
hartes Kriterium haben – alles andere würde ja die
Arbeitsplätze selbst aufs Spiel setzen, die da
arbeitnehmergerecht gestaltet werden sollen.
*
Gewerkschaftliche Interessenvertretung durch ihre Überantwortung an den Betriebsrat – dieser fortschrittliche Schachzug bleibt nicht der IG BCE vorbehalten:
Der Tarifvertrag der IG Metall zur Zeitarbeit
Für einen kurzen Moment wundert sich die Republik: Gerade
erst hatte der Gesetzgeber den boomenden Einsatz von
Zeitarbeit in deutschen Betrieben begrenzt und sich damit
vonseiten der Gewerkschaften neben viel Lob unter anderem
die Kritik zugezogen, dass die Einschränkung der
Verleihfristen nicht weit genug gehe. Und im nächsten
Moment macht die IG Metall von einer weise ins Gesetz
eingebauten Klausel Gebrauch, die eine tarifvertragliche
Abweichung von den gesetzlichen Bestimmungen erlaubt, und
vereinbart im ersten Anwendungsfall dieser gesetzlichen
‚Privilegierung‘ der Tarifparteien eine Ausweitung der
Leiharbeitsfristen bis zu vier Jahren, mit den Worten
einer teilnehmenden Öffentlichkeit Leiharbeit als
Dauerzustand
(FR.de,
19.4.17). Das erstaunt nicht nur die
Fraktionssprecherin der Linken für Arbeit und
Mitbestimmung Jutta Krellmann: Wenn das Gesetz am Ende
besser ist als der Tarifvertrag, dann fragt sich der
mündige Gewerkschafter, wozu er eine Gewerkschaft
braucht.
Rio Antas, IG-Metall-Vorstand mit
Fachbereich Tarifpolitik, kann da weiterhelfen:
„Eine Höchstverleihdauer von vier Jahren sieht die IG Metall als Ausnahme an, um betrieblich über den tarifvertraglich geregelten Rahmen hinaus bessere Beschäftigungsbedingungen zu sichern. Nach Einschätzung der Gewerkschaft ergänzen die Regelungen des Tarifvertrages das neue Gesetz. Dieses regele, dass die Leihbeschäftigten höchstens 18 Monate einem Betrieb überlassen werden dürfen. Das könnten Zeitarbeitsfirmen auch mit Rotationsmodellen umsetzen, indem sie ihre Beschäftigten austauschen, sagt Rio Antas. Nach dem Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie dürften die Betriebe ihre Leiharbeiter zwar sechs Monate länger beschäftigen – dann aber seien sie verpflichtet, eine unbefristete Übernahme anzubieten.“ (haz.de, 19.4.17)
Bei rechtem Licht betrachtet handelt es sich bei der Ausweitung der zulässigen Verleihdauer also gar nicht um eine Verschlechterung, weil die gesetzliche Regelung sonst mit Rotationsmodellen einfach umgangen würde. Eine Verlängerung um sechs Monate ist folglich im Sinne derer, die sonst schon vorher rotieren müssten. Warum dann die unbefristete Übernahme stattfinden sollte, deren Umgehung mittels fristgerechter Rotation eben noch unterstellt war, bleibt zwar ein Rätsel. Das muss aber auch gar nicht sein, denn auch für den Bedarf nach längerer befristeter Anstellung von Leiharbeitern hat die IG Metall eine konstruktive Lösung parat. Sie kann sich auch eine Verlängerung der Verleihdauer auf bis zu 48 Monate vorstellen:
„Da es sich bei solchen Vereinbarungen um ein Geben und Nehmen handele, könnten die Betriebsräte als Gegenleistung für eine 48-monatige Überlassungsdauer andere Vorteile – etwa übertarifliche Entlohnung oder Sondergratifikationen – für Leiharbeiter verlangen, so der Gewerkschaftssprecher. In diesem Sinne eröffne die Vier-Jahres-Grenze die Möglichkeit, bessere Beschäftigungsbedingungen zu sichern.“ (FR.de, 19.4.17)
Keine Frage, die IG Metall hat ihre Lektion in Sachen Leiharbeit gelernt: Den Anforderungen der Betriebe gilt es sich nicht entgegenzustellen, sondern sie bedingungslos zu unterschreiben, um sie auszunutzen: Das ist die Lösung! In diesem Sinne gibt die Gewerkschaft den Betriebsräten das machtvolle Instrument in die Hand, Verschlechterungen im Verhältnis zur gesetzlichen Regelung einzuräumen, um im Gegenzug möglicherweise Verbesserungen als Preis verlangen zu können. So lässt sich aus dem neuen Gesetz zur Leiharbeit noch richtig etwas im Sinne der Leiharbeiter herausholen. Und ganz nebenbei gibt die IG Metall damit der gesetzlichen Privilegierung der Tarifpartnerschaft genau den gemeinten Inhalt: Die nationalen Standortbedingungen werden sozialpartnerschaftlich, also friedlich, optimiert.