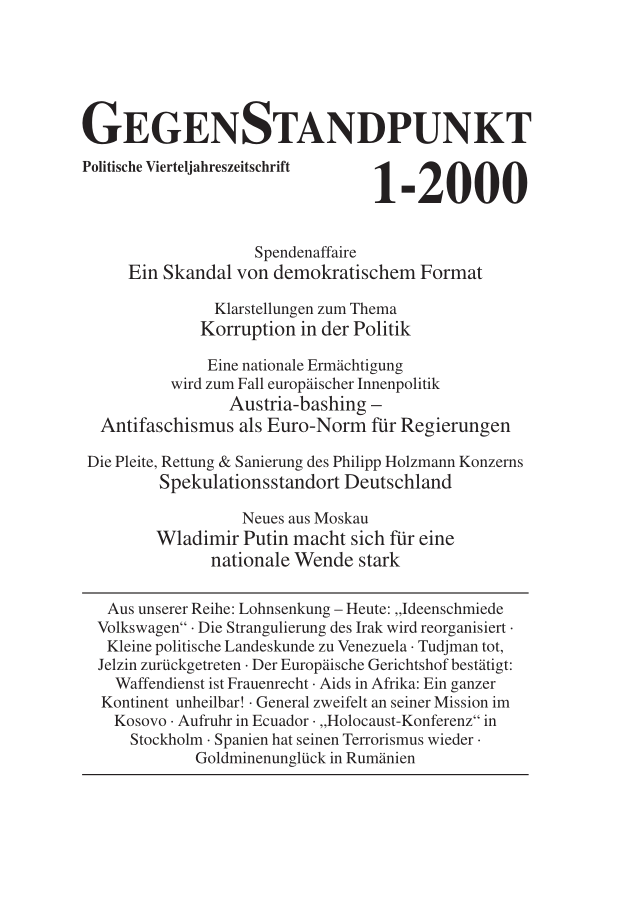Die Pleite, Rettung & Sanierung des Philipp Holzmann Konzerns
Spekulationsstandort Deutschland
Keiner will die Pleite Holzmanns als schlichten Fall von Fehlspekulation und Überakkumulation gelten lassen; stattdessen wird auf einmal „Missmanagement“ und „kriminelle Energie“ statt „solider Spekulation“ ausgemacht. Die anstehende Kapitalvernichtung, die auch die Kreditmacht der beteiligten Banken gefährdet, ruft den Staat auf den Plan, der mit einer Staatsbürgschaft neues Spekulationsvertrauen in Holzmann stiften will. Gleichzeitig bieten die Holzmann-Proleten ihren Sanierungsbeitrag an: 6 Prozent Lohnabschlag – fertig ist das Gemeinschaftswerk von Staat, Kapital und Arbeit, in dem alle Gegensätze in einen gemeinsamen Dienst am Standort Deutschland überführt sind.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die Pleite, Rettung & Sanierung des
Philipp Holzmann Konzerns
Spekulationsstandort
Deutschland
1. Die Pleite – Missmanagement und kriminelle Energie statt solider Spekulation
Philipp Holzmann, der zweitgrößte Baukonzern der Republik, hat Schulden akkumuliert – bis 1997 waren es dreieinhalb Milliarden. Der Vorstand wird wegen erwiesener Unfähigkeit in die Wüste geschickt; die Banken, die Gläubiger und Anteilseigner zugleich sind, gewähren dem „angeschlagenen“ Konzern Zahlungsaufschub und zusätzliche Liquidität, damit aus den Schulden wieder profitable Geschäftsmittel werden. So kommt die Firma auf einen „guten Weg“. Im November 1999 folgt ein Eingeständnis. Der neue Vorstand hat bei der Überprüfung der Bilanzen „völlig überraschend“ zusätzliche, bisher „unbekannte Altlasten“ in Höhe von zweieinhalb Milliarden entdeckt. Die hat der alte Vorstand nach Lesart des neuen offenbar durch „geschickte“ Buchführung in den Büchern „versteckt“, also in rechts- und sittenwidriger Weise „vertuscht“. Die Entdeckung ist prekär, weil die neuen „Altlasten“ Kredite offenbaren, die bedient werden müssen, aus den Erträgen Holzmanns aber nicht bedient werden können. Das Eingeständnis ruft erneut die Banken auf den Plan, die die Lage sondieren und zu dem Schluss kommen, dass angesichts einer Überschuldung von über sechs Milliarden und mit Blick auf die Geschäftsaussichten von Holzmann die Risiken einer Sanierung per zusätzlichen Kredit in keinem Verhältnis zu deren Erfolgsaussichten stehen. Sie erteilen einer weiteren Spekulation auf künftige Erträge Holzmanns, die ihren Kreditansprüchen genügen, eine Absage. Sie gehen davon aus, dass die – mit und ohne Sanierung – sowieso fällige Wertberichtigung ihrer Bilanzen, die Entwertung ihres Kredits zum jetzigen Zeitpunkt, allemal den unkalkulierbaren künftigen Verlusten vorzuziehen ist, die mit einem Scheitern der Sanierung drohen. Damit ist die Zahlungsunfähigkeit von Holzmann besiegelt und der Konzern ist pleite.
Business as usual, sollte man meinen. Da hat sich eine Baufirma, wie das so üblich und sachlich naheliegend ist, an der Immobilienspekulation beteiligt – und sich verspekuliert. Kann passieren, muss ja irgendwann passieren, bei diesem spekulativen Geschäft. Bei aller Aufgeregtheit, die der big bang in der Öffentlichkeit hervorruft, steht fest, dass der Fall alles andere als eine Sensation ist. Seit Jahren machen Baufirmen Pleite, fliegen Immobilienspekulationen auf, in die ehrenwerte Bankhäuser mitsamt ihren Landesregierungen ebenso verwickelt sind wie „exzentrische Baulöwen“ vom Schlage Schneiders. Kenner wissen schon lange, dass angesichts der „Überkapazitäten im Baugewerbe“ eine „Bereinigung des Marktes überfällig“ ist. Aus solchen und ähnlichen Lageeinschätzungen geht immerhin hervor, dass zuviel Kapital im Baugewerbe und Immobiliengeschäft tätig ist; zuviel im Verhältnis zu den Geschäftsgelegenheiten, die es dort gibt. Das ist der banale Sachverhalt, der sich in der Holzmann-Pleite zeigt.
Der jetzige Zustand der Baukonjunktur lässt sich auch historisch ausdrücken, nämlich als eine Folge jener „Goldgräberstimmung“, die nach dem Anschluss der DDR aufgekommen ist. Immobilienhändler und Baufirmen haben den politischen Beschluss zur Kapitalisierung des Ostens in der ihnen vertrauten Weise wahrgenommen, sprich: die Zone als ein großes, zukunftsträchtiges Aufbauprojekt betrachtet und in diesem Sinne zum Gegenstand einer gewaltigen Spekulation gemacht. Baufirmen wie Holzmann haben mit immensen Kreditsummen Grundstücke erworben, Wohn- und Bürogebäude, Supermärkte und Gewerbezentren darauf gebaut, in der Erwartung, dass sich dort lohnende Geschäfte entwickeln, die ihre Miet- und Zinsrechnungen rechtfertigen. Darüber sind sie groß geworden, von nationalen Marktführern zu international agierenden Multis aufgestiegen. Jetzt, nach 10 Jahren, ist die Zukunft, auf die sie spekuliert haben, gekommen, und es ist unübersehbar, dass das Projekt „Aufbau Ost“ eine Fehlspekulation war: Aus den „blühenden Landschaften“ ist nichts geworden, in den Gewerbezentren stellt sich zu wenig Gewerbe ein, die Mietwohnungen werfen nicht den kalkulierten Mietzins ab und Büroräume bleiben massenhaft leer. Daran bemerken Firmen wie Holzmann, dass die Projekte, auf die sich ihr Kreditengagement gerichtet hat, sich nicht rentieren. Es macht sich jetzt geltend, dass das Wachstum der Firma Holzmann das Wachstum von spekulativem Kapital war: Dass Holzmann groß geworden ist, hat nun definitiv die Bedeutung, dass seine Schulden groß geworden sind und eine Dimension erreicht haben, der die Firma auch mit ihrer Größe nicht mehr gewachsen ist. So erfährt sie, was es heißt, dass so viele, wie im Baugewerbe und mit Immobilien verdienen wollen, gar nicht verdienen können; ein paar sind zu viel, die Gelegenheiten reichen nicht aus, um alle Gewinnansprüche oder, was dasselbe ist, die Gewinnansprüche aller zu befriedigen. Einer von denen ist jetzt Holzmann. Der Konzern hat nicht bloß ein paar „Überkapazitäten“ zu verkraften, sondern sich selbst als Teil der allgemeinen „Überkapazität“ erwiesen. An ihm zeigt sich daher nicht nur das Allgemeine, dass zu viel Kapital auf dem Baumarkt tätig ist, sondern vor allem auch das Entscheidende der Konkurrenz: welches Kapital das ist.
*
Als Notwendigkeit der Konkurrenz wollen die Wirtschaftsfachleute der Öffentlichkeit die Pleite Holzmanns nur sehr bedingt gelten lassen; sie finden an einer anderen „Notwendigkeit“ mehr Geschmack. Noch jeder, der sich zu der Affäre äußert, kann drei bis fünf Fehler aufzählen und damit Schuldige benennen, die die Pleite verursacht hätten. Sie sitzen in den Führungsetagen, im Vorstand der Firma, im Management, im Aufsichtsrat, in den Vorständen der Banken, eben da, wo die „Verantwortung“ zu Hause ist. Die wird aber nur wahrgenommen, wenn das Betriebsergebnis stimmt. Wenn nicht, dann haben die Verantwortlichen ihre Pflichten missachtet, und als Führungskräfte „versagt“. Diesen für den gesunden kapitalistischen Menschenverstand unverzeihlichen Haupt- und Generalfehler des Wirtschaftens haben die Holzmann-Manager verbrochen:
„Binders Vorgänger Lothar Mayer setzte auf Hochbau in Asien, Immobilien-Vermarktung und -Bau auf eigene Rechnung in Deutschland und kaufte die Nord-France. Schlimmer hätte es nicht kommen können: Alle diese Aktionen fuhren Millionenverluste ein.“ (Focus, Nov. 99)
Hätten die Manager doch nur die Focus-Redaktion konsultiert! Die hätte ihnen sagen können, dass Verluste einzufahren nicht der Sinn einer Kapitalinvestition ist. Dann hätten die Manager gewusst, dass man Geschäfte mit Grundstücken und Immobilien nicht „auf eigene Rechnung“ macht, und beim Aufkauf ausländischer Firmen beherzigt, dass nur gute Ware wirklich gut ist; und wahrscheinlich hätten sie auch bedacht, dass eine Expansion in den boomenden Asienmarkt keinen Sinn macht, wenn man hernach von einer „Asienkrise“ heimgesucht wird. Statt dessen haben besagte Manager ihre grandiose Fehlleistung mit einer Serie weiterer Verfehlungen fortgesetzt. Die schlechten Bilanzen, so ist zu hören, wurden geschönt, um faule Kredite durch erschwindelte zu retten. Und als die Rechnung nicht aufging, die Bilanzen sich nicht verbesserten, sondern immer schlechter wurden, haben sie ihr „Missmanagement“ mit „krimineller Energie“ jahrelang zu vertuschen versucht. Unter anderem mit Hilfe einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren haltlose Testate und „unrealistische“ Bewertungen jetzt eine ganze ehrenwerte Branche in Verruf bringen. Dass die getürkten Bilanzen der KPMG andererseits nicht eher aufgeflogen sind, wirft die Frage auf: Wo war der Aufsichtsrat? Die Kreditgeber und Aktionärseigentümer von Holzmann, die dort in Personalunion sitzen, haben offensichtlich immer nur an ihre Profite gedacht. Statt ihre „Aufsichtspflicht“ wahrzunehmen und ihre Geld- und Kontrollmacht in Verantwortung umzusetzen, haben sie die Prüfberichte der KPMG „fahrlässig“ gebilligt und immer neue Kredite in die Firma gesteckt, damit sie ihre alten nicht offenbaren müssen. So tut sich ein ganzer Sumpf von Interessensverquickungen und Fehlleistungen auf, bei dem zwangsläufig die einzig senkrechte Verantwortung auf der Strecke bleibt: Aus Geld mehr Geld zu machen.
Der Verdacht, dass die Idee einer seriösen – und dadurch garantiert erfolgreichen – Form der Spekulation zu den eher blöden Einfällen gehört, beschleicht die Ursachenforscher der Holzmann-Krise nicht. Und ebenso wenig haben sie die Sorge, sich als alberne Klugscheißer zu blamieren, wenn sie den Vorwurf breit treten, dass die Manager ex ante hätten wissen müssen, was ihnen, den öffentlichen Experten, ex post immer klar ist: dass das nicht gut gehen konnte. Dem Gestus ihres Durchblicks entnimmt nämlich ohnehin jeder Trottel die Botschaft, die gemeint ist, und den Standpunkt, der sich darin äußert und der gerade in seiner Ignoranz so überaus populär ist: Fanatiker des erfolgreichen Geschäfts werden da „kritisch“, nicht als Partei in der Konkurrenz, sondern als generelle Parteigänger erfolgreichen Konkurrierens. Nur wer Fehler macht, wird vom Markt „bestraft“ – mit dieser Erkenntnis wirft sich der öffentliche ökonomische Sachverstand als ideeller Gesamtaufsichtsrat des Kapitals in Pose, der darüber wacht, dass die Kombination von Kapital und Arbeit sich in jedem Fall in einer ordentlichen Gewinnsumme bilanziert.
Die gleichen Typen, die das Ideal einer Konkurrenz ohne Verlierer in Umlauf bringen, verstehen sich ebenso darauf, mehr ‚Realismus‘, die Märkte betreffend, anzumahnen. Unter Billigung aller verkehrten Argumente in Sachen „Missmanagement“ erinnern sie daran, dass Verlierer zum Markt gehören wie Absteiger zur Bundesliga: „Wir können die Republik nicht konkursfest machen.“ (HB, 25.11.) Der traurigen folgt die frohe Botschaft: Pleitiers wie Holzmann haben auch ihr Gutes, eine heilsame Wirkung auf einen Ausleseprozess, in dem sich nur die Gesunden und Starken durchsetzen. Wenn erfolgreiches Plusmachen, wie sich herausgestellt hat, nicht mehr zu machen ist, wenn die Geschäfte nicht mehr gehen, und der Kredit sich als kaputt erweist, dann ist es der schlimmste Fehler, so zu tun, als wäre der noch zu retten, und weitere Kredite in ein Fass ohne Boden zu schießen. Demnach hätten die Banken den Bankrott schon viel früher vollziehen müssen. Gewiss, auch die Arbeitsplätze wären dann früher perdu gewesen, aber rechtzeitig als unrentabel erkannt, so dass vielleicht ein Teil des vergeigten Kredits eine sinnvollere Anlage gefunden hätte, als eine Beschäftigung zu finanzieren, die nichts taugt.
Die Manager von Holzmann kümmern sich, ob ex post oder ex ante, laufend darum, dass die Kombination von Kapital und Arbeit sich in ihrem Fall lohnt. Sie denken also gar nicht daran, das Urteil der Märkte – Holzmann ist „der Zuviel“ – hinzunehmen, sondern setzen alles daran, dass dieses Urteil andere trifft. Dabei wissen sie nur allzu gut, dass ihr Kredit die entscheidende Waffe in der Konkurrenz ist. Seine Größe und Ausdehnung schafft überhaupt die Freiheit, Verluste als ‚vorübergehend‘ einzustufen und ein schlechtes Geschäftsjahr wieder wettzumachen. Da treffen sich die Kalkulationen des Betriebs mit denen der Banken: Holzmann kann auf Aufträge in einem Volumen von 14 Milliarden verweisen, und die Banken haben die Potenzen in Form von Kredit. Der ist nicht nur in der Lage, die bestehenden Aufträge zu realisieren, sondern auch neue an Land zu ziehen – nicht zuletzt mit Preisangeboten, bei denen die Konkurrenz nicht mithalten kann. Alles spricht also vom Standpunkt des Unternehmens dafür, dass die faulen Kredite in gute umzuwandeln gehen, also wird es versucht. – Wenn der Betrieb die ‚Überzeugung‘ der Banken, dass der neue Kredit sich rentiert, seinerseits mit „optimistischen“ Bewertungen befördert, dann rennt er bei den Banken offene Türen ein. Die kennen solche Techniken aus ihrem eigenen Geschäft und verfügen über genügend Lebenserfahrung, um zu wissen, dass Machenschaften dieser Art eben nur dann „kriminell“ sind, wenn sich die Geschäfte auch mit dem erweiterten Kredit nicht einstellen oder nicht ausreichen, um die Bilanzen tatsächlich zu korrigieren, statt bloß auf dem Papier. Deshalb handhaben sie ihre „Aufsichtspflicht“ mit der gebotenen Großzügigkeit, wohl wissend, dass Geschäfte in diesem Gewerbe anders gar nicht zustande kommen. Pech, wenn sie dann trotzdem nicht zustande kommen. Dann stellt der Austausch des Managements klar, wofür es bezahlt wird.
Dabei braucht man sich gar nichts darüber vorzumachen, dass eine ‚seriöse‘ Bilanzierung sich von einer ‚unseriösen‘ übermäßig unterscheidet, dass also ein neues Management mit den Bilanzen großartig anders verfahren würde als das alte. Denn eines macht es garantiert nicht: die Spekulation beenden. Dann könnte es den Laden nämlich gleich zumachen. Manager verrichten ihr Handwerk, das sie gelernt haben. Als studierte Juristen, Betriebswirte etc. kennen sie sich in den Paragraphen des Aktienrechts aus und in den Bilanztechniken schon gleich. Der gesetzliche Terminus einer „zweckgerichteten Bilanzierung“ ist ihnen ebenso geläufig wie die Sache, die ihm zugrunde liegt. Sie wissen also durchaus, was sie tun, wenn sie die Sollstände zu den Guthaben ins Verhältnis setzen, oder umgekehrt von den Guthaben – den Grundstücken und Immobilien der Firma – auf die „Sicherheit“ der laufenden sowie künftig beanspruchten Kredite „schließen“. Dann bilanzieren sie nämlich „Werte“, die durch ihre eigene Bewertung zustande kommen. Denn der Wert dieser Objekte summiert sich gerade nicht aus objektiven, über jeden Zweifel erhabenen Größen, sondern aus dem erwarteten Gewinn, der aus zukünftigen Verkäufen bzw. Vermietungen hochgerechnet wird. Das mag aussehen wie reine Willkür, ist aber in Wahrheit genau die Spekulation, die alle Welt von ihnen einfordert und für solide befindet, so lange sie gut geht. So haben dann die Staatsanwälte der vierten Gewalt regelmäßig alle Hände voll zu tun, um ihren bescheuerten Ehrgeiz darauf zu richten, die Scheidelinie zwischen Betrug und Spekulation auszuloten:
„Denn die großen Probleme von Unternehmen lagen bisher so gut wie nie in falsch abgearbeiteten Buchungsbelegen, sondern fast immer in Bewertungsfragen … Gerade bei Immobilien gebe es immer wieder Probleme, wenn Grundstücke und Gebäude in Hochpreis-Phasen gekauft würden, hinterher aber im Ertragswert erheblich sänken. ‚Wenn ein großes Objekt mit einer Quadratmetermiete von 35 DM veranschlagt ist und der Markt nachher nur noch 25 oder 30 Mark hergibt, dann kommen im Nu Riesensummen zusammen‘.“ (HB, 25.11.)
Das sind so die „großen Probleme“ im Kapitalismus, der keine Planwirtschaft ist – „im Nu“ kommen „Riesensummen“ zusammen, was ja letztlich beabsichtigt ist. Schade nur, dass die Bewegung der „Preis-Phasen“ – wer die wohl in Gang setzt und in Bewegung hält? – manchmal unverhofft die falsche Richtung nimmt und die ganze Spekulation versaut. Dann ist nicht nur das Management gefordert, sondern auch die Manövriermasse, die das so oder so ausbaden darf.
*
Nach intensivem Nachdenken über den Fall können sich auch die Arbeiter von Holzmann nicht den Einsichten entziehen, die ihnen von ihren Anwälten von der Bildzeitung bis zur Gewerkschaft täglich präsentiert werden: Unfähige Manager haben sich verspekuliert und Arbeiter um die Früchte ihrer Arbeit gebracht, welche Arbeitsplätze heißen; sie sind die Betrogenen der Bilanzbetrüger, die bei ihren Machenschaften auch noch auf die „Hilfe der Banken“ setzen konnten. Erstens können die Arbeiter der Firma schwere Vorwürfe nicht ersparen, wobei sie es für zweckmäßig erachten, ihre Kritik aus dem Blickwinkel einer Unternehmensberatung vorzutragen und mit entsprechenden Empfehlungen an „die da oben“ auszustatten. Sie diagnostizieren schlechtes Management und verlangen, dass die ‚Nieten in Nadelstreifen‘ ausgetauscht werden, damit endlich Leute das Kommando übernehmen können, die etwas von Management ‚verstehen‘. Arbeiter, die so klug daher reden, halten es für eine höchst überflüssige Sache, ein paar Gedanken darauf zu verschwenden, welche Rolle ihnen als ‚Produktionsfaktor Arbeit‘ zufällt, wenn Holzmann rentabel gemacht wird. Und geradezu abwegig erscheint es ihnen, an den Entlassungen und Lohnsenkungsmaßnahmen, die daraus zwangsläufig folgen, den Gegensatz zu bemerken, in dem sie zu ihrer Firma stehen – oder jedenfalls ihre Firma zu ihnen. Statt dessen finden sie die Frage spannend, welcher Vorstand den jeweils anderen übers Ohr gehauen hat, und zollen ansonsten der ziemlich konsequenzenreichen Abhängigkeit von ihrem „Arbeitgeber“ ihren uneingeschränkten Respekt. Denn das leuchtet ihnen ein: Arbeiter brauchen ‚Arbeit‘, weswegen das turnusmäßige Betteln um Beschäftigung Teil ihres Berufs ist: „Arbeitsplätze müssen her, sonst geben wir keine Ruhe mehr!“ (SZ, 24.11.) Die Holzmann-Beschäftigten lassen sich daher auch nicht davon irritieren, dass ihr Ruf nach besseren Managern wie die Forderung klingt, besser und effektiver ausgebeutet zu werden. Ganz so, als ob die „Versäumnisse“ der alten Führungsmannschaft auch aus ihrer Sicht darin bestanden hätten, die jetzt fällige Wertberichtigung mit allen Konsequenzen für sie nicht schon viel früher beschlossen zu haben; so dass die Rücksichtslosigkeit, der sie jetzt ausgesetzt sind, als Folge von Rücksichtnahmen in Sachen Lohn und Leistung erscheint, die die Manager in den vergangenen Jahren gegen jede ökonomische Vernunft praktiziert hätten. Das ist die Lehre, wenn man ‚Nieten in Nadelstreifen‘ anprangert.
Zweitens kennen sie einen weiteren Schuldigen für die geschäftliche Misere, die Arbeitervertreter nicht leiden können: Die Pleite – so ihre kundige Meinung – müsste nämlich gar nicht sein, wenn das Geldkapital sein Geschäft verantwortlicher betreiben würde. Statt dessen lauter Versäumnisse und unverantwortliche Entscheidungen! Aus der Tatsache, dass sie die ersten und sicheren Opfer der Pleite sind, ziehen die Arbeiter die Konsequenz, die Banken an ihre angebliche Dienstpflicht zu erinnern, das Unternehmen weiter zu kreditieren. Für diesen verwegenen Einfall leisten sie sich den Luxus, den kleinen Unterschied zwischen Holzmann und „Holzmännern“ zu ignorieren und ein bisschen so zu tun, als seien auch sie die Kreditempfänger der Banken, also ungefähr derselbe Sanierungsfall wie ihre Firma. Dank dieser symbiotischen Idee leuchtet ihnen eine Unterscheidung zwischen „uns“ und „anderen“ ein, die es in sich hat: Sie kennen da eine Hausbank – die vom Firmenkonkurrenten Hochtief –, deren Verweigerungshaltung beim Kreditgeben schon niederträchtig genug ist: „Die Commerzbank verstellt uns die Zukunft!“ (SZ, 24.11.) Umso schlimmer finden sie es, dass die „eigene“ – die Deutsche Bank –, die „als Großaktionär und an zentraler Stelle im Aufsichtsrat den Baukonzern stets an vorderster Front begleitet“ hat, sich als Kuckuck in der großen Holzmannfamilie erweist: Nun „lässt uns (!) diese Bank im Stich“. (AZ, 23.11.) Und das alles wegen der „lächerlichen Summe“ von 400 Millionen! „Peanuts“ fürs Kreditkapital, vor allem, wenn man bedenkt, was für eine Spur der Verwüstung schon die halbe Summe in den Lohntüten hinterlässt, die das „Humankapital“ als Sanierungsbeitrag anbietet. Ein schöner Gewerkschaftswitz, der sich um die wirklichen Kalkulationen der Banken und Großaktionäre überhaupt nicht kümmert. Die rechnen nämlich genau so, wie es sich für Geldkapitalisten gehört.
*
Grund- und Ausgangslage des Streits der Banken und Großaktionäre bleibt das Faktum, dass der Kredit definitiv kaputt ist. Die Sache, um die sie als Gläubiger und Eigentümer tagelang „ringen“, betrifft natürlich die Frage, ob die Firma liquidiert wird, oder die Geschäfte mit ihr weitergehen sollen. Das ist aber nur die eine Seite, wenn man so will, das Folgeproblem der Sache, die so oder so ansteht: die Vernichtung von Kapital, das sich als fiktiv erwiesen hat. Dass die 6 Milliarden Schulden in den Büchern einfach fortbestehen können, um irgendwann bedient zu werden, ist für die Kreditgeber ausgeschlossen; einig sind sie sich folglich auch darüber, dass eine Entwertung ihres Eigentums ansteht. Als Konkurrenten verhandeln und streiten sie daher erstens über die Frage, bei wem und in welchem Umfang, also zu wessen Lasten, diese Entwertung stattfinden, und zweitens, in welcher Weise sie vollzogen werden soll. Die andere Seite ist ihr eigenes Misstrauen, ob es zur Abwicklung der Firma eine Alternative gibt. Und weil das alles andere als eine sachliche Bestandsaufnahme ist, sondern schon wieder viel mit Spekulation zu tun hat, also mit Risiko befrachtet ist, loten sie wechselseitig ihre Risikobereitschaft aus: Wer ist bereit, frisches Geld zuzuschießen, und wie viel? Wer schreibt sein schlechtes Geld ab, und in welchem Umfang? Von dieser Art sind die „Signale“, die sie aussenden, um anhand der Bereitschaft der jeweils anderen, zusätzliches Geld zu riskieren, die Aussichten ihres eigenen Beitrags zu kalkulieren. Dabei spielen die „zur Sanierung fehlenden“ 250 bis 400 Millionen, auf deren Zahlung sich die Banken nicht einigen wollen, eine etwas andere Rolle als in der öffentlichen Besprechung. Der Bankenbeschluss, die Akte Holzmann zu schließen, erfolgt ja nicht deswegen, weil es einen Fehlbetrag „gibt“; vielmehr liegt ihrer Entscheidung das negative Urteil über eine lohnende Fortführung von Holzmann zugrunde, so dass keine der beteiligten Banken mehr riskieren will, und eine „fehlende“ Restsumme übrig bleibt. In die Frage, ob diese Millionen sich lohnen, geht also eine Spekulation auf die Zukunft des Unternehmens ein, bei der sie sich schließlich dahingehend einig werden, dass keiner zuviel riskieren will, es also für die anstehende Sanierung nicht reicht.
2. Die Rettung & Sanierung – ein echtes Gemeinschaftswerk von Staat, Kapital und Arbeit
Den ökonomischen Sachverhalt, dass zu viel Kapital im Baugewerbe tätig ist, nimmt die Regierung in der Weise wahr, dass mit der Abwicklung Holzmanns „eine gigantische Kapitalvernichtung“ (SZ, 29.12.) ansteht, die nicht auf Holzmann beschränkt bleibt. Die Kapitalvernichtung dort verursacht Kapitalvernichtung an zahlreichen anderen Stellen; die Streichung des Geschäfts dieser Baufirma bewirkt Geschäftsunfähigkeit vieler anderer Firmen. Und das hat wiederum eine Massen- und Streuwirkung auf den Standort insgesamt, die den Chef der Standortbetreuung nicht kalt lässt.
Da ist zum ersten der Kreditzustand der Banken. Das Holzmann-Kapital ist ruiniert, und einige der größten Banken der Republik sind mit ihrem Kredit in Milliardenhöhe davon betroffen. – Zum zweiten rollt mit der Pleite dieses Großen eine Pleitewelle auf all die Firmen und Betriebe zu, die im Umfeld von Holzmann angesiedelt sind: Zulieferfirmen und Subunternehmen des Handwerks und des Mittelstands sind tangiert, also eigentlich „gesunde“ Betriebe, wenn sie nicht mit faulem Kredit bezahlt worden wären. – Zum dritten hat die Pleite Auswirkungen aufs Ausland. Holzmann ist ein Multi, hat z.B. wenige Wochen zuvor die größte Baufirma Spaniens aufgekauft, die drei Tage nach der Offenbarung ebenfalls Zahlungsunfähigkeit anmeldet. Das macht aus dem Fall gleich eine Affäre der Wirtschaftsaußenpolitik. Deutsche Firmen treten schließlich überall in Europa groß auf, betreiben Fusionen und kaufen Firmen mit dem Versprechen auf, aus ihnen lohnendes Geschäft zu machen. Und dann so ein Fall. Mit Holzmann ist eine Firma als Aufkäufer aufgetreten, die immerhin dem Konsortium ‚Deutsche Bank‘ zugeordnet wird, und dieses Engagement hat unmittelbar zum Ruin dieser spanischen Baufirma geführt. Das ist aus der Sicht einer deutschen Regierung nicht gerade vorteilhaft fürs internationale Klima. Es wirft nämlich die Frage auf, was deutsche Firmen im Ausland überhaupt noch wert sind. Welche Geschäfte sind noch sicher, wenn nicht einmal die Deutsche Bank ihre Sicherheit garantieren kann? Mit Holzmann gehen also nicht nur unmittelbar Kredite kaputt, auch das Vertrauen in den Kredit Deutscher Banken im Verhältnis zum Ausland geht verloren. – Viertens schließlich gehen Arbeitsplätze kaputt. Zu den 20000 „Holzmännern“ werden noch etwa 40000 bei den Zulieferern hinzugeschätzt, die demnächst die Sozialkassen belasten.
Die Regierung ordnet also die drohende Abwicklung Holzmanns als eine Affäre von nationaler Bedeutung ein. Nach ihrer Auffassung bewirkt das Ausmaß der anstehenden Kapitalvernichtung eine Schädigung des deutschen Standorts, die auf die Banken und die Lage des deutschen Geldes insgesamt zurückschlagen würde. Um derartige Folgen abzuwenden, macht der Kanzler die „Rettung“ Holzmanns zur Chefsache. Die Regierung wünscht, „dass das Unternehmen saniert wird, zusammen bleibt und nicht zerschlagen wird“ (FR, 24.11.), sie beantragt eine Revision der Einschätzung der Lage durch die Banken und die Rücknahme ihrer Entscheidung, den Konkurs einzuleiten. Der Antrag erfolgt nicht per politischem Dekret, sondern streng marktwirtschaftlich: Um die Risikobereitschaft der Banken materiell zu stimulieren, macht die Regierung ein Angebot; sie stellt einen Beitrag des Bundes zur Verfügung, einen „nachrangigen Kredit und eine Bürgschaft von insgesamt 250 Millionen“. (FR, 4.12.) Die 250 Millionen Staatskredit bzw. Bürgschaft haben eine doppelte Bedeutung. Im Unterschied zum Bankenkredit ist dieses Geld für den Geldgeber kein Geschäftsmittel; der Staat verlangt nicht die Bedienung eines Zinsgeschäfts und besteht insofern auch nicht auf Rückzahlung, als nach dem Konkursrecht seine Ansprüche für den Fall, dass etwas schief geht, „nachrangig“ sind. Das staatliche Geld hat also eine andere Qualität als ein Bankkredit; es ist für den Betrieb unmittelbar dasselbe wie die Aufstockung seines Eigenkapitals, was wiederum ein „Datum“ der Sicherheit für die Spekulation auf ein neues Wachstum der Firma bedeutet. Zum andern ist es das politische „Signal“, dass dem Staat wirklich viel daran liegt, dass der Konzern erhalten bleibt. Das unterfüttert die Spekulation und wirkt durch die Kapitalaufstockung glaubwürdig auf die Banken, die damit eine neue Grundlage ihres Kalkulierens haben.
*
Die nach der Intervention des Kanzlers vorerst beschlossene „Rettung“ von Holzmann ist nicht der Beschluss, den Betrieb in der bisherigen Form weiterzuführen. Die Entscheidung, ihn zu erhalten, bedeutet zunächst einmal nur, dass das Holzmann-Kapital noch nicht in seinem ganzen Wertumfang abgeschrieben werden soll, wie es im Fall eines Konkurses geschehen wäre. Eine solche Form der Entwertung, die die Kapitalvernichtung an der Firma und gegen sie vollstreckt, soll nicht stattfinden. Das heißt andererseits natürlich nicht, dass überhaupt keine Entwertung stattfindet; denn darin besteht die Rettung nun auch wieder nicht, dass sie das überflüssige Kapital als brauchbares erhält. Die Rettungsaktion des Kanzlers ist also nur der Auftakt zur Sanierung des Betriebs, auf die die Banken sich nicht einigen konnten, und die schließt einerseits ein, dass Holzmann ab sofort entweder rentabel zu wirtschaften hat oder gar nicht; und andererseits, dass die Vernichtung des überflüssigen Kapitals nun auch vollstreckt wird. Mit der Bereitstellung von Staatsgeldern und Krediten, die die Banken neu zuschießen, wird die prinzipielle Funktionsfähigkeit des bisher engagierten Kredits aufrecht erhalten; vorerst freilich nur in der ganz elementaren Bedeutung, dass der Betrieb als solcher erhalten wird. Wie viel von dem bisher eingesetzten Kredit allerdings übrig bleibt, um das Holzmann-Kapital wieder rentabel zu machen, hängt von der Wertberichtigung ab, auf die die Banken sich im Sanierungskonzept einigen.
Die Entwertung des Kapitals findet in unterschiedlichen Formen und in allen Abteilungen statt. Sie erfolgt zunächst als „bilanzielle Operation“. Von dieser Wertberichtigung ist einerseits das fungierende Kapital der Firma Holzmann betroffen. Der im Sanierungskonzept beschlossene Kapitalschnitt reduziert den „anteiligen Betrag des Grundkapitals“ (FR, 2.12.) auf einen Bruchteil seines vorherigen Werts. Ebenso tangiert, wenn auch in unterschiedlicher Konsequenz und Wucht, sind damit die Eigentümer dieses Kapitals, die Aktionäre; angefangen von den Großen, zu denen die belgische Gevaert-Gruppe und die Banken gehören, bis hin zu den Kleinen mit ihrem ‚Streubesitz‘. Mit dem Kapitalschnitt wird nämlich das Aktienkapital im Verhältnis von 26 zu 1 ‚heruntergerechnet‘, so dass die Eigentumstitel an Holzmann noch gerade mal 4% ihrer alten Größe ausmachen. Für die Aktienbesitzer ist die „bilanzielle Operation“ also eine Enteignung großen Stils, nämlich die unmittelbare Vernichtung ihres Vermögens. Das betrifft dann ferner auch den Grund- und Immobilienbesitz der Firma. Als Beitrag zu seiner Entschuldung muss Holzmann „seinen gesamten Immobilienbestand … an die Gläubigerbanken zum Verkehrswert veräußern“ (ebd.). Die Sachwerte der Firma, die auf diese Weise in das Eigentum der Banken übergehen, sind freilich nicht einfach ein Äquivalent für Geldwerte, sondern ein durchaus zweifelhafter Gegenwert für Geldvermögen in Kreditform, und insofern für die Banken eine zweischneidige Sache: Der ‚Verkehrswert‘, zu dem Holzmann seinen Immobilienstand veräußern muss, zeigt an, dass auch an dieser Vermögensform eine Wertberichtigung vorgenommen wird, die den Kredit der Banken, der in diesen Sachwerten seine Grundlage hat, insgesamt tangiert. Denn wenn die Holzmann AG eingestehen muss, dass all das, was sie bisher als Vermögen und Sicherheit für Kredite bei den Banken und auch als Grundlage für Geschäfte, mit denen sie die Bankkredite bedient, herausgerechnet hat, nur noch die Hälfte wert ist – nämlich den jetzt taxierten ‚Verkehrswert‘ –, dann betrifft das außer ihrem eigenen Vermögen auch das Vermögen der Banken. Die müssen sich die Frage gefallen lassen, was ihre Kredite überhaupt noch wert sind, wenn sie die ‚Sicherheiten‘ von Holzmann mit ihren Forderungen an Holzmann gleichgesetzt und in ihren Büchern als eigene Vermögensbestandteile ausgewiesen haben; und das selbstverständlich nicht in der Höhe des „Verkehrswerts“, sondern in der Größenordnung ihrer spekulativen Bewertung, die sich gerade als fiktiv entlarvt hat.
Nach Kapitalschnitt und Überschreibung des wertberichtigten ‚Sachvermögens‘ wird die „bilanzielle Operation“ mit der Abschreibung von Schuldforderungen der Banken in Höhe von 1,3 Milliarden komplettiert. Mit dieser Bereinigung des Kreditüberbaus wird die Entschuldung der Firma Holzmann vollzogen, so dass sich schlagartig die Bezugsgröße ändert, auf die sich ihre Erträge in Zukunft beziehen, was sich unmittelbar auf die Rentabilität ihres Kapitals auswirkt. Auf diese Wirkung kommt es den Sanierern an. Aus Holzmann soll wieder ein Kapital werden, das sich rentiert, also die Kredite wieder bedienen kann – und deshalb neuen Kredit verdient. Der zweite Teil der Sanierungsoperation ist deswegen auch die Ausstattung des „angeschlagenen Bauriesen“ mit neuer ‚Liquidität‘: ‚fresh money‘ in Form eines „Konsortialkredits“ der Banken und Ausgabe neuer Aktien. Damit ist freilich nur die – wenngleich unabdingbare – Voraussetzung geschaffen, dass die Firma wieder gewinnträchtige Geschäfte machen kann. Um Holzmann wirklich rentabel zu machen, kommt der ganze Unterbau des Geschäfts, die Basis des Kredits, ins Blickfeld der Sanierung. Der Betrieb wird daraufhin besichtigt, was an ihm eigentlich unrentabel gewesen ist, welche Geschäfte weitergehen sollen, und welche nicht. Entwertung heißt jetzt Gesundschrumpfung, also Abstoßen von unrentablen Teilen. Dass dabei so ziemlich alles ins Visier kommt – „bei Holzmann bleibt kein Stein auf dem anderen“ (FR, 26.11.) –, steht von vorneherein fest. Die Engagements und Beteiligungen werden von 600 auf die Hälfte reduziert; das Geschäft konzentriert sich in Zukunft auf „Infrastruktur- und Industriebau sowie den allgemeinen Hochbau“, dort allerdings nur (!) „auf Objekte, die eine Rendite versprechen“ (FR, 9.2.00). Verschlankt wird ferner die Konzernstruktur, die bisherigen 40 Niederlassungen werden „auf 17 Standorte“ konzentriert. Und schließlich das variable Kapital: „Der Personalabbau wird insgesamt 5000 Stellen betreffen, darunter 3300 im Kerngeschäft im Inland.“ (SZ, 9.2.) So erfährt die Mannschaft, was es heißt, wenn Missmanagement durch Management ersetzt wird. Und noch ein anderes wird deutlich. Die Rettung von Holzmann hat Konsequenzen, die sich von den Konsequenzen einer Pleite gar nicht so sehr unterscheiden, so das ein bisschen von dem drohenden Konkurs auch mit der Sanierung stattfindet: Vernichtung von fiktivem Kapital im großen Maßstab, Abstoßen aller unrentablen Teile des Geschäfts und damit einhergehend Abbau der Belegschaft um fast ein Drittel – so sieht die kontrollierte Entwertung aus, die das Fortbestehen der Firma sichern soll. Aus der soll wieder ein schlagkräftiger Konzern gezimmert werden, der seinen Beitrag zum Wachstum des nationalen Standorts leistet. Der Beschluss zur Rettung und Sanierung ist insofern der Auftakt zu einer neuen Spekulation auf Holzmann, die – ‚bereinigt‘ durch Entwertung und angereichert mit neuem Kredit – genau das verfolgt, was Binder & Co. in den letzten Jahren mit „Missmanagement und krimineller Energie“ versucht, aber nicht geschafft haben.
*
Ob die Rechnungen aufgehen und das Gesamtkunstwerk gelingt, ist schon deswegen völlig offen, weil sich an der Ausgangslage der Holzmann-Krise – zu viel Kapital auf dem Bausektor – mit dem Beschluss zur Rettung überhaupt nichts ändert. Bei aller Unsicherheit in dieser Frage steht eine Konsequenz allerdings fest: Den Arbeitern geht es in jedem Fall an den Kragen, ganz gleich, was aus Holzmann wird. Für sie ist die Alternative, ob die Entwertung des Kapitals die Form der Zerschlagung der Firma oder ihrer Fortführung auf geschrumpfter Basis annimmt, nur eine Alternative ihres Schadens. Nichtsdestoweniger sehen sich die Träger der Ware Arbeitskraft herausgefordert, das Ihre dazu beizutragen, damit der Konzern wieder eine Zukunft hat und sie eine Zukunft in ihm. Sie ziehen aus ihrer Betroffenheit den Schluss, die Betroffenheit der Firma abzuwenden und mit einem Sonderopfer einen Beitrag zur Sanierung zu leisten. Den ökonomischen Sachverhalt, dass es der Betrieb ist, der im Verein mit den Banken seine Sanierung organisiert und dabei sein variables Kapital, also die lebendige Lohnsumme namens ‚Belegschaft‘, als die disponible Masse behandelt, stellen die so geehrten Proletarier auf den Kopf und machen ernst mit der Phrase ‚Arbeiter retten ihren Betrieb‘ – und damit ihre Arbeitsplätze. Diese Auffassung blamiert sich zwar ziemlich gründlich an den Entlassungsmaßnahmen des Betriebs sowie an ihren eigenen ‚freiwilligen‘ Opfern, doch das beeindruckt die Arbeiter wenig. Als geschulte Dialektiker bemerken sie an ihrem Status als ‚Produktionsfaktor Arbeit‘ nicht nur ihre Abhängigkeit vom Betrieb, sondern vor allem ihre nützliche Funktion für den Betrieb; die leuchtet ihnen so sehr ein, dass sie den Gesichtspunkt der Kostensenkung zu ihrer eigenen Sache machen, so als gelte es, den praktischen Beweis abzuliefern, dass die eigene Verarmung immer noch das wirksamste Mittel sei, um ihre Position als Arbeitnehmer zu verbessern.
Sie lassen sich daher nicht lumpen: 6% Lohnabschlag und unbezahlte Mehrarbeit von 4 Stunden pro Woche, lautet das Angebot, dazu Verzicht auf „freiwillige übertarifliche Leistungen“ der Firma, worin auch immer die bestehen sollen. Wer glaubt, das wäre ein unbegrenzter Blankoscheck fürs Kapital zu effektiverer Ausbeutung, der verkennt erstens die Lage und zweitens die Gewerkschaft. Die Arbeitervertretung knüpft ihr Angebot an die „Bedingung“, dass es befristet gilt, nämlich „nur“ für anderthalb Jahre. Dann ist Schluss. Der Betrieb sagt trotzdem danke und bekennt sich zu seiner sozialen Verantwortung. Er kündigt an, dass man für die 3000, die gar nicht erst die Gelegenheit kriegen, sich durch Lohnverzicht wieder attraktiv zu machen, „eine Beschäftigungsgesellschaft plane“. Weil aber „Beschäftigung“ im Kapitalismus, wenn sie sich nicht lohnt, eine luxuriöse Angelegenheit ist, kann sie letztlich nicht Sache des Betriebs sein. Die Bundesanstalt für Arbeit ist daher aufgefordert, das nötige Kleingeld für das Auffangbecken der Aussortierten zuzuschießen und Klassensolidarität zu organisieren, indem sie den Anteil der nationalen Lohnsumme, den sie verwaltet, für die pflegeleichte Aussortierung der Holzmann-Mannschaft haften lässt. Dieser bestechenden Logik mag sich der Betriebsrat nicht verweigern und verspricht, zusätzlich „dafür zu kämpfen, dass vor Weihnachten niemand mehr vor die Tür gesetzt“ wird. (FR, 2.12.). Danach bricht ein neues Jahrtausend an. Von einer Erpressung will bei so viel Eigeninitiative der Betroffenen niemand reden. In der Stunde der Rettung sind vielmehr Freude und Dankbarkeit angezeigt. Die Freude gilt dem Umstand, dass das Lohnarbeiten weitergehen kann, auch wenn der Lohn dabei auf der Strecke bleibt; die Dankbarkeit gilt dem Kanzler, der das ermöglicht hat. Dafür quittieren die „Kollegen“ die Erhöhung der Arbeitsnormen mit „Gerhard-Gerhard-Gesängen“, weil die Gelegenheit, Arbeit gegen Lohn zu verrichten, „schöner als ein Lottogewinn“ ist – so ein Holzmann-Arbeiter im Fernsehen, der den Nagel auf den Kopf trifft.
3. Eine Grundsatzdebatte über den politökonomischen Gesundheitszustand der Nation
Die Frage – und der Zweifel –, ob die Sanierung der Holzmann-AG mit all diesen Maßnahmen auch gelingt, beflügelt die Nation zu einer Debatte über Sinn und Zweckmäßigkeit der staatlichen Rettungsaktion. Dass der gesellschaftliche Diskurs sich an der Frage austobt, ob der Staat so etwas darf, muss oder soll, ist beim Geisteszustand der Beteiligten nur konsequent, denn die beziehen sich als parteiliche Begutachter des Falls auf die zwei Seiten, die Interventionen dieser Art nun einmal an sich haben: Das staatliche Achten auf das Allgemeinwohl, der Blick auf die Ergebnisse des Marktes unter dem Aspekt des nationalen Ertrags hat nämlich immer auch die Seite des Eingriffs in die Konkurrenz. Dass es dem Staat bei seinen Interventionen darum geht, den Nutzen des Kapitals so zu befördern, dass auch er einen Nutzen davon hat, ist der Stoff, an dem die Kritiker sich konstruktiv zu schaffen machen, und an dem sich ihre Geister scheiden: Da stehen dann diejenigen, die die Verantwortung des Staates für das Ganze betonen, gegen diejenigen, die das freie Konkurrenzprinzip als das Non plus ultra des Staatsnutzens auf ihre Fahnen schreiben. Und da melden sich selbstverständlich die eigentlich Betroffenen, die Konkurrenten selber, zu Wort, um vor einem ‚Staatsinterventionismus‘ zu warnen, der sich den ‚Falschen‘ widmet, statt die ‚Richtigen‘ zu fördern. So ist gewährleistet, dass bei dem Streit die Sachkenntnis in ökonomischen Grundsatzfragen dem moralischen Niveau, auf dem er geführt wird, in nichts nachsteht.
Kaum hat sich die Regierung in den Fall eingemischt, zirkuliert schon eine der Lieblingssprachregelungen von Demokraten, die Politik als ein ziemliches ‚Showgeschäft‘ durchschaut haben wollen: „Das war endlich mal wieder ein Job nach dem Geschmack des Gerhard Schröder.“ (SZ, 25.11.) Während der Kanzler volkswirtschaftliche Gründe für seine Intervention benennt, wissen die Kenner des Politgeschäfts, dass Politiker stets darauf aus sind, sich öffentlichkeitswirksam zu verkaufen. Und da weiß man ja längst, was für ein PR-Profi der ‚Medienkanzler‘ Schröder ist, der jetzt die Gunst der Stunde nutzt, um sich als Krisenmanager in Szene zu setzen; dem „ordnungspolitische Grundsätze“ nichts gelten, und dem deswegen Gelegenheiten willkommen sind, um mit „populistischen“ Auftritten sich und seine SPD aus dem Stimmungstief zu führen. Die Freunde der Politikmethodik streuen den Verdacht aus, dass der „Pragmatismus“ des Kanzlers nur dessen „Prinzipienlosigkeit“ offenbart. Sie drücken ihre Abneigung gegen die Intervention in der Weise aus, dass sie stur demokratiemethodisch die Irrationalität der Regierungsentscheidung ‚entlarven‘, so als ob die Agenten des Staatszwecks tatsächlich mit nichts anderem beschäftigt wären als mit den Techniken und Künsten ihrer Selbstdarstellung zwecks Profilgewinnung & Wählerbetörung.
Abgesehen von solchen Geistesblitzen, versorgen die Meinungsführer die Nation mit ihren politökonomischen Grundkenntnissen. Während die einen sich durchaus vorstellen können, dass in Krisenfällen solchen Ausmaßes staatlicher Handlungsbedarf besteht, stellen andere klar, dass die Frage, ob der Staat „immer dann eingreifen“ müsse, „wenn Zehntausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel stehen“ (SZ, 26.11.), im Prinzip mit ‚nein‘ zu beantworten ist. Denn unter welchen Gesichtspunkten man den Fall auch immer betrachtet – die Rettung kann „kein Modell“ sein. In diesem Sinne wird der Kanzler mit den Wahlkampf-Phrasen der SPD konfrontiert: „Das System Schröder kennt nur die Kolosse. Modern ist das nicht. Gerecht auch nicht.“ Die Kleinen gehen in der normalen Konkurrenz zu Tausenden kaputt und mit ihnen „doppelt soviel Jobs“ verloren wie bei einem Holzmann-Konkurs, ohne dass ein Kanzler sich darum kümmerte. Sozial ist die Tat des Kanzlers ebenso wenig, weil die Rettung der Holzmann-AG Arbeitsplätze anderswo vernichtet, „die durch den Bankrott des Frankfurter Unternehmens sicherer gewesen wären“. Ziemlich abgebrüht verweisen die Verfechter des Markts auf die Opfer der kapitalistischen Konkurrenz, die sich so oder so einfinden und daher als Beleg dafür herhalten dürfen, dass Politik nicht dazu da ist, die Märkte zu korrigieren. Wer kaputt geht und welche Arbeitsplätze somit verschwinden, was also ‚sozial‘, ‚gerecht‘ und ‚modern‘ ist, das entscheidet allein der Markt; und daran blamiert sich die Aktion endgültig, denn „diesmal entscheidet nicht der Wettbewerb, sondern Willkür der Politik“ (ebd.). Dass sich so etwas „letztlich nicht auszahlt“ – weder für die Wirtschaft noch für den Staat und erst recht nicht für Arbeiter –, versteht sich von selbst; so dass am Ende die Zeche wieder am Steuerzahler hängen bleibt, der mit ‚seinem‘ kostbaren Geld den Schein von Rentabilität finanziert, der sich früher oder später sowieso als nichtig erweist. Womit wieder einmal bewiesen ist, dass das beste Krisenmanagement darin besteht, dass der Staat sich aus der Konkurrenz heraushält und die Märkte sich selber regulieren lässt. Dann hat auch der Staat am meisten vom Markt.
*
Die Begeisterung über die ‚staatliche Beihilfe‘ hält sich auch bei den Marktteilnehmern in Gestalt der Holzmann-Konkurrenten in Grenzen. Sie „bezweifeln“, dass der Lohnverzicht der Arbeiter ein „echter Sanierungsbeitrag“ ist, und sagen ehrlich und offen heraus, worum es sich bei der Sache in Wirklichkeit handelt: um eine skandalöse Wettbewerbsverzerrung! Denn das ist ja klar: Wenn das Lebensmittel der Arbeiter, der Lohn, ein Kostenfaktor ihres Kalkulierens ist, dann ist die Senkung des Lohns das Pfund, mit dem sie in der Konkurrenz wuchern. Dann ist die schlagartige Verarmung der Holzmann-Arbeiter ein nicht hinnehmbarer Konkurrenzvorteil für die Firma Holzmann; zu Lasten all der anderen, der gesunden und anständigen Betriebe. Die Versicherung von Holzmann, dass die eingesparte Lohnsumme nicht als „Preisdumping gegen Wettbewerber“ eingesetzt, sondern „in vollem Umfang in die Sanierung gesteckt“ (FR, 2.12.) werde, weisen sie als „lächerlich“ zurück. Worin sonst sollte der Beitrag zur Sanierung bestehen, wenn nicht darin, ein quasi offizielles Lohndumping in noch nie da gewesenem Umfang in einen Preis- und damit Konkurrenzvorteil umzumünzen! Den hat jetzt ausgerechnet ein Wettbewerber, der erwiesenermaßen zu den ‚Untüchtigen‘ zählt und somit im Wettbewerb eigentlich nichts mehr zu suchen hat. Denn wer sich am Markt blamiert, hat abzutreten. Wenn also der Verlierer Holzmann dank Staatskredit und Lohnsubvention weitermachen kann, dann zeigt das die verhängnisvolle Zielrichtung einer Politik, die die gesunden und tüchtigen Unternehmen in Not bringt, während sie die kranken und untüchtigen pflegt.
Die Unternehmer begnügen sich nicht damit, ihr Missfallen gegen die Staatsintervention kundzutun, sie mobilisieren ihre Macht, um diese Ungerechtigkeit zu verhindern. Der Hauptverband „kündigt gegen die neue Regelung Widerstand an“ (FR, 4.12.); man werde vor Gericht ziehen und die Sache kippen. Selbstredend geht es ihm dabei nur um die Erhaltung des Rechts, genauer gesagt: des Rechts auf Waffengleichheit in der Konkurrenz. Denn die ist, bei allen sonstigen Vorbehalten, immerhin der Nutzen von geltenden Tarifverträgen, so dass auch die Durchlöcherung derselben – mit diskreter Unterstützung der Gewerkschaften – unter gleichen Bedingungen stattfinden kann. Die Wiederherstellung von Waffengleichheit lässt sich allerdings zweckmäßiger und zukunftsweisender bewerkstelligen. Statt die Sonderrechte von Holzmann gerichtlich zu bekämpfen, empfiehlt sich die Strategie, sie für sich selber zu reklamieren. Dann nämlich ist man nicht nur den Konkurrenznachteil los, sondern obendrein auch noch den Flächentarif. In diesem Sinne verbindet der Hauptverband seine Abneigung gegen das Frankfurter Sanierungsmodell mit der Versicherung, dass er, wenn es denn tatsächlich beschlossen werden sollte, seinerseits „alle Mitgliedsfirmen auffordern werde, ebenfalls einen solchen Lohnverzicht mit ihren Betriebsräten auszuhandeln“ (FR, 4.12.). Dem kann sich der Zentralverband, der immerhin 50000 Kleinunternehmen mit über 800000 Beschäftigten vertritt, nur anschließen. Schließlich trifft es die Zwerge besonders hart: „Angesichts von 7000 Konkursen am Bau verlangen besonders die schwächeren Unternehmen, dass für sie die gleichen Bedingungen gelten.“ (SZ, 18.12.)
Zum Glück verstehen sich die süßen Kleinunternehmer, die niedrige Löhne bekanntlich nur vom Hörensagen kennen, die selber nicht konkurrieren, sondern natürlich nur Opfer der Konkurrenz sind, nicht bloß aufs Jammern, sondern geben auch kompetente Auskunft, wie es zur „schleichenden Erosion des Flächentarifvertrags“ kommt. Wenn Holzmann die Tarife aushebelt, dann „hätten auch unsere Betriebe keine Veranlassung mehr, sich an die Tarife zu halten. Es darf keine Lex Holzmann geben, oder wir kippen den Flächentarifvertrag gleich ganz und flexibilisieren ihn.“ (ebd.) Wie schön, wenn man als ‚Betroffener‘ eines Rechts, das einen schon lange stört, auch die Mittel hat, die „Erosion“ desselben aktiv voranzutreiben! Ein Ideologe, wer dieses Täter-Opfer-Syndrom mit einer Drohung verwechselt. Die Unternehmer versichern in aller Unschuld, dass ihre „Forderung nach Lohnkürzung nicht einfach als Provokation verstanden“ werden darf, sondern als Denkanstoß zu verstehen ist, der eine längst überfällige Perspektive anzeigt: „Wir müssen in Deutschland die Entgelte für niedrig qualifizierte Bauarbeiter senken, damit diese eine Chance gegen ausländische Billiglöhner haben.“ (ebd.) Sage noch einer was gegen deutsche Bauunternehmer! Großzügig und vorurteilsfrei bedienen sie sich aus dem Reservoir der freigesetzten internationalen Arbeitermassen; machen aus vagabundierenden Wandervögeln richtige Lohnarbeiter; kümmern sich auch noch um deren Qualifizierung, indem sie ihnen einen original tschechisch-polnisch-vietnamesischen Hungerlohn zahlen; und können es als aufrechte Patrioten schließlich nicht mehr mitansehen, dass Rudi Löhner gegen die „Billiglöhner“ aus dem Ausland nicht mehr konkurrieren kann. Da entdecken sie, anlässlich Holzmann, für sich eine Gelegenheit und für die Arbeiter eine Chance: Die Löhne müssen runter. Dann käme der ungerechte Vorteil von Holzmann wieder ins Lot, und deutsche Bauunternehmen könnten wieder deutsche Arbeiter beschäftigen.
Die Forderung der Kapitalisten nach Gleichberechtigung in Sachen Lohndrückerei, verbunden mit der Drohung, die Sanierungsvereinbarung zu kippen, bringt die Gewerkschaft in einen argen Konflikt mit sich selbst, den sie jedoch dank ihrer multiplen Existenzform tapfer ausficht. In ihrer Eigenschaft als Betriebsrat und Aufsichtsratsmitglied hat sie den Sanierungsplan gebilligt und unterschrieben und sich anschließend mit Schröder feiern lassen. Als IG-Bau dagegen steckt sie jetzt in der Klemme. Man kann es nämlich drehen und wenden, wie man will, der vereinbarte Lohnverzicht verstößt gegen das Tarifrecht. Das wäre an sich nichts Aufregendes, denn in der Praxis ist man längst „flexibel“ und stimmt jeder Form des Tarifbruchs zu, damit die Betriebe konkurrenzfähig bleiben und Arbeitsplätze sichern können. Doch dieser Weg ist verbaut:
„Eine ‚stillschweigende Duldung‘ der Tarifverletzung, ‚wie sie in anderen (!) Branchen durchaus üblich ist‘, sei laut Wiesehügel aber durch den ‚massiven Druck‘ der anderen Bauunternehmen auf ihre Betriebsräte ‚völlig unmöglich geworden‘“. (FR, 18.12.)
Ein echter Skandal: Die Gewerkschaft wird von den Kapitalisten daran gehindert, diesen so vorbildlichen Tarifbruch, der nebenbei auch eine Geldform hat: nämlich ungefähr ein Fünftel des Lohns, stillschweigend zu dulden. Statt diesen beispiellosen Lohnverzicht zu honorieren, blasen die Unternehmer zum Angriff auf die heiligen Rechte der Arbeitnehmerschaft, die die Gewerkschaft mit ihrer bewährten Duldungspolitik hütet und verteidigt. Nachdem die Vertreter des Rechts auf Arbeit es so weit gebracht haben, braucht man sich über den Fortgang ihres inneren Zwists & Haders nicht zu sorgen. Der Vorsitzende des Holzmann-Betriebsrats kann sich völlig frei von den tarifpolitischen Kalkulationen seiner Organisation, also ziemlich hemmungslos, der Aufgabe zuwenden, „rechtlich wasserdichte“ Alternativen des Lohnverzichts auszutüfteln. Dabei ist ihm klar, dass nur unter Tarif etwas geht, denn wollte man sich „streng an den Tarifvertrag halten, könnten wir gar nichts machen“. (Mahneke, FR, 4.12.) Der Mann denkt konsequent. Wenn ‚machen‘ nur ein synonymes Verb für Lohn senken ist, dann kommen – weniger „streng“ gedacht – noch viele Optionen in Betracht: „Verzicht auf 5 Tage Jahresurlaub, Verringerung des 13. Monatsgehalts, Aussetzung von Teilen der ergebnisabhängigen Vergütung (Akkordlohn), Wegfall betrieblicher Sozialleistungen“ usw. (FR, 4.12.) Das neue betriebliche Vorschlagswesen lässt hinsichtlich der Verarmung der Belegschaft nichts zu wünschen übrig. Die Gewerkschaft ist zu jeder Schandtat bereit, nur „wasserdicht“ muss sie eben sein, also das Kunststück fertigbringen, tarifrechtskonforme Verstöße gegen das Tarifrecht zu konstruieren. Vom Erfindungsreichtum der Gewerkschaft hängt freilich überhaupt nichts ab. Auf die Kapitalisten-Verbände kommt es an. Die können sich zwar vorstellen, „einen Sanierungsbeitrag der Arbeitnehmer der Philipp Holzmann mitzutragen“, denn auch sturköpfige Unternehmer sind lernfähig, wenn die Arbeiter mit gutem Beispiel vorangehen: „Die Holzmann-Belegschaft habe bewiesen, dass sie den engen Zusammenhang zwischen Beschäftigungsniveau und Lohnhöhe verstanden habe.“ (Hauptverband, HB, 22.12.) Zur Zustimmung des ‚Arbeitgeberlagers‘ ist auf Seiten der Arbeitnehmer allerdings ein bisschen mehr verlangt als nur die Einsicht, dass Beschäftigung und Lohnhöhe sich aufgrund ihres „engen Zusammenhangs“ oft ausschließen. Was für die Arbeitgeber eine Gelegenheit ist – die Tariflandschaft gründlich umzukrempeln –, ist für die Gewerkschaft eine Notwendigkeit, der sie sich fügen muss:
„… machte Verbandsvize Bauer deutlich, dass die Arbeitgeberseite die Vereinbarung bei Holzmann zum Anlass nehmen wird, um auf eine Flexibilisierung des Flächentarifs zu drängen. Der Fall Holzmann sei Ausdruck einer sich zuspitzenden Konjunktur- und Strukturkrise in der Bauwirtschaft, die nur mit Hilfe einer neuen Tarifpolitik überwunden werden könne. – Um die betriebliche Flexibilität im Entgeltbereich wiederherzustellen, müsse man auch im westdeutschen Baugewerbe ‚unkonditionierte Öffnungsklauseln‘ etablieren, die ein Abweichen vom Tarifvertrag erlauben, ohne dass das Unternehmen zuvor eine bestimmte Notlage nachweisen muss.“ (ebd.)
Das ist das Angebot: Ein Flächentarif als Plattform für ‚Öffnungsklauseln‘, ohne Konditionen. Da lässt es sich nicht nur gut verhandeln, sondern auch einigen: „In der Branche wird erwartet, dass Holzmann und IG Bau einen Haustarifvertrag aushandeln, der von den Arbeitgeberverbänden (!) toleriert werden müsste. Eine solche Regelung liefe rechtlich nicht darauf hinaus, den Flächentarif auszuhebeln.“ (ebd.) So zeigt der Fall Holzmann wieder einmal schlagend, nicht nur, was ‚Recht‘ in der Sphäre des Tarifrechts ist, sondern auch, was es wert ist. Die Lösung, auf die sich Gewerkschaft und Arbeitergeber allmählich zubewegen, gibt die Richtung an: Der 6%-ige Lohnabschlag wird in zusätzliche unbezahlte Mehrarbeit umgewidmet; die Arbeiter leisten 5 statt 4 Stunden unentgeltliche Überstunden pro Woche, die auf einem Zeitkonto geparkt und bis spätestens 2008 – eine bestechende Idee – in Freizeit ausgeglichen werden sollen. Ferner soll die „Lex Holzmann“ vom Tisch. Die Regelung soll in der gesamten Baubranche für Betriebe gelten, die von Insolvenz bedroht sind. Blöd ist nur, dass die Verbände schon wieder ihre Zustimmung verweigern, weil ihnen immer noch zu viel von einer „Lex Holzmann“ übrig geblieben erscheint…
Nachdem sie ihre Hausaufgaben an der Tariffront erledigt haben, besinnen sich die Konkurrenzgeier des Marktes auf die politischen Rahmenbedingungen ihres Geschäfts: Staatsinterventionismus ist nicht per se schlecht, es kommt darauf an, wie er aussieht. Der Vorstand von Hochtief hat als „eine der wesentlichen Ursachen für die tiefe Krise der deutschen Bauwirtschaft“ erkannt, „dass sich die öffentliche Hand und private Bauherren ausschließlich am niedrigsten Preis und nicht an der Qualität orientieren.“ (SZ, 2.12.) Die ‚Selbstheilungskräfte‘ der Märkte in Form von Nachfrage und Angebot ‚regulieren‘ da auf einmal nichts mehr, sondern setzen einen „mörderischen Preiskampf“ in Gang, den ausgerechnet der Staat befördert. Die geforderte Konsequenz folgt auf dem Fuß: Die Regierung soll ihr Sparprogramm überdenken und ein Bauprogramm auflegen, das bei der Qualität nicht kleckert und bei den Preisen klotzt, damit sich das Baugewerbe mit seiner „schwierigen Kostenstruktur“ beim Dumping auf die Löhne konzentrieren kann, statt sich in Preiskämpfen aufzureiben. Konkurrenzgeschrei & Geschrei nach Staatsaufträgen – das ist die ultimative Staatskritik von heute.
*
Ob die Sanierung der Holzmann AG Erfolg hat oder in eine neue Pleite mündet, wird durch die Konkurrenz am Bau- und Immobilienspekulationsmarkt praktisch entschieden. So lange diese Frage offen ist, haben die Nationalökonomen der Deutschland AG ein weites Betätigungsfeld für ihren ideologischen Prinzipienstreit um die korrekte staatliche Standortbetreuung. Da können Fundamentalisten des freien Markts den ‚systemwidrigen‘ Eingriff in die Konkurrenz als Rückfall in den finstersten Staatsinterventionismus der „SPD-Ideologie vor Godesberg“ (FAZ, 26.11.) und insofern als ‚verheerendes Signal an die Märkte‘ geißeln. Dass sie selber ihre Chimären nicht überbewerten, tut ihrer tiefen Sorge keinen Abbruch, die sie als Nationalisten umtreibt: ob die Intervention des Staates dem Standort Deutschland gut bekommt oder ihm letztlich mehr schadet als nützt. Und weil auch das keine Frage ist, die sich am Einmaleins der modernen Weltwirtschaftslehre entscheidet, hängt von den Antworten der besorgten Experten nichts ab.
Ein tatsächliches Gewicht bekommt das Rechten um die Intervention der Regierung allerdings über die Frage der Genehmigung der Staatsbeihilfen nach Rechtslage der EU. Die Kritik des EZB-Präsidenten Duisenberg an der deutschen Regierung, wonach deren „Aktion nicht gerade das Ansehen einer immer mehr vom Marktmechanismus getriebenen Wirtschaft verbessere“ (SZ, 3.12.), ist dabei gewissermaßen der Vorlauf. Der oberste Hüter der neuen Währung erinnert an das gemeinschaftliche Kreditmittel zur Bewirtschaftung von ‚Euroland‘, auf dessen pflegliche Behandlung sich die nationalen Subjekte Europas wechselseitig verpflichtet haben. Er nimmt das Misstrauen der Finanzmärkte in den Euro zum Anlass, um mit der Autorität seines Amtes ein quasi europa-offizielles Misstrauen in die deutsche Standortpolitik auszusprechen. Dieses Misstrauen wird durch die Vorbehalte der EU-Wettbewerbskommission praktisch untermauert. Die Kredithilfen aus Berlin sind nämlich zustimmungspflichtig; sie fallen nicht in die Kompetenz nationaler Hoheit, sondern in die Zuständigkeit der EU-Kommission. Während die Regierung von Anfang an so tut, als sei deren Zustimmung nur noch Formsache, vermeidet der zuständige Kommissar „auffällig, eine Genehmigung in Aussicht zu stellen. Monti machte deutlich, dass Brüssel die Holzmann-Hilfe ‚strengstens‘ unter die Lupe nehmen werde.“ (SZ, 3.12.) Holzmann, so heißt es außerdem, sei im übrigen kein Einzelfall in der Subventionspraxis der BRD, bei der EU-Gelder ‚zweckentfremdet‘ würden. So kommt neben anderen Fällen die ‚Strukturförderung‘ für den Osten in den Blick und die politische Linie der Wirtschaftsförderung in Deutschland insgesamt auf den Prüfstand der EU.
An der Genehmigungsfrage der Kredithilfen für Holzmann wird daher sinnfällig, dass die Intervention des deutschen Staates nicht nur die Konkurrenzlage seiner Bau-Branche berührt, sondern zugleich eine ganz andere Konkurrenz aufrührt: Der Fall Holzmann ist nicht bloß ein Fall nationaler Wirtschaftspolitik, wie das die Regierung gern sehen möchte – „Es galt, einen Flächenbrand zu verhindern“ (Schröder im ZDF) –, ihr Umgang mit der Pleite bekommt vielmehr durch die Kritik und Einmischung der EU den Charakter einer innereuropäischen Konkurrenzaffäre um die Frage, welche Standortpolitik sich Deutschland überhaupt leisten darf. Denn das Verhältnis einer Regierung zu ihrem Standort ist in Europa längst nicht mehr eine exklusiv nationale, sondern daneben immerzu auch eine europäische Angelegenheit, sanktioniert durch europäisches Recht und institutionalisiert in besagter Kommission. Deshalb muss sich die deutsche Regierung erstens die Frage gefallen lassen, ob ihre Standortpolitik dem gemeinsamen Standort Europa nützt, und zweitens den Vorwurf hinnehmen, dass sie ihn schwächt. Dafür ist der Kurs des Euro einerseits der passende Einmischungstitel, andererseits aber auch der „Stoff“, um den es geht. Was aus der Sicht der deutschen Regierung dem nationalen Standort nützt, wird unter dem Gesichtspunkt des Standorts Europa und seiner Währung von der EU kritisch überprüft, und zwar nach den Paragraphen des EU-Wettbewerbsrechts. Inwieweit das deutsche Interesse an der Sanierung Holzmanns von der EU berücksichtigt wird, hängt also davon ab, ob Deutschland sich in dem Konkurrenzstreit durchsetzt. Das Gelingen der Sanierung wiederum hängt umgekehrt gar nicht vom Ausgang dieser Entscheidung ab.
*
Mittlerweile zeichnet sich ein bleibender Sanierungserfolg ab. Die Branche fordert: „Holzmann für alle“ (SZ, 23.2.), und die Gewerkschaft signalisiert, dass das an ihr nicht scheitern muss. Zu irgendetwas müssen Tarifrunden ja schließlich gut sein.