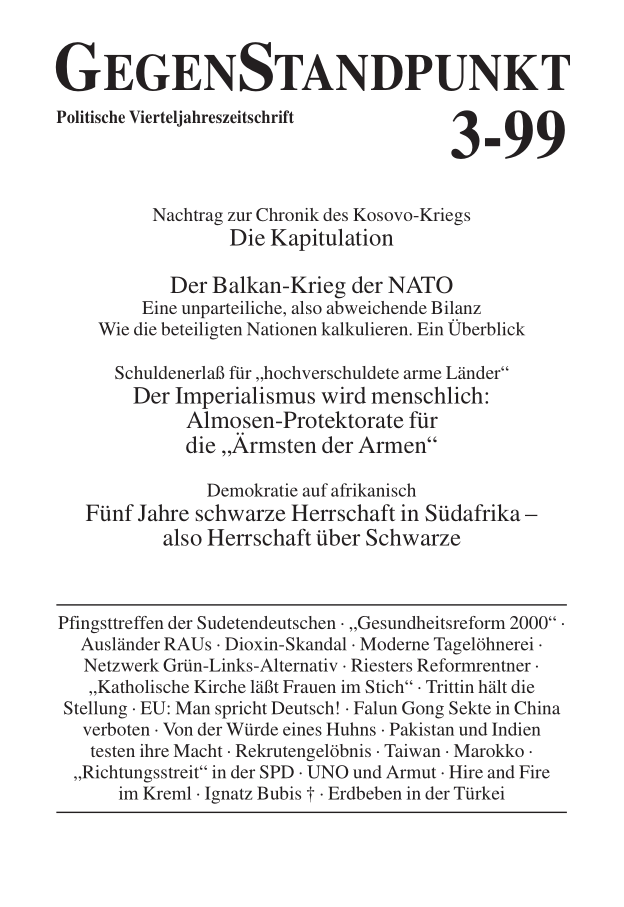Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
„Richtungsstreit“ in der SPD:
Eine Regierungspartei wird ehrlich
Das sozialdemokratische Gerechtigkeitsdenken wird als altmodisch ausgemustert. Schröder will seine Partei nicht mehr an Kriterien wie Solidarität oder Gerechtigkeit messen lassen. Rücksichtnahme auf die Armen ist mit dem Gemeinwohl einfach nicht mehr vereinbar.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
„Richtungsstreit“ in der
SPD
Eine Regierungspartei wird
ehrlich
Der Kampf um eine „moderne SPD“
Der regierende Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende Schröder
hält seine eigene Partei für untragbar. Zusammen mit dem
Kollegen von ‚New Labour‘ verfaßt er ein Papier, dem
seine Genossen entnehmen dürfen, daß sie ziemlich
gründlich modernisiert
gehören. Unter ihnen macht
ihr Chef nämlich reihenweise Traditionalisten
aus,
und daß sich mit denen die Herausforderungen
keinesfalls bewältigen lassen, die eine Zukunft
allemal aufzuwerfen pflegt, liegt für ihn auf der Hand.
Ihr Fehler ist einfach, daß sie noch immer der Irrlehre
von einer sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik
anhängen, wo ihr Chef längst beschlossen hat, daß sich
Politik generell nur noch am Maßstab modern oder
unmodern
beurteilt gehört. Davon geht er jedenfalls
aus, und die Summe seiner Wortmeldungen, mit denen er ein
ums andere Mal wiederholt, daß er die SPD gnadenlos in
Richtung Moderne
umzukrempeln gedenkt, zieht eine
andere Führungskraft, die das auch so sieht wie der Chef:
Wir müssen weg vom Standpunkt einer
Arbeiterpartei
, denn den Reichen nehmen um den
Armen zu geben, paßt nicht zu unserer heutigen Zeit.
(Fraktionsvorstand Struck).
Nun sehen das aber nicht alle so. Manche Genossen haben
es mit diesem Standpunkt in der Konkurrenz
innerhalb der Partei und um die Zuneigung des Wahlvolks
sehr weit gebracht, sitzen in Führungsgremien und sind
Landesvater. Einer von denen sieht auf Anhieb überhaupt
nicht ein, wieso er, der doch alles richtig gemacht hat,
plötzlich unmodern
sein soll. Seine Karriere und
der Wahlerfolg seiner Partei sind für ihn ein einziger
Beweis, daß gerade sozialdemokratische Politik moderne
Wirtschaftspolitik ist
(Klimmt,
FR 29.7.). Die Idee der sozialen
Gerechtigkeit
und damit die Seele der
Sozialdemokratie
ist und bleibt für ihn ein
Evergreen, der beim Publikum überhaupt nichts von seinen
betörenden Reizen verlieren kann, weswegen er seinem
Parteivorstand schriftlich und der restlichen
Öffentlichkeit per Interview sein Nichteinverständnis
mitteilt, daß aus dem erfolgreichen Zweiklang der
Bundestagswahl, jener harmonischen Verbindung von
Innovation und Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit
ausgemustert werde
(ebd.).
Damit liefert er allerdings dem Chef der SPD nur wieder
den nächsten Beweis, wie traditionalistisch
es in
diesem Haufen noch zugeht, und der legt dann von der
Modernität der Partei, die ihm vorschwebt und für die er
sich stark macht, in Sachen ‚Diskussionskultur‘ gleich
vorbildlich Zeugnis ab. Mag schon sein, daß da irgendwer
über den Kurs der SPD
anderer Auffassung ist als
er. Aber was geht ihn das an: Schröder warnt die SPD
vor Kritik an seinem Kurs
(SZ,
2.8.) – und Ende der Diskussion.
Die „Tradition einer Arbeiterpartei“
Auf alles, was diese Partei jemals als ihr
politisches Programm vertreten hat,
bezieht sich ihr amtierender Vorsitzende, als hätte es
gar keinen politischen Inhalt und in keinerlei Hinsicht
sachliche Bedeutung. Er hakt es ab als Tradition
,
als SPD-Vergangenheitspflege, einfach ein Firlefanz, mit
dem er Schluß machen will. Interessanterweise stören sich
auch die, die er mit seiner Initiative aus ihren Löchern
scheucht, gar nicht an der Einordnung, daß
‚Arbeiterpartei‘ bloße Tradition sein soll, sondern
daran, daß ihnen jemand diese Tradition wegnehmen will –
mit der wollen Klimmt, Eppler und andere Genossen ja
unbedingt weiter hausieren gehen. Die 100-jährige
Gründungslüge der SPD, die bescheidenen Interessen der
Arbeiterschaft im Lande bedürften einer Partei, die sich
auf der Ebene der Politik um die Arbeitersache verdient
macht; die elende, einfach typisch sozialdemokratische
Heuchelei, im Grunde bestünde der Daseinszweck
dieser Partei allein darin, den in der kapitalistischen
Konkurrenz notorisch Zukurzgekommenen durch ausgleichende
Gerechtigkeit auf einen grünen Zweig zu verhelfen; die
Lüge, letztlich wolle diese Partei nur immer an
die Macht gewählt werden, damit sie die der Macht des
Geldes ohnmächtig Ausgelieferten unter Rechtsschutz
stellt und damit Wohlstand verströmt – die ganze
berechnende politische Verlogenheit also, die die
Tradition dieser Partei ausmacht, will der Modernisierer
Schröder unbedingt beerdigt haben und wollen sich seine
Opponenten nicht nehmen lassen.
Und das sind nicht nur die, die sich öffentlich zu Wort
melden. Wie man hört, ist auch die sogenannte ‚Basis‘
dieser Partei von ihrem Chef ein wenig in Unruhe versetzt
worden. Dort, wo in den ‚Ortsmannschaften‘ der Nahkontakt
mit dem Bürger gepflegt wird, will man das schlecht
vermitteln
können, was der Schröder sagt
.
Offenbar hat die organisierte Mitgliedschaft bisher im
wesentlichen auch nur den Traditionsbestand dieser Partei
kultiviert und mit symbolträchtigen Fahnen, Lasalle- und
womöglich sogar Marx-Portraits vermittelt
, daß die
SPD eigentlich ganz anders ist, als man sie vom
Regieren her kennt. Und wenn sie zur Unterstreichung
ihres Antrags, die Partei doch bitte so zu lassen, wie
sie ist, auf die SPD-Wählerschaft verweisen, der Schröder
schwer zu vermitteln sei, so wird auch an der das Gewicht
deutlich, das die Tradition
für die SPD besitzt.
Wie die Sozialdemokraten selbst, so ist zwar auch der
dumme Spruch Wer hat uns verraten?
aus der
Geschichte der Arbeiterbewegung nicht wegzudenken; aber
eben auch der unverwüstliche Stammwähler
dieser
Partei nicht, so daß auch von dieser Kreatur feststeht,
das sie sich gewiß nie sachlich befaßt hat mit dem
Vergleich zwischen politischer Absichtserklärung und dem,
was einem dann so alles als Segen einer
sozialdemokratisch ausgeübten Macht serviert wird. Der
gewohnheitsmäßige SPD-Wähler mag sich vielleicht
irgendwann einmal irgendetwas von dieser Partei erhofft
haben, hat aber dann ganz sicher das Hoffen aufgegeben
und sich zu der Auffassung durchgerungen, daß man der
SPD, wenn man sich von ihr sonst schon nichts zu erwarten
hat, jedenfalls als das kleinere Übel seine Stimme
schenken kann. So konnte die praktizierte Politik dieser
Partei ihre Selbstdarstellung noch so sehr Lügen strafen:
Der Wille, ihr dieses leider
zu honorieren, mit
dem sie ihre gar nicht so besonders arbeiterfreundlichen
Regierungswerke zu begleiten pflegte, war einerseits nie
richtig totzukriegen, andererseits hat er über vier
Wahlperioden hindurch der Partei nicht zur Macht
verholfen. Andere Erwägungen, derer Nationalisten fähig
sind, haben offenbar die Oberhand gewonnen über die
Partei-Ethik ‚Solidarität & Gerechtigkeit‘.
Die Zeiten, in denen die Partei diesen – für ihren Aufstieg zwar nicht ganz unwichtigen, zunehmend aber weniger Erfolg verbürgenden – Zirkus pflegte, immer etwas anderes sein zu wollen, als sie dann war, sind nach dem Willen Schröders vorbei. Die Selbstdarstellung, immer speziell für die ‚kleinen Leute‘ unterwegs sein zu wollen, will er der SPD austreiben und ihr statt dessen ein neues Erscheinungsbild verpassen. Das ist ihm offenbar wichtiger als die Wichtigkeit, die das alte für die SPD besaß, so daß sich schon fragt, was ihm da so wichtig ist.
Vom Ethos des Sozialen zum Kanzlerwahlverein
Nach dem Urteil von Sachverständigen aus Öffentlichkeit
und SPD zielt der Kurs
des Kanzlers eindeutig
darauf, bei den nächsten Wahlen ganz viel Stimmen für
sich und seine Partei an Land zu ziehen. Genau so wird es
dann wohl auch sein, und wenn der Ort, an dem er diese
vielen Stimmen vermutet, neue Mitte
heißt, dann
ist es auch ganz logisch, wenn die Volkspartei SPD sich
ab sofort auch noch als Partei ganz speziell dieses Ortes
präsentiert. Doch wie immer in der Demokratie, so paßt
sich auch hier nicht der passiv Wahlberechtigte den
Stimmungen im Volk an, läuft nicht er seinen Wählern
hinterher, sondern macht sich selbst zum Angebot für sie,
das sie dann abnicken sollen. Und in dieser
Dreiecksbeziehung zwischen ihm, dem Chef der
Regierung, der Partei, die als
‚Transmissionsriemen‘ zwischen ihm und dem Volk
zu funktionieren hat, das ja seine Mannschaft und darüber
ihn an die Macht wählen soll, stört ihn seine
eigene Partei. Die paßt in ihrem überkommenen sozialen
Ethos einfach nicht zu den Gesichtspunkten, unter denen
er allein gewählt werden will. Angesichts der Freiheiten,
die er sich beim Regieren herausnehmen will, hält er es
für schier unerträglich, daß da im ideellen Überbau
seiner eigenen Partei noch immer so etwas wie ein – noch
so windiges, noch so sehr allseits als berechnender
Schwindel durchschautes, aber eben doch: –
höheres Weiß-Warum des Regierens fortgeschleppt
wird, an dem er sich womöglich zu messen hätte. Ihn
stören die hehren Prinzipien von ‚Solidarität‘ bis
‚Gerechtigkeit‘, weil sie zu ihm, zu der Macht, die er
hat, und zur Nation, für die er sie ausübt, in Distanz
stehen, weil sie in all ihrer Idealisierung eben doch
auch noch so etwas anmelden wie einen Vorbehalt, eine
Norm, wie SPD-Politik als dauernde Korrektur an
nationalen Interessen zu gehen habe. Genau daran
will Schröder nicht mehr erinnert werden. Ehrlich, wie er
nun einmal ist, kann er die Differenz zwischen dem, was
er will und tut, und dem ideellen Überbau seiner Partei,
in dem steht, was er eigentlich zu tun hätte, einfach
nicht mehr ertragen, und geradlinig, wie dieser Mann auch
noch ist, paßt er einfach seine Partei sich selber an und
wirft den ganzen legitimatorischen Überbau seiner Partei
einfach auf den Müllhaufen. Freilich nicht, ohne darauf
zu bestehen, daß sich die Partei neue, zweckmäßige Werte
zulegt: Kategorisch verlangt er eine Neudefinition der
Parteiprogrammatik, die die Politik, die wir machen,
legitimiert
(SZ, 15.7),
dekretiert also, daß seine Partei als Kanzlerwahlverein
und sonst nichts zu funktionieren und die demokratische
Öffentlichkeit sich anzugewöhnen hat, seine
Regierungskunst an dem einzigen Maßstab zu messen, den er
allenfalls noch gelten läßt: Dem Gemeinwohl wird
gedient, und sonst niemandem.
Armut als Regierungsprogramm
In diesen Richtungsstreit
, den der Vorsitzende der
SPD in seiner Partei vom Zaune bricht, sollte man sich
besser nicht einmischen. Entschieden nämlich wird der
nicht theoretisch und mit Argumenten, sondern – ganz
demokratisch-sachgerecht – praktisch und mit Erfolgen an
der Wahlfront. An welchen verbindlichen Sprachregelungen
man demnächst das unverwechselbare ‚Profil‘ dieser Partei
erkennen kann, hängt erstens von dem
Wahlergebnis ab, das der betreffende Trendsetter
vorzuweisen hat: Genau richtig liegt er mit seiner
Kursbestimmung
, wenn er beim Wahlvolk nachzählbar
gut ankommt. Deswegen hängt vom Ergebnis allein überhaupt
nichts ab, weil zweitens von viel entscheidenderem
Gewicht die Frage ist, wer die Deutungshoheit
über es gewinnt: Man muß schon seinen Erfolg erfolgreich
als den des eigenen Kurses
und
nicht desjenigen der Gegenpartei deuten, umgekehrt dafür
sorgen können, daß ein Mißerfolg nicht an einem selbst
kleben bleibt, sondern der grundverkehrten Generallinie
der anderen in die Schuhe geschoben werden kann.
Viel interessanter also als der Ausgang dieses Streites ist das, was man schon jetzt der Absicht dessen entnehmen kann, der ihn anzettelt. Denn wenn der Chef der Regierungspartei davon ausgeht, daß die ganzen bewährten Techniken zur Legitimierung seiner Politik absolut untauglich sind, dann kann man das ja auch einmal als sachliche Auskunft darüber nehmen, was er sich bei seinem Dienst am Gemeinwohl politisch so vorgenommen hat. Und da geht der Kanzler und Vorsitzende einer Volkspartei offenbar davon aus, daß sich an den politischen Maßnahmen, die er für den Umgang mit der alten SPD-Klientel genauso wie für den Rest des wählenden Volkes vorsieht, einfach nichts mehr beschönigen läßt – mit Textbausteinen aus der Uraltdatei ‚soziale gerechtigkeit.txt‘ jedenfalls nicht mehr. Wenn er sich auf den Standpunkt stellt, er müßte sich glatt verbiegen, würde er bei seinen Vorhaben weiterhin die alten Kalauer seiner Partei hochhalten, so kündigt er klar und eindeutig an, was er vorhat. Sein Regierungsprogramm für die Abteilung ‚Soziales‘ ist nicht, die Armut in der Gesellschaft zu verwalten, sie mit den Mitteln zu dämpfen und zu mäßigen, die im Sozialstaat dazu eingerichtet wurden; er hat sich vorgenommen, seine politische Kommandogewalt über die sozialstaatlichen Mechanismen der Armutspflege genau andersherum, nämlich zur Wiederherstellung funktioneller Armut zu nutzen. Das Gemeinwohl gebietet für ihn, daß der Reichtum, von dem der Standort lebt, denen überlassen bleibt, die auf seine Vermehrung spezialisiert sind, und für die und ihren vornehmen Zweck hat die Arbeit, die ihn schafft, so billig wie nur möglich zu werden. Genau dafür will er alles tun, was in seiner Macht steht: Wo immer der Staat über seine sozialstaatlichen Regelungsverfahren Zugriff auf Bestandteile des Lohneinkommens seiner arbeitenden Bürger hat, will Schröder diese Macht nutzen und politisch die Senkung des nationalen Lohnniveaus herbeiführen.
Regieren ist sozial!
Wegen dieses Programms – und nicht, weil gerade der
‚Neoliberalismus‘ oder ‚Kapitalismus pur‘ in wäre, eine
‚Arbeiterpartei‘ dagegen out, und ein konturenloser
Windbeutel wie Schröder ohnehin nur immer dem Zeitgeist
hinterherläuft – führt der Mann seinen Kampf für eine
moderne SPD
. Nichts anderes als ‚Kapitalismus pur‘
war schon die ganze Zeit vor Schröder im deutschen
Standort der Regelfall – nur soll der jetzt, wo er die
Macht hat, mit einer anderen SPD ein wenig
anders gemacht werden. Immerhin war ja das
unverwechselbare Kennzeichen seiner Partei, ganz
besonders viel für den ‚sozialen Gedanken‘ übrig zu
haben, in all seiner berechnenden Verlogenheit auf eine
Marktwirtschaft bezogen, in der dieser Gedanke selbst
praktisch etabliert war. Seit dem konservativen
Vater des ‚Wirtschaftswunders‘ konnte sich der
Kapitalismus in Deutschland auch von sich aus mit dem
Attribut ‚sozial‘ schmücken, weil in ihm dem Grundsatz
nach anerkannt war, daß ein Volk, das sich
willig benutzen läßt, bei der Bewältigung der sozialen
Folgen seiner Benutzung schon auch Anrecht auf eine
gewisse obrigkeitliche Fürsorge hat. Daß dies
richtig und gerecht ist und die sozialpflegerischen
Maßnahmen des Staates nur immer doch noch ein wenig
gerechter auszufallen hätten: Das war das Ethos, der
ganze höhere moralische Rechtfertigungsgrund der SPD und
zugleich ihr ganzer Unterschied zu allen anderen Vereinen
der Parteienlandschaft. Daher wird, wenn Schröder diese
Doktrin seiner Partei zersägt, nicht nur besagte
Landschaft einförmiger: Zusammen mit der Partei, die für
ihn stand und ihn parlamentarisch-institutionell
repräsentierte, wird auch dieser ‚soziale Gedanke‘ selbst
aus dem Verkehr gezogen. Die Auffassung, in der
Marktwirtschaft gäbe es in sozialer Hinsicht etwas zu
korrigieren; der Anspruch, als Gegenleistung für so
manche willig ertragene Zumutung wenigstens mit ein
bißchen sozialer Kompensation rechnen zu dürfen – das
alles verliert mit der Partei, die ‚das Soziale‘
politisch repräsentierte und damit offiziell ins Recht
setzte, seine ganze legitimatorische Grundlage. Ab sofort
ist sozial, wenn Schröder regiert, und
dieser Linie haben sich alle sozialdemokratischen und
gewerkschaftlichen Fossile unterzuordnen, die noch immer
meinen, zuviel Armut wäre das Problem der
Demokratie.
PS. Die demokratische
Öffentlichkeit hat etwas anders gelagerte Gesichtspunkte,
unter denen sie sich mit dem Richtungsstreit in der
SPD
befaßt. Schwerpunktmäßig studiert sie, wer sich
wie gegen Schröder das Maul aufzureißen traut – und
diagnostiziert dann eine gewisse Führungsschwäche
in dieser Partei. Umgekehrt ist es für alle diese Freunde
der pluralistischen Meinungsbildung ein Zeichen extremer
Führungsstärke
dieses Kanzler, wenn der dann mit
einem schlichten Schnauze!
seinen einzigen
Diskussionsbeitrag einreicht. Und wenn dann doch noch ein
‚Traditionalist‘ herumpiepst, fangen sie mit der Diagnose
Führungskrise
wieder von vorne an. Daneben aber
versteht man sich auch sehr gut darauf, sich selbst zum
Anwalt der Sache zu machen, um die es dem Kanzler geht.
Auf eigene Weise, versteht sich, so daß die
Sprachregelungen, die der SPD-Chef für die zukünftige
Selbstdarstellung seiner Partei verbindlich machen will,
zu Richtlinien des Zeitgeistes werden. Da muß ein
Schröder nur zu verstehen geben, daß er sein politisches
Wirken ab sofort nicht mehr daran messen lassen will, ob
da irgendjemand unter dem Gesichtspunkt einer sozialen
Gerechtigkeit
an ihm etwas zu beanstanden findet –
schon wissen die Vertreter der Öffentlichkeit, wie sie
und alle anderen fortan über Gerechtigkeit und ähnliches
nachzudenken haben: Was heißt soziale
Gerechtigkeit?
(SZ,
3.8.), fragt da einer von ihnen, nur um in seiner
Antwort loszuwerden, daß ‚sozial‘ und ‚gerecht‘ einfach
ein Widerspruch sind, der Sozialstaat ein Ding
der Unmöglichkeit ist und die Millionen von
Arbeitslosen
– wenn überhaupt etwas – allenfalls
zweierlei gebieten. Erstens genau das, was der Kanzler
ohnehin vorhat, nämlich die zügige Weiterverarmung aller,
die noch Arbeit haben – wenn Lohnerhöhungen
Arbeitsplätze kosten, dann erschweren sie die Beteiligung
an der Gesellschaft, dann ist Lohnzurückhaltung sozial
gerecht.
Und zweitens genau das, was der Kanzler mit
seiner SPD vorhat – sozial gerecht ist, sich alter
Symbole zu entledigen.
PPS: Kaum von Schröder auf den
dafür vorgesehenen Haufen verfrachtet, findet sich auf
dem prompt der Mistkäfer, der sich über die alten
SPD-Ideale hermacht. Genosse Gysi von der PDS ist der
Meinung, daß sich aus dem ideologischen Überbau, mit dem
die SPD-Führung einfach nicht mehr renommieren will,
durchaus noch etwas machen ließe, für seinen Haufen
nämlich, beim Wähler. Womöglich wählt dieses
demokratische Vernunftwesen tatsächlich immer genau die
Partei, die unter der Parole steht, die sie hochhält, und
wenn so viele wegen der Gerechtigkeit, der sozialen, SPD
gewählt haben, dann wählen vielleicht ein paar von denen,
wenn sie demnächst noch ärmer sind, die PDS – wenn die
nur verkündet: Gerechtigkeit ist modern!
Vielleicht aber auch nicht, und die vielen, die wegen der
Gerechtigkeit SPD gewählt haben, wählen genau deswegen
weiterhin die SPD, weil sie von der gesagt bekommen, daß
es für die Wahl dieser Partei gar keinen speziellen Grund
mehr braucht. PDS-Chefideologe Brie jedenfalls hat so
seine Bedenken, ob dieser alte SPD-Köder zum Stimmenfang
noch wirklich zieht – wirft ihn doch gerade eine
veritable Volkspartei mit dem Argument weg, daß mit ihm
keinesfalls mehr Staat zu machen ist. Das beeindruckt
ihn, denn schließlich will auch die PDS mindestens so
modern sein wie alle anderen, also mit den Stimmen des
Volkes Staat machen – und nicht gemeinsam mit ihren
dahinsterbenden Mitgliedern als Politsekte veraltetes
Gedankengut zu Tode pflegen.