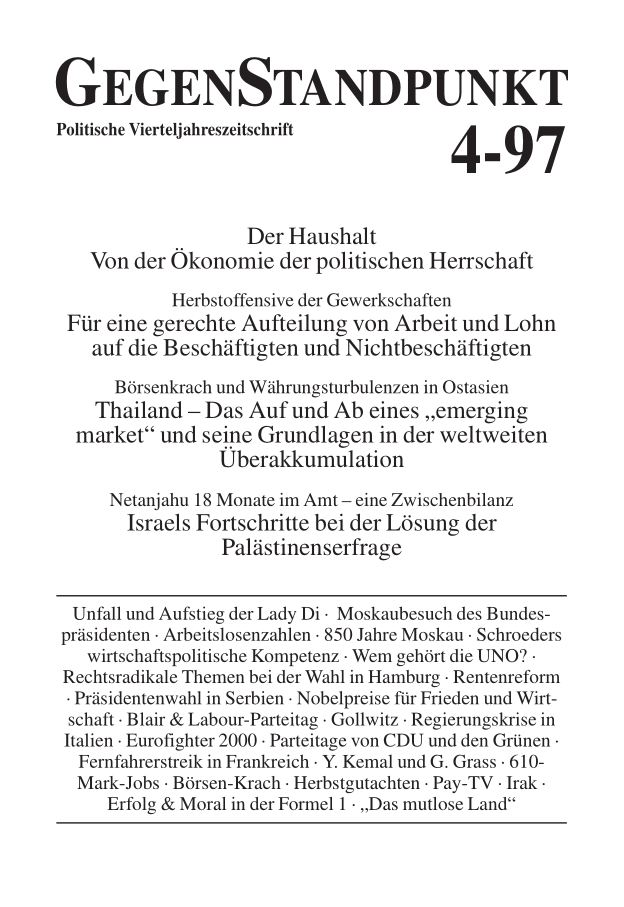Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Soeben erschienen:
Der Anti-Grass. Dichter, wie wir sie mögen
P. Schneider fordert eine radikale Mobilisierung der Moral für den Standort Deutschland.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Soeben erschienen:
Der Anti-Grass. Dichter, wie wir sie mögen
Die Antwort durfte nicht lange auf sich warten lassen. Kaum hatte Günter Grass seine Lizenz zum Dichten zur Staatskritik mißbraucht und maßgebliche Zweifel am Verantwortungsbewußtsein deutscher Geistesschaffender ausgelöst, druckt der Spiegel einen Essay des Berliner Schriftstellers Peter Schneider, 57, einst einer der Protagonisten der 68er. Im Sommer kehrte er von einem neunmonatigen Aufenthalt in Washington zurück – und schaut mit neuen Augen auf Deutschland in der Krise
. Titel: „Das mutlose Land. Blick von außen nach innen oder Plädoyer für mehr Spielfreude“. Message: Unser Land ist relativ spitze. Nur die Leute merken es nicht.
Beim Abschied, als ich meine Tochter von einer Good-bye-Party am Swimmingpool abhole
, erfährt der Dichter S., daß während seiner Abwesenheit in Deutschland die Pest ausgebrochen ist. Mein Hausherr berichtet mir, Deutschland sei in der Liste der wettbewerbsstärksten Länder von Platz 9 auf Platz 25 abgerutscht. ‚Wenn die Deutschen so weitermachen‘, sagt er, ‚können sie bald den Anschluß an Afrika suchen‘.
Besorgt kehrt S. in die Heimat zurück. Zunächst scheint alles in bester Ordnung: Als ich in Berlin aus dem Flugzeug stieg, hatte ich nicht den Eindruck, ein Land zu betreten, dem Versteppung drohte. Die deutsche Krise, die inzwischen auch international Schlagzeilen macht, war mit bloßem Auge nicht leicht zu erkennen. Auf der Stadtautobahn sah ich Kolonnen blankgeputzter Autos, hochzylindrisch, keine Dellen
. Wer hätte das gedacht? Die Besserverdienenden fahren immer noch in ihren dicken Schlitten, da kann es den Leuten so schlecht nicht gehen. Doch dann bricht knüppeldick der Kulturschock herein.
S. will ein externes CD-Rom-Laufwerk mit eingebauter Soundkarte kaufen. Der Verkäufer schleudert mir ein zurechtweisendes ‚Ham wa nich, jibt et nich!‘ entgegen
. Der sensible Essayist ist tief berührt. In diesem Augenblick dachte ich an die freundlichen Verkäufer bei Richards Computer in Washington und fragte mich: Wie will man mit dem hier angebotenen Mix aus Arroganz plus Inkompetenz bestehen? Wie soll das gutgehen, und soll es überhaupt?
Wissen diese Lümmel, daß sie in diesem Augenblick den CD-Standort Deutschland verraten haben? Wollen sie das sogar? Der Dichter nimmt sich kurz beiseite: Bin ich noch ein wenig überreizt
, aus jedem Erlebnis einen patriotischen Elefanten zu machen? Doch dann zieht es ihn weiter, ruhelos, mit neugierigem Blick auf dieses merkwürdige Land
. Keiner grüßt ihn. Er kennt die Menschen zwar auch nicht, aber woher das konzentrierte Wegschauen, die Anspannung im Bus, im Supermarkt?
Kommen sie von der Arbeit, ärgern sie die Preise? Mag sein. Vielleicht sind sie aber auch nur still vergnügt. Oder sie denken an gar nichts. Wer weiß! Doch des Poeten Blick geht eh tiefer: Muß man deshalb gleich so böse schauen? S. erinnert sich an seine drei Semester Psychologie und stellt die Antwort als Frage: Woher rührt diese rätselhafte Selbstverpflichtung zum Mißmut und zum Verdruß?
Vorsatz! Das ist es! Vorsätzlich schlechte Laune! Wo bleibt das amerikanische ‚I’m fine‘, die beherzte italienische Lüge ‚non c’è male‘, der emporgestreckte Daumen, den man selbst unter schlimmsten Umständen in ganz Lateinamerika zu sehen bekommt?
Das hat S. auf seinen Reisen zu römischen Arbeitern, amerikanischen Brokern und brasilianischen Straßenkindern gelernt: Lachen macht frei, vor allem, wenn man keinen Grund dazu hat. Auch ihm geht es jetzt besser. Nachdem er etliche Passanten ungefragt mit der Auskunft ‚Mir geht es wunderbar!‘ schockiert
hat, fährt er, vor Freude über seine Entdeckung inzwischen halbblind, mit der S-Bahn zum Potsdamer Platz: Man sieht nichts als Kräne, tadellos planierte Sandflächen, eine lange Küste ohne Meer, schwindelnd tiefe ausbetonierte Baulöcher, Grundwasserseen, auf denen schwimmende Kräne operieren. Eigentlich phantastisch
, dieser ganze Schutt, von morgens bis abends das atemberaubende Tempo
der Preßlufthämmer: Berlin baut seine Pyramiden, ein nie dagewesenes pharaonisches Vorhaben.
Doch wieder muß der nicht mehr ganz junge Musensohn sein schaurig Lied anstimmen: So viel Aufbruch war zu meiner Lebzeit nie, aber wo ist die Aufbruchsstimmung?
So eine geile Reichshauptstadt, aber keiner schunkelt… (Hier bricht das Manuskript vorübergehend ab.)
Der Dichter schwadroniert nicht nur. Seine wüst assoziierende Stadtbegehung hat Methode. „Blick von außen nach innen“: Er hat sein Fernglas auf die Suche nach dem deutschen Volkscharakter eingestellt; kein Wunder, daß er ihm dann auch bei Aldi begegnet. Was S. so „merk-würdig“ findet, ist sein eigenes Phantom: Seine Wahrnehmung der Welt findet ausschließlich unter dem Gesichtspunkt statt, wie die Leute sich zu ihr stellen; und beides kann er überhaupt nicht auseinanderhalten.
Er wandelt nämlich erstens, um das Wenigste zu sagen, auf den Pfaden einer nicht ganz richtigen, weil psychologischen Theorie des Ärgerns. Dem Beobachter ist gleichgültig, unter welchen Verhältnissen die Leute leben, womit sie umgehen müssen, wozu sie sich stellen; seine Neugier gilt der immer gleichen, absolut verselbständigten Frage: Welche Fresse ziehen sie, Mundwinkel nach unten oder oben? Die Diagnose „Selbstverpflichtung zum Mißmut“ drückt das gleich doppelt aus. Wer nach Mißmut fahndet, redet von keiner Sache, mit der die Leute zu tun haben, sondern nur noch von einem – vollkommen abgehobenen, sich selbst produzierenden – Gefühl; und das „entdeckt“ er allenthalben, weil er auf der Suche nach guter Laune ist. Forschungsdrang nach der „rätselhaften“ Herkunft allgemeinen „Verdrusses“ bewegt nur den, der eigentlich sagen möchte, daß die Leute sich anders, nämlich irrsinnig frohgemut, zu ihren Lebensumständen stellen sollten.
Er beantragt damit zweitens eine sehr grundsätzliche, weil methodische Haltung zur Welt. Fröhlich sein, ohne jeden Grund und Zweck – außer dem einen eben: froh zu sein. Die Einstellung ist das Leben! Der Autor merkt sogar an, daß der „emporgestreckte Daumen“ seiner amerikanischen Freunde und Elendsgestalten aus den Slums kein Lagebericht ist, sondern eher eine Wette auf die Zukunft darstellt, eine Ansage an die Welt und an sich selber, daß man die Probleme, die man selbstverständlich hat, lösen will
; aber genau diese Haltung schätzt er. Der heitere Reiseschriftsteller leugnet deshalb gar nicht, daß die Leute in Armut und Not leben – aber das ist ja „selbstverständlich“; umso wichtiger, daß sie sich in diesen Verhältnissen einfach klasse fühlen und eine gesunde Zockermentalität aufbringen. Die Welt als unbegrenzte Möglichkeit, die aber nur dann eine ist, wenn man feste an sich glaubt: Aus dieser kapitalistisch-psychologischen Lebenslüge macht Schneiders „Don’t worry, be happy!“-Zynismus ein Stück Literatur. Geblendet von seiner Heilsbotschaft, Dauerstrahlen als Rezept für ein besseres Leben zu empfehlen, merkt er nicht einmal, wie real hierzulande psychologische Weltanschauung und vorsätzlicher Frohsinn existieren: TV-Reporter, die Kundinnen beim Schlußverkauf und Flutopfern am Oderbruch die unvermeidliche ‚Wie-fühlen-Sie-sich-gerade‘-Frage stellen (und meistens eine andere Antwort kriegen als ‚Arschloch‘), und Leute, die ‚heute einfach unheimlich gut drauf‘ sind, scheint S. bei seinen Studien glatt übersehen zu haben. Oder – das ist ihm alles noch zu ‚privat‘; denn der Dichter hat explizit mehr im Sinn als den Appell, inneren Schwingungen zu lauschen und 24 Stunden zu lächeln.
Das „Plädoyer für mehr Spielfreude“ ist nämlich drittens eine politische, weil volkstümelnde Werbung für Patriotismus. Wo S. das Fehlen jeder Spielfreude, jedes Werbens für die eigene Liebenswürdigkeit, jedes Ehrgeizes
bemerkt haben will, da beklagt er ein Gebrechen des Volkes und darin ein Defizit, das die Nation teuer zu stehen kommt. Seine Psychoanalyse gilt dem Deutschen, jenem Menschenschlag, dem er sich so sehr zugehörig und im Innersten verbunden fühlt, daß er ihn verachtet. Was die niederschmetternde Episode im Computerladen schon andeutete – totale Gleichgültigkeit der Verkäufer, welchen Eindruck der Kunde von Deutschland gewinnt! –, verdichtet sich über sensible Beobachtungen zum Bild einer kollektiven Weigerung
, sich für das Schicksal des Vaterlandes zu interessieren oder gar zu engagieren. Keine Frage: Der gute Mann hat seinen Herzog gelesen. Er kommt übern Großen Teich nach Hause, inspiziert seine Landsleute und bescheinigt ihnen einen Dachschaden. Die Deutschen sind unfähig, sich selbst zu lieben
, eine schwere Unterentwicklung des patriotischen Kleinhirns, die – ab hier unterscheidet er sich von seinem Präsidenten – allerdings nur schwer heilbar ist: Können teilnahmslose Jammerlappen, die sich nicht einmal über das neue Herz Europas
freuen können, das pyramidengleich in ihrer Mitte
ausgebuddelt wird, sich überhaupt einen „Ruck“ geben?.
So erreicht die literarische Deutschlandrundfahrt, Teil 2, ihr Ziel in der empfindsamen Aufbereitung einiger politischer Lehrsätze, ohne die ein solches Opus nicht zu haben ist:
- Der Staat lebt von den Leuten, nicht die Leute von ihm. Merkt Euch das!
Bei der Einschulung meiner Tochter in ein Gymnasium in Charlottenburg
erlebt S. sein Dejà-vu. Der Antrag, die Eltern sollten die Englischbücher bezahlen, trifft auferbittertes Schweigen. Was die Runde lähmte, war das Festhalten an einem eigentlich schönen Prinzip: Der Staat ist für die Schulbücher zuständig. Die Idee, daß sie einstweilen selber einspringen müßten, wenn der Staat versagte, ja daß sie und niemand sonst die Herren des Staates sind, kam irgendwie nicht auf
. Damit ist irgendwie auch klar, daß S. nie auf die Idee kommt, die Leute sollten sich nicht alles bieten lassen. Umgekehrt: Vor dem Hintergrund der angeführten nationalen Notwendigkeiten tadelt er ihreRealitätsferne
, sich darauf nicht einstellen zu wollen. Für diese Rüge reanimiert er, ein letztes Mal, das Märchen, der Staat habe bis ebensoziale Errungenschaften und Luxusartikel
wie Rente, Sozialhilfe und Urlaubsreisenverteilt
. Dann wird ihm fast zeitgleich mit Guido Westerwelledeutlich, daß eine Gesellschaft auf Dauer nichts verteilen kann, was sie nicht erwirtschaftet
. Wie das Englischbuch, das dieses Jahr 24,50 kostet, weil es noch nicht erwirtschaftet wurde. Dummerweise durchblickt nur der aufgeklärte Dichter diesen komplizierten Gedanken und er steht mit seiner Spitzenideeallein in der Aula
, umgeben von hündisch ergebenen Sklavennaturen, von denensich jeder panisch an seine Frühpension, sein 13. Monatsgehalt, seine unkündbare Stellung, seine Umzugshilfe, sein Steuerschlupfloch festkrallt, als wären es Menschenrechte.
Hier trifft S. seine übellaunigen Kreaturen aus dem Bus ein zweites Mal: „Panisch“, also aus völlig abwegigen Gründen, kleben sie an „Leistungen“, von denen der Sozialstaat ihr Auskommen abhängig gemacht hat, und verpassen die einmalige Chance, sich zu seinemHerren
zu befreien, indem sie solidarisch ihren Obulus bei ihm abliefern. - Arbeiten zu müssen, ist ein Besitzstand.
Sein Schlüsselerlebnis auf der Elternversammlung hat Schneider gezeigt: Ein alter 68er braucht sich von seinem gestrigen Proletkult nicht zu verabschieden; er muß ihn nur umwidmen. War der Lohnarbeiter früher hoffnungsspendendes „revolutionäres Subjekt“, weil er so arm dran und hilflos war, stilisiert er ihn heute zum tätigen Ausbeuter, der durch verbissene Besitzstandswahrung seine ehemaligen Klassenbrüder ins Elend stößt: „‚Die Ausbeuter‘ sind nicht nur die Millionäre, es sind Millionen: tüchtige, hochorganisierte Minoritäten, die stur auf ihre inzwischen unbezahlbaren Privilegien pochen und sich allesamt als Opfer aufführen. Die wirklichen Opfer, die das Drama der nationalen Starre auszubaden haben, sind die Millionen Arbeitslosen.“ Daß der „Besitzstand“ beider „Minoritäten“ darin besteht, auf Arbeit und damit auf die Rechnung des Kapitalisten angewiesen zu sein, die entscheidet, wie viele Millionen Lohnabhängige rentabel auszubeuten sind, geht S. zurecht nichts an. Ihm ist es schließlich um Anpassung an solche „Probleme“ zu tun, „die man selbstverständlich hat“. Also muß der dichtende Nationalökonom seinen gierigen Mitmenschen aus dem Panikorchester den Reim vortragen, den er sich auf die Lage gemacht hat:
- Flexibel sei der Mensch, billig und gut.
Mit dem tatsächlichen Verlust an Kaufkraft und Arbeitsplätzen scheint nicht die Tatkraft, sondern der Wirklichkeitsverlust zuzunehmen. Das panische Festhalten am erreichten, aber nicht mehr haltbaren sozialen Status führt zu noch größeren tatsächlichen Verlusten, die ihrerseits zu noch größeren Unbeweglichkeiten führen.
In Prosa: Wenn sonst schon alles unerschwinglicher wird, müssen wenigstens die Leute ihren Preis senken; wer das nicht kapiert, ist selber schuld, wenn er arbeitslos wird oder bleibt. Doch S. sieht schwarz, denn: - Das deutsche Volk packt die Zukunft nicht an.
Zukunftsfreudigere Völker, die die Umstellung auf die Globalisierung als nationale Aufgabe erkannt und angepackt haben, haben inzwischen neue Jobs und neue Reichtümer geschaffen. Mir ist aufgefallen, daß die Nachrichten, die hierzulande über den Aufschwung in den USA zu lesen sind, nur dessen negative Aspekte ins Licht stellen. Etwa: Ja, die Amerikaner haben zwar Millionen neue Jobs geschaffen, aber die Löhne liegen im Bereich unserer Sozialhilfe. Daß auch Millionen gut oder hochbezahlter Jobs entstanden sind, teilt sich irgendwie nicht mit.
Allerdings scheint sich dem USA-Kenner bei seinem Besuch nicht mitgeteilt zu haben, daß ein paar Hochbezahlte gar nicht ausbleiben können, wo „die Wirtschaft“ gerade neue Armenberge produziert und die zunehmende Arbeitslosigkeit ausnutzt, einige Millionen mehr in 610-McJobs rumturnen zu lassen. Irgendwie muß doch auch irgendwer an der Armut verdienen und auf sie aufpassen, oder? Sei’s drum: Was S. „Zukunftsfreude“ tauft, ist die gelungene Anpassungshaltung, alles so zu nehmen, wie „es“ kommt, unbeeindruckt optimistisch „nach vorne“ zu schauen und dabei das Vertrauen und die Liebe in die nicht zu verlieren, die diese Zukunft bestimmen. - Gute Laune ist die Produktivkraft der Nation.
Zur Erzeugung dieser Essenz braucht es von unten jede Menge Staatsvertrauen, von oben die „kraftvolle“ Verbreitung von Zuversicht in die Macht der Nation – den sprichwörtlichen „Ruck“ eben. Doch denkt der Poet an Deutschland, sagt er ‚Gute Nacht‘: „Vielleicht hat nichts den Aufbruchswillen so behindert wie Helmut Kohls Versäumnis, die Deutschen auf die Chancen und Verzichte vorzubereiten, die die Riesenaufgabe der Vereinigung bot und abverlangte.“ Aber auch die eigene Zunft verbreitet nur Düsternis statt nationale Munterkeit:
Es mutet seltsam an, wenn Günter Grass ausgerechnet in einem Augenblick, da der ‚Wirtschaftsstandort Deutschland‘ tatsächlich bedrohlich abwärtstrudelt, mahnt, Deutschland sei zum bloßen ‚Wirtschaftsstandort verkommen‘. Es ist ein Donnersatz, aus planetarischer Entfernung gesprochen.
Die Kollegen-Schelte des erdnahen, weil pur affirmativen Schriftstellers zieht eine Art Fazit. In Schneiders Welt ist die Einstellung der Leute zu sich selbst nicht nur der ganze Grund dafür, wie es ihnen ergeht, sondern deshalb auch das Mittel der Nation. Wo Grass höhere Werte vermißt und deren Abwesenheit der moralischen Verkommenheit der Nation ankreidet, leidet S. umgekehrt mit dem Standort und fordert eine radikale Mobilisierung der Moral für ihn. Oder, um es mit Schneiders Lieblingsautor zu sagen: Mach’ es wie die Sonnenuhr, zähl’ die schönen Stunden nur (Tony Marshall).