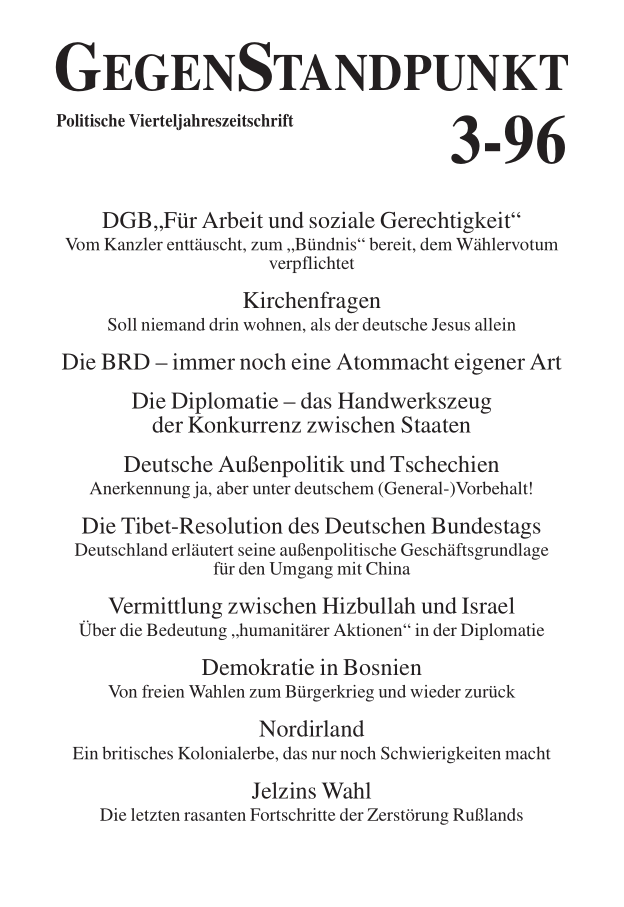Jelzins Wahl
Anmerkungen zu den letzten rasanten Fortschritten der Zerstörung Russlands
Mit seiner Wiederwahl hat sich Jelzin den Zugriff auf Machtmittel gesichert. Die Macht des russischen Präsidenten ist dabei nicht identisch mit einer Staatsgewalt, die eine wirksame Herrschaft über die Gesellschaft ausübt, weil ihr dazu in Russland die materielle Grundlage fehlt. Diese hat sie selbst durch die Einführung des Eigentums zerstört. Das Ausland kreditiert die Fiktion einer funktionierenden Staatsmacht, weil es an der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse interessiert ist – und sei es auf Kosten von deren Voraussetzung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Jelzins Wahl
Anmerkungen zu den letzten rasanten Fortschritten der Zerstörung Rußlands
Die russischen Präsidentschaftswahlen wurden im Inland mit dem Versprechen, im Ausland mit der Erwartung verbunden, daß durch sie die Machtfrage eindeutig geklärt und die Staatsspitze gestärkt würde. Von einem neu mit der Legitimation der Wähler und den Vollmachten des Amtes ausgestatteten Präsidenten erwartete man sich die Unterbindung von Eigenmächtigkeiten der Regionen, die Bekämpfung des Verbrechens und der Mafia-Wirtschaft sowie das Vorantreiben der Reformen. Die Wahlen sind sogar im richtigen Sinne ausgefallen: Jelzin, der Mann des westlichen Vertrauens, hat es geschafft, sich im Amt zu halten. Nichts von dem Erhofften ist jedoch eingetreten.
Das mag diejenigen irritieren, die Jelzins Wahlkampf mit Staunen und Bewunderung begleitet und ihm zu seinem geschickten Schachzug mit Lebed gratuliert haben. Tatsächlich war des Resultat abzusehen.[1] Die Auftritte des wahlkämpfenden Präsidenten und die „Vereinigung zweier Männer und zweier Programme“, mit der er seinen Sessel rettete, verraten nämlich jeweils das Gegenteil der beabsichtigten Botschaft. Die erste Probe gemeinsamen Regierens, die die beiden Männer am Fall Tschetschenien gegeben haben, zeigt, daß der russische Staat, der seine Basis in einem funktional unterworfenen Volk längst verloren hat, an seiner Spitze aus nichts weiter als der Rivalität von Machtkonkurrenten besteht. Und wie die russischen Massen über den Winter kommen sollen, ist genauso unklar wie das Schicksal der Zinszahlungen, die das Land zum Herbsttermin schuldet – auch wenn beide Dinge ganz unterschiedlich viel Aufmerksamkeit finden.
Nochmals: Was ein erfolgreicher Wahlwerbefeldzug verrät
Daß reiche Männer aus ihrem Privatvermögen etwas abzweigen und damit Wahlkampf führen, um beispielsweise Präsident von Amerika zu werden, das kennt man, und das geht demokratisch und vermögensrechtlich in Ordnung. Aber was soll man davon halten: Wo Jelzin im Wahlkampf hinkommt, zahlt er höchstpersönlich Löhne aus, die sein Staat den Werktätigen seit bis zu einem Jahr schuldig geblieben ist. Jedem Dorf, das das Glück seines Besuches erfährt, verspricht er eine Industrieansiedlung, jeder Stadt ein neues Schwimmbad – und das nicht als Folge des Aufschwungs der Wirtschaft, den er einzuleiten gedenkt, sondern einfach so, aus seinem „präsidentialen Verfügungsfonds“. Die Bilder gingen um die Welt, als Boris einmal „einfuhr“ und der ungläubig lachenden Aufzugsführerin des Bergwerks bierernst ein Auto zu kaufen versprach, sie solle nur Farbe und Typ nennen. Daß es das Geld, das er in wenigen Wochen verteilt hat, in ganz Rußland eigentlich nicht gibt,[2] hat den Präsidenten von seinem „Argument“ nicht abhalten können: ‚Seht her, Boris Nikolajewitsch hat die Macht, euch zu kaufen, was er will. Alles Geld ist sein Geld, der Staatshaushalt der russischen Föderation ist seine private Schatulle!‘
Der Mann kämpft um die Macht; mit allen Mitteln – Geldmitteln in dem Fall –, auf die er Zugriff hat. Um was für eine Macht: Das zeigt der Kampf, den er darum führt. Um eine Macht, die das gesellschaftliche Leben institutionell voll im Griff hat; die ihre Bürger total und alternativlos ihren Vorschriften unterworfen und mit denen das marktwirtschaftliche Geldverdienen als allein- und allgemeingültige Lebensbedingung durchgesetzt hat – um eine Staatsmacht also, wie man sie vom bürgerlichen Gewaltmonopolisten kennt, kann es sich jedenfalls nicht handeln. Eine Präsidentenmacht, die sich darin beweist, daß sie gegen das flächendeckende Versagen der in aller Form vorgeschriebenen Arten, sich seinen Lebensunterhalt zu erwerben, Geschenke setzt, beweist damit nur eins: daß sie ihre sachzwanghafte Funktionalität für das gesellschaftliche Dasein und Überleben ihrer Bürger längst eingebüßt hat und die Mittel, über die sie gebietet, auch nicht dafür einsetzt, ihre Untertanen klassenstaatlichen Dienstvorschriften so wirksam zu unterwerfen, daß die Dienstkräfte sich davon glatt miternähren können. Die Macht, die Jelzin hat und die er dafür verwendet, sie wiederzugewinnen, firmiert zwar als staatliche; sie ist aber die wirksame Herrschaft über die Gesellschaft nicht, in der die bürgerliche Staatsgewalt besteht; ihr fehlt die materielle Grundlage in einem Produktionsprozeß, den sie ihren Bürgern so zwingend vorschreiben müßte, daß diese sich ihm fügen müssen, insoweit aber auch davon leben können.
Worum kämpft Jelzin dann stattdessen? Eben um genau die Macht, die er hat und demonstriert: um den Zugriff, den er auf die Goldschätze in den Tresoren der Zentralbank hat, auf die staatliche Rubeldruckerei und darüber auf die noch im Land hergestellten Waren, auf Devisenkredite, die Staatsmänner aus dem Westen gegeben oder veranlaßt haben, weil sie ihn als ihre Kreatur schätzen. Aber was ist das für ein Zugriff, der weder nach den Regeln des Privateigentums erfolgt noch nach denen staatlicher Haushälterei? Worauf gründet sich überhaupt diese weder private noch eigentlich regierungsamtliche Macht?
Jelzins Wahlkampf gibt auch darüber Auskunft. Er bringt es nämlich fertig, alle relevanten Fernsehstationen auf Dauerwerbung für sich zu verpflichten. Andere Bewerber kommen kaum oder gar nicht in die Medien. Im Rahmen dieser Show häufen sich die Ergebenheitsadressen der kleineren Mächtigen im Reich, die allesamt, genauso wie die Chefs der Medienanstalten, ihre Posten der Intrigenwirtschaft, den Erpressungen und Manipulationen ihres Präsidenten verdanken. Diese merken, daß Jelzin sich schwerlich von seiner Position trennen läßt, sie also weiter mit ihm rechnen müssen. Sein Wohlwollen suchen sie sich dadurch zu sichern, daß sie nicht die letzten sein wollen, die ihre Loyalität erklären. Das kommt dann wieder ins Fernsehen und beweist die bedeutende Anhängerschaft, die der Präsident hinter sich hat. Und nicht nur das: Jelzin warnt öffentlich vor einem Bürgerkrieg, falls die Kommunisten gewinnen sollten. Die Wähler verstehen, wer den Bürgerkrieg gegen einen demokratisch gewählten Kommunisten vom Zaun brechen würde. Leute aus Jelzins Umkreis fordern die Aussetzung der Wahl, solange Siegesaussichten der Kommunisten bestehen; der Chef selbst weigert sich öffentlich, ein Gesetz zu unterzeichnen, das die Übergabe der Macht an einen eventuellen Nachfolger regeln sollte. Für diesen Fall werden erst gar keine Vorkehrungen getroffen.
Alle diese Manöver Jelzins, Meinungsmacher und Provinzgouverneure, Volksmassen und „Elite“ auf sich einzuschwören, belegen, daß er sich auf eins jedenfalls nicht verlassen kann: auf die wirksame personenunabhängige Einschwörung aller Amtspersonen, Würdenträger, Meinungsverantwortlichen und Massenmenschen auf eine Staatsmacht, um deren obersten Angestelltenposten er sich bewerben könnte. Er wirbt nicht um Zustimmung, damit er die ohnehin von allen anerkannte Staatsmacht anerkanntermaßen bedienen kann; er nutzt vielmehr die zuvor gestifteten persönlichen Abhängigkeiten, erpreßt oder erkauft Loyalitäten – des Fernsehens, der Bankpräsidenten, überhaupt aller, die der Form nach unterschiedliche Ebenen, Institutionen oder Organe staatlicher Macht repräsentieren und um deren wirkliche Macht es auch nicht anders steht als um die seine –, und zwar dazu, genau diese Macht zu behalten. Er repräsentiert und exekutiert kein staatliches Gewaltmonopol, sondern er übt den Einfluß aus, den er sich angeeignet hat – auf andere, die sich auch ein Stück Einfluß angeeignet haben, nämlich entlang den Hierarchien und Kompetenzen der alten, längst außer Kraft gesetzten Staatsgewalt. Seine Macht besteht in den partikularen Gewalten, die nicht mehr zu einem ordentlichen Gewaltmonopol zusammenwirken, aber noch fortbestehen, und zwar soweit er sie für sich zu mobilisieren, auf sich als ihren – einzigen – gemeinsamen Nenner festzulegen vermag.
Die anspruchsvolle Behauptung, daß beides dasselbe wäre: seine Macht und eine monopolisierte, durchgreifend wirksame Staatsgewalt, ist Jelzins schlagendstes Wahlkampfargument: Ich oder das Chaos!
Ich habe diese Reform des Landes angefangen, ich allein weiß sie zuende zu führen. Ich habe dazu einen Plan!
Praktischen Nachdruck verleiht er diesem Argument, indem er die genannten und noch andere Beweise liefert: Er verfügt über Geld, echtes und russisches; sein Wort gilt im Fernsehen; seine Ukasy setzen Gouverneure ein oder ab; sein Machtwort stoppt sogar den Krieg in Tschetschenien für eine Woche, verwandelt Kriminelle und Banditen kurzfristig in honorige Waffenstillstandspartner – und wieder zurück, tröstet Soldatenmütter und -frauen, deren Söhne resp. Männer ebenfalls sein Machtwort in die Schlächterei im fernen Süden geschickt hat… Lauter Beweise präsidentieller Machtvollkommenheit – die nur eins belegen: Was wie ein staatliches Gewaltmonopol aussehen soll, ist in Wahrheit auf die Reichweite seines Zugriffs auf Geld und Fernsehchefs, auf die Gefolgschaft, die er seinen Kommandos zu verschaffen weiß, beschränkt. Das ist zwar, im Vergleich zu jeder Konkurrenz, – noch! – ungeheuer viel; insbesondere aufgrund seiner Anerkennung durch die wirklich Mächtigen dieser Welt – daß er und seine Mannschaft dort, sogar im Kreis der G7, als reguläre Machthaber behandelt werden und jede Art Kredit genießen, ist noch der härteste Bestandteil des Scheins von Souveränität, mit der der Präsident sich umgibt. Worüber er verfügt, das ist jedenfalls mehr – wenngleich „vor Ort“ schon gar nicht mehr soviel –, als was organisierte Banden an flächendeckender Kontrolle über Land und Leute hinkriegen. Aber es ist ein schlechter Witz, gemessen an einer unpersönlich funktionierenden Staatsautorität. Was sich mit den Insignien eines politisch respektablen Staatswillens schmückt, ist in Wahrheit nichts anderes als die Willkür eines Mannes, dem zwar genügend Mittel und Gefolgsleute zur Verfügung stehen, um seinen Größenwahn zu befriedigen, aber nichts, um der Nation eine verbindliche, allgemein respektierte Staatsräson aufzuerlegen. Mit der theatralischen Verkündigung, nur er stünde zwischen Rußland und dem Untergang, gesteht Jelzin ein, daß es keine funktionierenden Institutionen gibt, die diese Leistung verläßlich erbringen könnten – und wo die fehlen, da ist es auch mit ihm als Brandschutzmauer nicht weit her; was das Land ja auch zu spüren kriegt und jeder merkt, so daß die „Rettung Rußlands“ zum allgemeinen Wahlkampfschlager wird.
Dabei ist es keineswegs so, daß Jelzin bloß die Mittel abgehen würden, um aus seiner persönlichen Autorität mehr, nämlich einen allgemeinverbindlichen, als Staatsgewalt organisierten und funktionierenden Gewaltapparat zu machen. Immerhin hat er die Gewalt, die er sich im Kampf gegen die alt-sowjetischen „Putschisten“ vermittels persönlicher Loyalitäten aneignen konnte, zur Zerstörung der alten Staatsmacht eingesetzt; die Entfesselung der zuvor in den realsozialistischen Staatszusammenhang eingebundenen Mächte war seinerzeit das wichtigste Mittel, sich Zustimmung zu verschaffen; und davon hat er auch seither nichts widerrufen. Er hat die Macht, die er sich angeeignet hat, überhaupt nie dazu benutzt, sie von sich und seinem Gefolgschaftswesen wieder abzulösen und zu einem funktionellen, Sachzwänge schaffenden und in denen selber sachzwanghaft verankerten Herrschaftsapparat über eine dementsprechend wirksam unterworfene Gesellschaft zu machen. Wozu stattdessen – auch das zeigt die Wahl, die er angeordnet und arrangiert und gewonnen hat (unter dem nicht endenwollenden Applaus aller Demokraten, die bei ‚Wahl‘ bloß ‚Legitimation‘ denken und nicht an die Macht, die es erst einmal geben muß, damit sie sich aufgrund der Wahl ihrer Inhaber auch noch des Luxus einer legitimierenden Zustimmung erfreuen kann). Weder sind Wahlkampf und Wahl ein Mittel, in der Gesellschaft existierende Partikulargewalten, die ihren Kontext in einem gewaltmonopolistischen Unterwerfungsapparat verloren haben, wieder zu einer funktionierenden Herrschaft zusammenzusetzen, noch waren sie je und sind sie von Jelzin so gemeint. Sein Wahlkampf war ein Kampf für die fortdauernde Gleichsetzung seiner Verfügungsgewalt über allerhand Machtmittel mit der russischen Staatsgewalt – und so war er auch gemeint –; gegen andere, die sich anheischig machen, in ihrer Person dieselbe Gleichung besser hinzukriegen – wenn man sie läßt. Jelzin wahlkämpft nicht um die Legitimierung seiner Macht, sondern gegen deren Enteignung: Sie sich zu erhalten, ist schon der ganze Zweck der Wahl – und das ganze Weiß-warum seines Machtgebrauchs.
Was Jelzin damit heraufbeschworen und in der Form eines Kampfes um Wählerstimmen arrangiert hat, ist ein Machtkampf der banalsten Art: ein Kampf eben nicht um Führungsposten im Staat, sondern um die Aneignung von Herrschaftsmitteln, deren Funktionalität für ein staatliches Gewaltmonopol eben durch ihre Okkupation durch den antikommunistischen Reformpräsidenten Jelzin kaputtgegangen und durch die Zwecksetzung ersetzt worden ist, den Zugriff ihres Inhabers auf sie aufrechtzuerhalten. Daß dieser Machtkampf noch nicht zum offenen Bürgerkrieg gediehen ist, liegt nicht am demokratischen Arrangement mit Wahlurnen statt Barrikaden und schon gar nicht daran, daß es Jelzin und seinen „Getreuen“ nicht bitter ernst wäre mit der „Verteidigung der Reformen“; eher schon an einer unterentwickelten Kampfbereitschaft der post-„kommunistischen“ Jelzin-Gegner. Die Machtkämpfe, die sich abspielen – vor, bei und erst recht nach der Wahl –, sind jedenfalls von bürgerkriegsmäßiger Art.
Und Jelzins eigenartiger Deal mit seinem anderen Konkurrenten, dem General Lebed, ist der drastische fortdauernde Beleg dafür.
„Die Vereinigung zweier Männer und zweier Programme“
Die Auftritte, mit denen Jelzin dem Volk die Zustimmung zu sich abverlangt, taugen für ca. 35% der Wahlstimmen, kaum mehr als der kommunistische Gegenkandidat erzielt. Jelzin zahlt einen Preis und versucht seine Macht dadurch zu erhalten, daß er sie mit seinem anderen Hauptkonkurrenten teilt. Nicht etwa in Form eines „Ticket“ für die Stichwahl und nicht als projektierte Koalition für den Fall des gemeinsamen Sieges, sondern sofort: Über Nacht macht er den drittplazierten General Lebed, den er vorher von seinem Posten in Transnistrien abgesetzt hatte, zum – nach ihm – mächtigsten Mann in Rußland. Dazu braucht er kein Wahlergebnis und keine konstitutionelle Amtseinführung. Die Institutionen der Moskauer Macht sind seine Schöpfung, alle Funktionsträger sind nur Berater und Helfer, die ihm zuarbeiten: ‚Ich kann einsetzen, ich kann auch entlassen!‘ Schon vor der Stichwahl „regiert“ Lebed in Moskau mit. Die neue Verteilung der Macht findet wegen der Wahl, aber außerhalb von ihr statt und tut ihre Wirkung: Der Inhaber der Macht und eine zahlenmäßig bedeutende Opposition gegen ihn haben sich zusammengetan, um den Kommunisten keine Chance zu lassen; das fait accompli, von dem die Wähler wissen, daß sie es nicht ändern, entscheidet die Wahl.
Um seine Macht zu erhalten, holt Jelzin also einen Mann an seine Seite, der sich genau wie er als Retter der Nation empfiehlt – mit dem Versprechen, höchstpersönlich für Ordnung zu sorgen, Verbrechen und Korruption zu bekämpfen, die Armee zu reformieren, überhaupt die von Jelzin vergeigte Staatsautorität wiederherzustellen. Zwei Gleichgesinnte tun sich zusammen – nicht um endlich gemeinsam an die Installierung eines wirklichen, von ihrer persönlichen „Autorität“ abgelösten Gewaltmonopols heranzugehen; vielmehr weil beide ihren Machtwillen für den einzig geeigneten Staatswillen Rußlands halten, deswegen für sich und somit gegeneinander die Aneignung von Machtmitteln betreiben und dafür aufeinander angewiesen sind: Jelzin auf Lebed, um sich unbestritten als Mittelpunkt im Kreml zu halten; Lebed auf Jelzin, um Zugriff auf die Zugriffsmittel des Präsidenten zu bekommen. Wo formell die russische Staatsspitze residiert, reell die meisten noch vorhandenen Machtmittel im russischen Gewaltenpluralismus versammelt sind, da kommt nun zu allem sonstigen Erpressungs- und Beeinflussungswesen noch eine Konkurrenz an höchster Stelle hinzu: ein Kampf zwischen dem Präsidenten und seinem General um die Aneignung bzw. gegen die Enteignung der Macht, die jeder nur bei sich gut aufgehoben findet. Der Machtkampf, der im Zuge des Wahlkampfs angezettelt worden ist, ist nun im Kreml institutionalisiert.
Einstweilen sind folgende Etappen zu registrieren:
Als Bedingung seines Eintritts in Jelzins Mannschaft verlangt Lebed die Kontrolle der „Gewaltenministerien“. Dafür muß Jelzin „wichtige Mitarbeiter“ entlassen – Leute, von denen die gesamte Öffentlichkeit schon seit langem weiß, daß von ihrem berechnenden Wohlwollen die ganze Präsidentenherrlichkeit wesentlich abhängt: Verteidigungsminister Gratschow, der Jelzin schon bei seinem Putsch 1991 herausgehauen hatte; Korschakow, den persönlichen Leibwächter und Kommandeur der auf Jelzin eingeschworenen Präsidentengarde; den Chef des Inlandsgeheimdienstes und den für die Rüstungsindustrie zuständigen Vizepremier Soskowjez. Damit verliert Jelzin einen Teil der Garanten seiner Verfügung über die Instrumente der Staatsgewalt.
Lebeds erste Arbeit im Kreml besteht darin, seine eigene Position zu festigen und seine Leute an die Schaltstellen zu bringen. Er denunziert angebliche Putschversuche von Mitgliedern des Generalstabs; sechs Generäle müssen daraufhin gehen. Im Kampf um die Neubesetzung des Verteidigungsministeriums läßt er dem Kandidaten Jelzins Korruption und Bereicherung nachsagen und setzt schließlich seinen Mann durch. Das alles geht sehr schnell, vieles davon findet zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen statt, weil Lebed sich zu einer Macht im Kreml und unabsetzbar machen muß, solange Jelzin ihn und seine Wahlstimmen braucht, damit er sich seiner nicht entledigt, sobald er seinen Dienst erbracht hat.
Jelzin seinerseits behandelt sein „Geschäft“ mit Lebed sofort als das, was es ist, nämlich als Betrugsmanöver, und tut alles, um den Rivalen von all den Machtmitteln abzuschneiden, die er ihm konzedieren muß: Lebed bekommt nicht die Kontrolle über alle Gewaltenministerien – das Innenministerium und seine Truppen gehen ihn nichts an; der Versuch, seine Kompetenzen auf eine „wirtschaftliche Sicherheit des Landes“ auszudehnen, werden blockiert. Kaum ist Lebed zum Sekretär des bis dahin höchsten Gremiums in Gewaltfragen, des „Nationalen Sicherheitsrats“ ernannt, schafft der Präsident daneben einen „Nationalen Verteidigungsrat“, dem er selbst vorsitzt und der von da an allein berechtigt ist, Beschlüsse zu fassen. In ihm sitzt Lebed nun mit einfacher Stimme, sein Gremium hat nur mehr beratenden Charakter.
In allen diesen taktischen Winkelzügen zur Etablierung bzw. Abwehr einer Nebenmacht des Generals neben der des Präsidenten im Kreml geht es nicht zufällig um das Kommando über die Streitkräfte und Polizeitruppen im Lande. Immerhin wären das ja die Machtinstrumente, die, für einen solchen Zweck wirksam mobilisiert, dazu taugen könnten, die Machtworte der „Kremlgewaltigen“ zum durchgesetzten Staatswillen, die Moskauer Machthaber zur durchsetzungsfähigen Staatsspitze und die zerfallenden Überreste staatlicher Gewalt wieder zu so etwas wie einem Gewaltmonopol zu machen. Mit der Zielsetzung wird der Kampf ums Militär allerdings von keiner Seite geführt. Das zeigt sich besonders deutlich an dem ersten Fall, an dem der Präsident und sein General ihre Konkurrenz entscheidungsträchtig zuspitzen: am Gezerre um den Krieg in Tschetschenien, die erste offene Bürgerkriegsfront im kaputtreformierten Rußland.
Krieg und Friedensschluß in Grosnyj
Pünktlich zur Amtseinführung des wiedergewählten Präsidenten erobern die tschetschenischen Separatisten in einem überraschenden Angriff ihre von Russen besetzte Hauptstadt zurück. Sie bescheren der föderalen Armee Hunderte von Gefallenen und kesseln etwa 1000 ihrer Soldaten auf verschiedenen Posten in der Stadt ein. Daß die Erbin der Roten Armee, die einmal den USA samt NATO Paroli bot, über Jahre hinweg eines lokalen Aufstands nicht nur nicht Herr wird, sondern sich von Freiwilligenverbänden vorführen und um ihre letzten Erfolge bringen läßt, ist eine Katastrophe für dieses Militär und hat in mehrfacher Hinsicht die Bedeutung eines Offenbarungseids:
Der schnelle und leichte Sieg über die Armee der Großmacht macht erstens deutlich, wie umfassend der wirtschaftliche Ruin der Nation deren bewaffnete Macht beschädigt hat. Mag sein, daß Teile der Rüstungsproduktion sich noch am längsten erhalten: Daß da nicht alles nach dem kapitalistischen Rechnungswesen gehen darf, ist in Rußland zwar mit Sicherheit weniger bekannt als im kapitalistischen Westen; so, wie in Rußlands Reformwirtschaft die „Warenzirkulation“ funktioniert, steht die Truppe dennoch allemal noch besser da als sonstige Kundschaft. Oder doch nicht? Der Rückgang der Produktion und das Ausbleiben von Überschüssen hat im Laufe der Jahre jedenfalls auch die nötigsten Lieferungen versiegen lassen. Investitionsmittel bekommt das Militär längst nicht mehr; es verzehrt sein realsozialistisches Erbe, indem es veraltete Waffensysteme dadurch halbwegs funktionsfähig hält, daß die eine Hälfte der Panzer als Ersatzteillager für die andere herhalten muß. Es fehlen aber nicht nur Mittel für Investitionen sondern auch für den laufenden Betrieb: Der Nachschub funktioniert nicht, Sold wird nicht gezahlt, Soldaten hungern. Der Zustand demoralisiert die Truppe und führt dazu, daß sie abgesehen von ihrer technischen Kampfkraft auch moralisch nicht mehr als Instrument eines zentralen politischen Willens taugt. Die Waffenträger entdecken ihre Waffen als Lebensmittel; sie plündern und verramschen Geraubtes. Was die Soldaten im Kleinen betreiben, machen die Offiziere im großen Stil. Sie beschützen Geschäfte, an denen sie beteiligt werden, treiben Handel mit dem, was ihrer Verfügung untersteht, unter anderem mit den eigenen Waffen. Deshalb stehen sie im Laufe des Krieges einem immer besser gerüsteten Gegner gegenüber. Die technische Kommunikation zwischen den Truppenteilen ist so schlecht, daß Soldaten nicht selten einem „friendly fire“ zum Opfer fallen; von der politischen und strategischen Kooperation der Truppenteile ganz zu schweigen: Die Truppen des Innenministeriums, die schon durch ihre Herkunft den Standpunkt der inneren Polizeiaktion repräsentieren, bekommen andere Befehle und verfolgen andere Ziele als die Armee, mit der zusammen sie den Krieg führen müssen.
Das ist auch schon die zweite Seite der Katastrophenlage des russischen Streitkräftewesens, das der Tschetschenienkrieg drastisch offengelegt hat: Das, was bewaffnete Kräfte überhaupt zu einem Instrument staatlicher Gewalt macht, nämlich die intakte Hierarchie und eine von oben bis ganz unten durchgreifende Kommandogewalt, hat sich längst aufgelöst. Dieses Hauptmerkmal regulärer Streitkräfte, „bewaffneter Arm der Staatsmacht“ zu sein, ist im Prinzip bereits Jelzins einstigem kühnen Putsch gegen die „Putschisten“, seinem Zugriff auf die in der gegebenen Lage entscheidenden Truppenteile zum Opfer gefallen: Damit hat sich das Militär von seiner alten Staatsfunktion emanzipiert. Anstelle einer neuen hat es sich den Standpunkt einer bedingten Loyalität zum neuen „starken Mann“ zugelegt. Und nach diesem Kriterium der personenbezogenen Folgsamkeit oder Illoyalität hat es sich bis in die unteren Gliederungen hinein in ein Sammelsurium partikularer Verfügungs- und Kommandogewalten aufgelöst, deren Kooperation allenfalls noch fallweise, als Zufallsergebnis etlicher Rivalitäten auf verschiedenen Ebenen, herzustellen geht.
Der Gebrauch, den der Präsident nach seiner Machtergreifung und vor allem in Tschetschenien von den Streitkräften gemacht hat, ist die fortwirkende Ursache für diesen Zerfall: Er hat sie antreten und abtreten und erneut mal moderat, mal brutal zuschlagen lassen – wozu? Der Form nach schon für den Beweis russischer Hoheit über ein Stück Kaukasus. Dem Inhalt nach freilich für die Gleichung, nach der Jelzin die Moskauer Souveränität überhaupt buchstabiert, nämlich zur Untermauerung seines Anspruchs, mit seinen Kommandos die Staatsautorität zu verkörpern. Die Willkür wird damit zur Methode. Das Töten und Sterben wird angeordnet unter dem einzigen Gesichtspunkt: zu verhindern, daß die tschetschenischen Freischärler die äußerst begrenzte Reichweite der Präsidentenmacht offenbaren und damit Jelzins persönlichen Machtanspruch blamieren. Deswegen gibt es im Wahlkampf ein Waffenstillstandsabkommen nach dem Motto: ‚Alle Geschütze schweigen, wenn ich es will!‘ – deswegen gleich anschließend wieder Vernichtungsaufträge nach dem Motto: ‚Keiner überlebt, der sich mir widersetzt!‘ Daß ein verschworener Haufen fanatischer Kämpfer gegen ein so dirigiertes Militär gute Chancen hat – freilich auch das Risiko läuft, unversehens durch eine Superwaffe der ehemaligen Supermacht ausgelöscht zu werden –, versteht sich da ebenso von selbst wie die verheerende Wirkung aufs Militär: Wo die einzige „Staatsräson“, die die Truppe durchzukämpfen hat, in der Willkür des Präsidenten besteht, sind die Kommandeure aller Ebenen zur Eigenmächtigkeit herausgefordert.
Die Blamage, die der Präsident deswegen natürlich doch erlitten hat – nicht zuletzt eben weil er sie vermeiden wollte –, hat sein aufstrebender Konkurrent schon im Wahlkampf als seine Chance erkannt und ergriffen, mit seiner Person erfolgreicher als Jelzin dessen Gleichsetzung von persönlicher Autorität und hoheitlichem Kommando vorzuführen. Sein „Angebot“, die Sache in den Griff zu kriegen, zielt darauf ab, die Blamage des Präsidenten zu vollenden und ihm Kommandogewalt, zumindest über die Tschetschenien-Truppe, sowie Einfluß auf alle, die auf das Geschehen in der Region Einfluß haben, aus der Hand zu nehmen.
Der Präsident reagiert entsprechend und mit der gleichen Zielsetzung: Im Moment der Katastrophe schickt er seinen „Sonderbeauftragten“ nach Grosnyj. Lebed soll zeigen, was er kann, nachdem er im Wahlkampf behauptet hat, er könnte den Krieg beenden, den Rußland und sein Präsident nicht verloren geben wollen und den die Armee nicht gewinnen kann. Jetzt soll er die Prinzipien vereinbar machen, deren Unvereinbarkeit den Krieg verursacht und jeden Befriedungsversuch zum Scheitern verurteilt hat. Der Auftrag, an dem sich Lebed nach eigenem Bekunden „den Hals brechen soll“, hat etwas Absurdes: Jelzin desavouiert damit einerseits seine eigenen Befehlsstränge und -ränge – dem Oberbefehlshaber vor Ort und seinem Moskauer Vorgesetzten, dem Innenminister, entzieht er ihr eindeutiges Kommando über Truppen und Krieg; andererseits ersetzt er sie aber nicht, um etwa Lebed in ihre Positionen einzusetzen. Er bringt ihn als Dritten neben ihnen ins Spiel und schanzt ihm die Verantwortung zu, verweigert ihm aber die wirkliche Vollmacht, für die Nation zu entscheiden. So unternimmt nicht die Regierung einen neuen Versuch in dieser oder jener Richtung, sondern der Präsident überläßt es dem Rivalen, seinen Frieden zu stiften, seine Vereinbarungen auf seine Kappe zu nehmen – während sich die andere Abteilung der Macht davon distanziert und sich eine spätere Ablehnung vorbehält. Lebed wird ins Rennen geschickt, um zu zeigen, zu was für Vereinbarungen er die Tschetschenen bringen kann, ohne daß Jelzin und seine Mannschaft sich dadurch binden lassen: Wenn er scheitert, ist er gescheitert; wenn er ein vorzeigbares Ergebnis hinkriegt, bedarf dieses der Billigung durch Jelzin, und der weist es entweder zurück oder macht es per Zustimmung zu seinem Erfolg, je nach dem, welche Entscheidung ihm geeignet erscheint, seine Hoheit über Tschetschenien, den Krieg, das Militär und vor allem seinen über „Sondergesandten“ zu beweisen und Lebed wieder abzunehmen, was der sich an Macht genommen hat.
Denn der handelt mittlerweile seinerseits nach dem Motto: „Bei uns ist alles beim Alten, niemand hat jemandem Macht abgetreten. Man muß sie sich einfach nehmen, was ich jetzt auch langsam tue.“ Allerdings ist das Mittel seines Machtbeweises alles andere als machtvoll: Es besteht im Eingeständnis der Niederlage, die die tschetschenischen Freischärler den russischen Streitkräften beigebracht haben, und einem darauf gegründeten Waffenstillstand, zu dem er die russischen wie die tschetschenischen Befehlshaber auf der Ebene des Offizierskasinogesprächs gewinnen muß – was er immerhin schafft. Ihm fällt das Eingeständnis ja auch leicht, weil er eine Niederlage Jelzins „eingesteht“, also ein Stück Entmachtung des Präsidenten zustandebringt – ungeachtet dessen, daß er damit allerdings auch die Mittel beschädigt, auf die Jelzins Zugriff sich erstreckt hat, und damit die Zersetzung jener Überreste russischer Staatsgewalt vorantreibt, die er eigentlich unter sein Kommando bringen will. Denn sein vielgepriesenes Abkommen besiegelt mehr als eine Niederlage: Es bescheinigt der russischen Armee ihre Unfähigkeit, mit der Unterwerfung eines abwanderungswilligen Völkchens die elementare Bedingung staatlicher Souveränität, die formelle Verfügungsgewalt über Land und Leute, zu wahren; es erkennt ihr den Auftrag dazu regelrecht ab. Die Staatsmacht, die Lebed vertreten will und die er als Vertragspartner fingiert, distanziert sich von ihrem Instrument, nachdem dieses sich von seinem Staatsauftrag distanziert und den Auftrag des Präsidenten, für die Fiktion einer Staatsmacht unter Jelzin-Kommando zu sorgen, nicht erfüllt hat. Mehr noch: Die so heftig umkämpfte Frage, wem das Ländchen am Kaukasus samt lebendem Inventar eigentlich gehört, ist formell vertagt – und damit in der Sache entschieden: Der blutig aufrechterhaltene Anschein staatlicher Gewalt wird zurückgezogen; es ist zugestanden, daß die reale Gewalt bei denen liegt, die sie sich nehmen. So führt auch der neue Hoffnungsträger, ganz wie der alte, den Kampf um die Reichweite seiner Macht auf Kosten dessen, was noch von der alten Staatsmacht übrig ist.
Die Front, an der er diesen Kampf führt, liegt nicht in Tschetschenien, sondern im Kreml: Es geht um die Beseitigung der Figuren, die eher zu Jelzin als zu ihm halten; um die Absetzung all derer, die bis dahin Verantwortung für Krieg und Kriegsdiplomatie im Kaukasus getragen haben. Wesentlich für diesen Kampf ist wiederum der Schein, daß es ihm nicht um sich, sondern um Rußland geht – die Gleichsetzung seiner Person mit der russischen Macht will Lebed ja dem alten Präsidenten streitig und für sich wahr machen. Also kämpft der General – dafür findet er neben seinen Verhandlungen in Grosnyj allemal Zeit und Gelegenheit genug – um die Sprachregelung, wonach er mit seinem Abkommen keineswegs, wie seine Gegner es ihm nachsagen, einen Dolchstoß in den Rücken der aufopferungsvoll kämpfenden Truppe geführt, sondern eine nationale Schande größten Kalibers beendet hat: einen hochverräterischen Krieg aus Gewinnsucht und Eigennutz; Innenminister Kulikow vor allem sei der Hauptverantwortliche für das Blutvergießen und betreibe den Krieg als kommerzielles Projekt
.
Die Alternative „Kulikow oder ICH“ kann Lebed freilich noch nicht durchsetzen. Auch der Präsident hat seine Mittel und setzt dem Lebed-Frieden die Maxime „Rußland unteilbar!“ entgegen, ohne indessen seinem Rivalen gleich wegen Verzichtspolitik einen Hochverratsprozeß zu machen. Der Kampf geht also weiter – aber nicht einfach so. Die Strategie des Generals, beim Kampf um die Macht vor der Zerstörung der Machtmittel, über die sein Kontrahent noch verfügt, nicht zurückzuschrecken, spitzt die Gewaltfrage zu. Der Bürgerkrieg, der im Pluralismus der Partikulargewalten aus der dysfunktional gewordenen Erbmasse der alten Sowjetmacht längst angesagt ist, kommt mit der Alternative ‚Ich oder Lebed / Jelzin oder ich‘ ein gutes Stück voran.
Zum Grund des Ganzen
Eine gerade in Rußland lange Zeit für gültig erachtete Lebensweisheit will wissen: „Alle Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen.“ Lebed gegen Jelzin, tschetschenische Moslem-Nationalisten gegen russische Soldaten – ein Klassenkampf??
Aber andererseits: Was treiben sie denn eigentlich, die gesellschaftlichen Klassen in Rußland, während ihre gewalthabenden Führerfiguren auf einen Bürgerkrieg hinarbeiten? Vertragen sie sich? Gibt es sie überhaupt? Oder was sonst ist los, klassenmäßig, in einem Land, wo Bergleute für Lohn, den sie monatelang nicht erhalten haben, in einen Hungerstreik treten; aus dem andererseits eine elitäre Schickeria mit Koffern voller Dollarscheine nach Nizza oder Zypern reist und zweistellige Prozentsätze des offiziell errechneten russischen Bruttosozialprodukts verjuxt?
Sicher, die einen wie die andern sind keine Aktivisten eines Klassenkampfs. Sicher ist aber auch folgendes:
- Das gesellschaftliche Produzieren und Konsumieren von Zahlung und Profit abhängig zu machen und dann den Zahlungsverkehr samt seinen diversen kreditähnlichen Surrogaten lahmzulegen, weil eine profitträchtige Zirkulation nicht in Gang kommen will: das hat schon Klasse. Da sind Machtinstanzen am Werk, die noch im Zuge ihrer fortschreitenden Dissoziation und unbekümmert um alle verheerenden Wirkungen das Eine durchsetzen: die Herrschaft des Eigentums über den übriggebliebenen sozialistischen Reichtum und die damit noch bewerkstelligte nationale Produktion. Daß die Herrschaft der Rechnungen, die zur Mehrung des Eigentums angestellt werden, immer wieder einmal den Ruin sachlicher Reichtümer, die Stilllegung nützlicher Arbeit und die Einstellung von Lohnzahlungen nach sich zieht, das gibt es zwar auch anderswo. Aber die halbe Industrieproduktion einer Großmacht absterben lassen, bloß weil sie nach den Kriterien des kapitalistischen Eigentums nie und nimmer rentabel arbeitet: Das zeugt von Größe bei der Verfolgung eines einmal anerkannten Prinzips. Und aus dem Rahmen fallen auch die Großbetriebe nicht allzusehr, die, obwohl nach der ihnen aufgegebenen Rechnungsart längst pleite, dennoch aus völlig sachfremden Gründen – sogar humanitäre Motive, die Stadtheizung im sibirischen Winter betreffend, finden sich darunter! – das Produzieren nicht einstellen, also dem Diktat, echte Rubel oder gar nicht zu produzieren, Widerstand leisten und das sogar noch eine Zeitlang durchhalten: Den Übergang zu so etwas wie einer wenigstens notstandsmäßigen Planwirtschaft machen auch die Leitungen dieser Unternehmen nicht; deswegen geht das Weitermachen auch auf Kosten der Arbeiter, die auf ihren Lohn warten müssen, ohne auf die täglich benötigten und nur gegen Geld erhältlichen Lebensmittel so recht warten zu können. Auch die Verzögerungen beim Absterben der russischen Industrie und Landwirtschaft zeugen also davon, daß in diesem Land kein anderer ökonomischer Grundsatz befolgt wird als der kapitalistische, wonach entweder kapitalistisches Wachstum oder gar nicht produziert wird. Daß insgesamt die zweite Seite dieser Alternative weit mehr zum Zuge kommt als die erste, widerspricht diesem Grundsatz jedenfalls nicht, sondern beleuchtet dessen Totalitarismus sowie die Radikalität der Reformer: Für die Alleinherrschaft des Eigentums ruinieren sie sogar kaltschnäuzig alle Bedingungen, unter denen diese allenfalls kapitalistisch produktiv werden könnte.
- Für die Alleingültigkeit kapitalistischer Maximen und den Radikalismus ihrer Durchsetzung stehen nicht bloß die Figuren, Machtinstanzen, Betriebsleiter, „Seilschaften“ usw. in Rußland ein, die sich für den neugeschaffenen Beruf des Eigentümers oder für die Berufung zum marktwirtschaftlichen Reformer entschieden haben und alles daransetzen, jedes erreichbare Stück Gebrauchswert einem – ihrem – exklusiven Zugriff zu unterwerfen, um es zu Geld zu machen. Das kapitalistische Ausland – einzeln, kollektiv und in Gestalt supranationaler Kreditinstitutionen – fordert von den Russen gebieterisch kapitalistische Verhältnisse und fördert sie: durch Handelsgeschäfte, die russische Naturschätze sowie manches, was die altehrwürdigen realsozialistischen Produktionsmittel in ihrer Restlaufzeit noch an Verkäuflichem zustandebringen, in echtes, gutes Weltgeld verwandeln; durch Kredite, die den Anschein erwecken, sie sollten so etwas wie die Anschubfinanzierung eines innerrussischen Kapitalismus leisten, und die, wenn schon nicht dafür, so doch für die Ansammlung von viel abstraktem Reichtum in wenigen Händen, also für echtes Eigentum sorgen; schließlich durch sachdienliche Vorschriften an alle prominenten Agenturen in Rußland – Finanzministerium und Nationalbank in erster Linie –, die sich, soweit sie sich eben durchsetzen können, an der Herrschaft des kapitalistischen Rechnungswesens zu schaffen machen. Daß ihre Vorschrift Nr. 1: die gegebenen Kredite zu bedienen und auch im Innern Kreditbedienung als Sachzwang für Profitproduktion durchzusetzen, die nationalen Überlebensmittel ruiniert, ohne neue zu schaffen, verbuchen Rußlands Gläubiger als Übergangsproblem und ersten Erfolg – nach der Logik: Wenn nichts mehr läuft, dann läuft wenigstens nichts Geschäftswidriges; und das ist die erste, zwar nicht hinreichende, aber notwendige Bedingung dafür, daß – wenn überhaupt etwas, dann auf jeden Fall – lohnende Geschäfte in Gang kommen… Und noch einen, sogar entscheidenden Dienst leistet das kapitalistische Ausland dem neuen Rußland: Indem es Jelzins Macht Staatsqualität zuschreibt und den Mann kreditiert, fingiert es nicht bloß für sich und seine diplomatischen Bedürfnisse einen souveränen Ansprechpartner. Es stattet ihn auch mit den nötigsten Mitteln dafür aus, daß er die Fiktion einer nationalen Staatsmacht nach innen aufrechterhalten kann – jedenfalls soweit, daß sehr viele Partikulargewalten sich wenn schon nicht an die Fiktion, so doch an Jelzin halten. Zur produktiven Unterwerfung aller Russen unter die Staatsräson des kapitalistischen Geldverdienens langt das zwar nicht – daß Jelzin ohnehin andere Sorgen hat, wurde bereits ausgeführt –; aber es reicht, um hinauszuzögern, was längst fällig ist: den Zusammenbruch der Herrschaft, die ihre materielle Basis zerstört hat. So ist immerhin die Ersetzung der alten realsozialistischen „Nomenklatura“ durch die neue Klasse unproduktiver Eigentümer gelungen.
Die kapitalistische Internationale als Sponsor und Garantiemacht der Herrschaft des Eigentums in Rußland; eine Garde von Machthabern, die, in Kämpfe um die Aneignung von Machtmitteln verstrickt, den politischen und finanziellen Kredit des Auslands als ihr wichtigstes Machtmittel respektieren und dessen Vorgaben folgen; ein ansehnlicher Haufen von Russen, die es schaffen, von diesen Zuständen zu profitieren und echt reich zu werden: Dieses erlesene Bündnis hat zwar keinen Gegner, gegen den es klassenkämpfen müßte. Es übt aber allemal genügend Gewalt aus, um die einst realsozialistisch versorgten Werktätigen auch ohne Lohn und Arbeit zu Lohnarbeitern zu machen, die vom Eigentum abhängen, das sie nicht haben, und um die einstigen realsozialistischen Produktionsmittel teils zu verschleudern, teils verkommen zu lassen. Und das haben die Konterrevolutionäre der 20er Jahre und deren imperialistische Unterstützer mit einem ganzen Bürgerkrieg nicht geschafft.
Eine ganz andere Frage ist es, ob die einheimischen Reichen, die diversen Inhaber der auseinandergefallenen Staatsgewalt und die auswärtigen Gläubiger von der Art, in der sie sich Rußland zurechtmachen, einen dauerhaften kapitalistischen Nutzen haben. Die ist sicherlich mit einem klaren Nein zu beantworten – aber danach haben die nationalen und internationalen Kämpfer für das Recht des Eigentums auch schon im Krieg gegen Lenins bolschewistische Republik nicht gefragt.
- Um das Land zur kapitalistischen Reichtumsquelle zu machen, fehlt Rußlands neuen Eigentümern, Bankpräsidenten und Reformpolitikern das Entscheidende: ein nationales Geld, das zu verdienen sich lohnen würde. Bedarf und Produktionsmittel wären ja da, Eigentumsrechte an Unternehmen durchaus zu haben – aber weit und breit ist kein Geschäftsmittel in Sicht, in dem sich geschaffener Reichtum als kapitalistisches Eigentum festhalten und produktiv weiterverwenden ließe. Was da zirkuliert, als wäre er ein solches, „der Rubel“, hat mit einem funktionstüchtigen kapitalistischen Kreditzeichen nur eine sehr äußerliche Ähnlichkeit: Er repräsentiert keinen Wert, wie kapitalistische Währungen das, mehr oder weniger erfolgreich und dementsprechend (un)solide, immerhin tun. Ein real existierender negativer Zirkelschluß ist da komplett: Es gibt kein nationales Geschäftsleben mit flächendeckendem Zahlungsverkehr, das mit seinen sicheren Überschüssen den letztlich darauf bezogenen und davon abhängigen nationalen Kredit werthaltig, die darauf ausgegebenen staatlichen Banknoten zu brauchbaren Geldzeichen machen würde – der Rubel taugt in der Hinsicht nicht bloß von Tag zu Tag weniger, sondern nichts. Weil es also ein Geld, das Wert repräsentiert, nicht zu verdienen gibt, kommt ein nationales Geschäftsleben als Grundlage dafür erst gar nicht in Gang.
- Nicht als ob dieser Zirkel nicht aufzubrechen wäre: Seine Bürger zum exklusiven Gebrauch eines, nämlich seines „gesetzlichen Zahlungsmittels“ zwingen; definitiv keine gesellschaftliche Produktion und Warenzirkulation zulassen außer vermittels der gesetzlich vorgeschriebenen Wertzeichen; den Geldvergleich mit dem Ausland unterbinden, damit die nationale Währung sich mit ihrem Anspruch, Wert darzustellen, nicht blamiert, bevor ein in Gang gekommenes nationales Geschäftsleben ihn hinreichend erhärtet – natürlich vermag der bürgerliche Gewaltmonopolist so etwas. Für einen so guten Zweck geht er auch über die Opfer hinweg, die eine derart ursprüngliche Akkumulation mit der Brutalität, die dem Prinzip des Eigentums nun einmal innewohnt, unausweichlich schafft; dafür ist er ja Gewaltmonopolist. Dafür muß es einen solchen Staatswillen freilich geben; und zwar in so souveräner Verfassung, daß ihm bei der Unterwerfung seiner Gesellschaft unter sein Geld, unter die von ihm lizenzierte Privatmacht des Eigentums, niemand dazwischen funkt – ein klassenkämpferisches Proletariat schon gar nicht, aber auch kein auswärtiges Marktöffnungsgebot – und keiner aus dem Ruder läuft – auch kein um das Seine besorgter Eigentümer, der seiner heimischen Schutzmacht nicht so recht traut. Einen solchen Souverän gibt es in Rußland nicht; die Herrschaft, die es gibt, ist in der geschilderten Weise mit der Zersetzung der Mittel beschäftigt, mit denen sie sich allenfalls die Gewalt verschaffen könnte, die im Reich der kapitalistischen Freiheit nun einmal die erste Produktivkraft ist.
- Dieses Zersetzungswerk wird vom imperialistischen Ausland kreditiert – geschäftlich gesehen nicht gerade eine sichere Geldanlage. Deren politische Zweckbestimmung, den Garanten ruinöser Reformen in seiner relativen Machtposition zu erhalten und sogar mit dem Schein einer regelrechten Staatsmacht zu bekleiden, geht auf; allerdings so, daß der einst projektierte Aufbau eines nationalen Kapitalismus, der sichere Zinsen abwerfen und eine interessante Anlagesphäre abgeben könnte, darüber zur fast schon offen eingestandenen Illusion geworden ist. Mittlerweile bereitet sich die Gläubigerwelt auf die schwierige Operation vor, den im Herbst fälligen Offenbarungseid ihres russischen Schuldners so abzuwickeln, daß die eigenen Kredite keinen Schaden nehmen…
Einen schönen Kapitalismus hat sie sich da hingestellt in Rußland, die über die Sowjetmacht siegreiche Bourgeoisie. Die Alleinherrschaft des Eigentums entfaltet pur dessen Zerstörungskraft; zum funktionierenden Produktionsverhältnis bringt sie es nicht; das Eigentum hält sich mit der Plünderung der Hinterlassenschaft des abgeschafften Systems schadlos. Mangels Geschäftsgrundlage kommt ein bürgerliches Staatsleben auch nicht in Gang; die Machthaber im Land haben aber ohnehin anderes zu tun; sie sind damit beschäftigt, einander die Mittel einer unproduktiven Gewalt streitig zu machen, Grosnyj inklusive.
So einen Klassenkampf gab es mit Sicherheit noch nie. Ein neues Stück Geschichte also.
[1] Vgl. GegenStandpunkt 1/2-96, S.53: Wahlen in Rußland: Ermächtigung wozu?
[2] „Präsident Jelzin hatte im Wahlkampf die Auszahlung von seit Monaten fälligen Löhnen, Gehältern und Renten versprochen und dafür die erste Tranche des Kredits des Internationalen Währungsfonds über 10,2 Mrd. Dollar sowie Kredite der russischen Geschäftsbanken verwendet. … Die Kosten des Präsidentenwahlkampfes haben, das kommt als Problem hinzu, die Hälfte der Goldreserven des Landes verschlungen.“ (Jegorow lt. FAZ, 20.7.96)