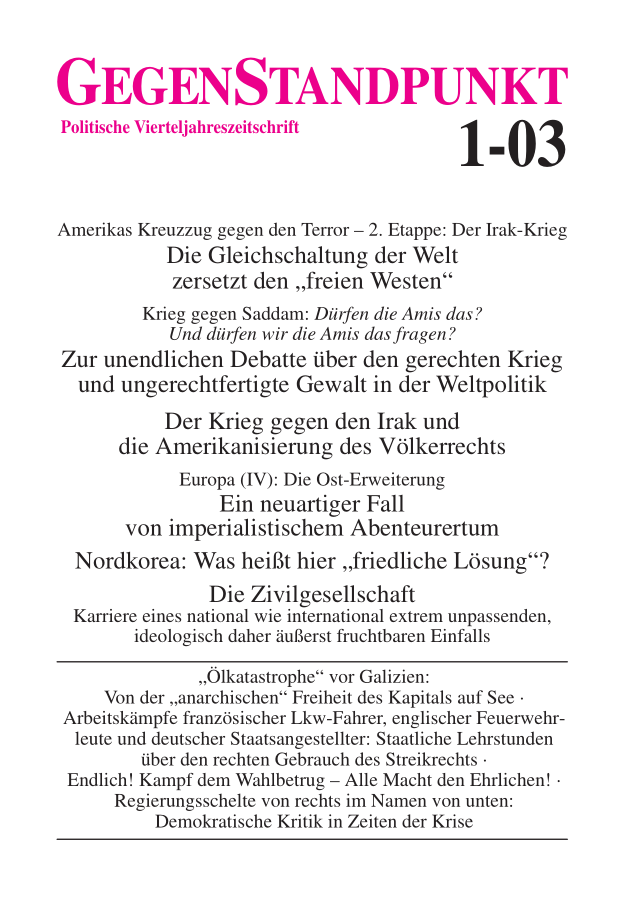Amerikas Kreuzzug gegen den Terror – 2. Etappe: Der Irak-Krieg
Die Gleichschaltung der Welt zersetzt den „freien Westen“
Seit der Erfahrung, dass auch gegen die übrig gebliebene Supermacht auf ihrem eigenen Territorium Attentate verübt werden können, haben die USA die Auffassung von ihrer Verwundbarkeit erheblich erweitert: Es gibt unerträgliche Nationen; solche, die in der Ausübung ihrer Souveränität und in der Verfolgung ihrer Interessen einfach gegen die Sache Amerikas stehen. Solche Staaten hält Amerika nicht länger aus; es verlangt eine Welt bedingungslos proamerikanischer Staaten.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Amerikas Kreuzzug gegen den Terror – 2. Etappe: Der Irak-Krieg
Die Gleichschaltung der Welt zersetzt den „freien Westen“
1.
Amerika will seinen Krieg; die Ziele des Truppenaufmarsches – „Entwaffnung“ und „Regimewechsel“ – lassen keine Zweifel zu. Seit der Erfahrung, dass auch gegen die übrig gebliebene Supermacht auf ihrem eigenen Territorium Attentate verübt werden können, hat sie die Auffassung von ihrer Verwundbarkeit erheblich erweitert: Es gibt unerträgliche Nationen; solche, die in der Ausübung ihrer Souveränität und in der Verfolgung ihrer Interessen einfach gegen die Sache Amerikas stehen. Solche Staaten hält Amerika nicht länger aus; es verlangt eine Welt bedingungslos proamerikanischer Staaten.
Von den Anschlägen des 11. September 2001 gibt sich die Weltmacht belehrt, zu haargenau dem nämlich, was Bush Junior schon vorher zu seinem Wahl- und Regierungsprogramm gemacht hatte: Seine große Nation muss Sicherheit endgültig grenzenlos definieren und ihre Kontrolle über den Globus komplettieren. Die Anschläge hat der Präsident zum Anlass genommen, den Monopolanspruch auf die Kontrolle der Staatenwelt als Sachzwang des amerikanischen Alltagslebens zu präsentieren. In seinem Versprechen, für Amerikaner im „homeland“ und in dessen weltweiten Dependancen wirkliche „Sicherheit“ zu erkämpfen, verknüpft er den Bedrohungswahn, dem seine Nation sich hingibt – sie sieht sich von ihren letzten offenen Feinden, weitgehend mittellosen fanatischen Geheimbünden in ihren Grundfesten erschüttert –, mit einem gar nicht ideologischen Klartext: Amerikanische Interessen sind überall bedroht, weil sie eben ubiquitär sind; Sicherheit für sie ist ohne die lückenlose Kontrolle des globalen Gewalthaushalts tatsächlich nicht zu haben. Dafür beansprucht die Weltmacht alle Staaten als Hilfstruppen und stellt sie vor die Gretchenfrage: Für oder wider mich? Souveräne, die ihre „vitalen Interessen“ nicht dem amerikanischen Säuberungs- und Kontrollbedürfnis unterordnen, stehen als geistige Wegbereiter, Herbergsväter und Ausrüster „des Terrors“ fest; gleichgültig ob sie tatsächlich mit dem frommen Terror der Islamisten sympathisieren oder nicht.[1]
Um beim Recht auf lückenlose Kontrolle über fremde Souveränität zu landen, hat sich der Standpunkt der Supermacht gar nicht ändern müssen; geändert haben sich nur die Umstände. Bis vor einem Jahrzehnt waren die USA mit einem Gegner konfrontiert, der sich dank einer beachtlichen eigenen Weltkriegsfähigkeit nicht kontrollieren und erpressen ließ, so dass sich die USA einerseits zu einem gewissen Arrangement mit und Respekt vor diesem abweichenden Staatswillen gezwungen sahen. Andererseits litt die Führungsnation der „freien Welt“ an dieser Beschränkung ihrer Macht schon damals so abgrundtief, dass sie ungeheure Teile ihres Nationalprodukts ausgab, um sogar für einen Atomkrieg gegen die andere Großmacht eine Siegstrategie herbei zu rüsten. „God’s own Country“ ließ an seiner Bereitschaft zum atomaren Weltkrieg keine Zweifel aufkommen, Kriege unterhalb dieser Schwelle führte es ohnehin genug; bis schließlich die sowjetischen „Militaristen“ kapitulierten. Heute fragt sich der Sieger des Kalten Krieges, warum er sich – ohne ebenbürtigen Gegner – überhaupt noch Eigenmächtigkeiten anderer Souveräne gefallen lassen soll. Und je empfindlicher er wird, desto unerträglicher werden ihm die paar Staaten, die wegen ihrer nationalen Ziele und Frontstellungen schon vor „9-11“ störten und als Feinde im Visier waren: Sie sind die ersten Zentren des Terrors, die Amerika nicht mehr aushält.
Der von Bush Vater vor 12 Jahren geschlagene, seitdem weitgehend entwaffnete und ausgehungerte Irak, der voll und ganz damit beschäftigt ist, als Staat zu überleben, hat sich die Rolle als zweites Objekt des Anti-Terrorkriegs genau dadurch verdient: Er hat Amerika seinerzeit zu einem Krieg herausgefordert und hat den überlebt. Dass er „die Lektion nicht gelernt“ und seine verbotene Staatsräson nicht aufgegeben hat, beweist den USA schon der Umstand, dass sich ihr personeller Träger, Saddam Hussein, trotz mehrerer Mordversuche, CIA-inszenierter Aufstände, trotz des ökonomischen Ruins durch das Embargo und bleibender Verstümmelung seiner Souveränität durch Flugverbotszonen und periodische Bombardements im Amt gehalten hat. Bush und seine Leute brauchen für diese Verurteilung gar nicht nachzuprüfen, ob Saddam Kuwait oder andere Nachbarn immer noch eingemeinden, die Araber immer noch vereinigen und Israel zerstören will – und ob er irgendetwas davon könnte, wenn er es denn wollte. Seine Gefährlichkeit ergibt sich nicht aus tatsächlichen Potenzen, sondern aus dem anspruchsvollen amerikanischen Maßstab: Saddam hat den Sieger des ersten amerikanisch-irakischen Krieges um den Regimewechsel, die bedingungslose Kapitulation betrogen – und ohne die sieht die Supermacht ihre Kriege nun einmal nicht erfolgreich abgeschlossen; an Siegen unter dem totalen leidet sie wie andere Staaten an Niederlagen – man erinnert sich an Vietnam und das diesem Krieg folgende „Trauma“. Wenn ein Regime mit der Bestrafung davonkommt, sie widerwillig und ohnmächtig über sich ergehen lässt, ohne die amerikanische Oberhoheit wirklich zu akzeptieren, erscheint das der Supermacht nicht nur wie eine Verhöhnung ihrer Macht und eine Ermunterung anderer Schurken zur Unbotmäßigkeit – unbeschadet dessen, dass der ruinierte und verarmte Irak sich nicht gerade zur Nachahmung empfiehlt –; es ist eine Beschädigung ihrer Autorität. Die stellt der Präsident wieder her, wenn er die Null-Toleranz, die er aller Welt ansagt, am Fall der unfertigen, also unerledigten Bestrafung demonstrativ vorführt.
Weil das Verbrechen des Irak gegen die Neue Weltordnung fest steht, sind die Verbrechen, deren man ihn bezichtigt, keine Frage: Man traut ihm einfach alles zu. Ob Saddam wirklich mit Usama Bin Ladin unter einer Decke steckt, ist gleichgültig gegenüber der amerikanischen Gewissheit, dass ihr Hass auf den gemeinsamen Feind und ihr Ehrgeiz sie zusammenführen muss. Ob der Irak noch irgendwelche Restbestände sogenannter Massenvernichtungswaffen hat, ist unwichtig angesichts dessen, dass das Land mit den definitiv meisten und wirkungsvollsten Massenvernichtungswaffen gut weiß, wie nötig ein ambitionierter Staat solche Dinger hat – schon gleich in der Nachbarschaft von Israel, das Amerika mit ihnen versorgt. Besonders gefährlich ist dieser Outlaw Bush’s Anklage zufolge dadurch, dass er „potentially rich“ ist, d.h. sich über sein Öl, wenn man es ihn denn wieder verkaufen ließe, Zugang zu Geld und allen Instrumenten staatlicher Macht eröffnen könnte. Jetzt schreitet Amerika zur Beseitigung der potentiellen Gefahr; eine Entwaffnung ist angesagt, die das Regime nicht noch einmal überlebt.
Dabei verheimlicht der Präsident nicht, dass Ziel und Nutzen des Feldzugs über den unmittelbaren Feind hinausgehen: Am irakischen Beispiel wird den USA klar, dass der gesamte Nahe Osten ein Fall mangelhafter Kontrolle ist. In einigen Staaten der Region bekämpft ein arabischer oder islamistischer Nationalismus die Herrschaft proamerikanischer Eliten, in anderen ist die Ablehnung Israels und seines großen Sponsors sogar Staatsprogramm. Und überall trifft die Unzuverlässigkeit der Staaten zusammen mit enormen Einkünften aus dem Erdöl-Export. Die Zentren des Weltkapitalismus alimentieren über den Preis des Rohstoffs sozusagen die finanziellen Potenzen zum Verkehrten. Damit die gefährlichen Geldzuflüsse nicht in die falschen Hände geraten und sich kein Falscher an den Petrodollars stärken kann, strebt Bush eine neue Kontrolle über die Machtverhältnisse in der Ölregion an; ihm genügt die bisherige Kombination aus Einbindung und Abschreckung im Nahen Osten nicht mehr. Einbindung wie Abschreckung lassen den Staaten der Region nach amerikanischem Geschmack zu viel Freiheit für die Entwicklung eigener Interessen und Mittel, die Amerika dann als Beschränkung verspürt. Daher geben sich die USA auch nicht mehr damit zufrieden, Israel mit Waffen und Geldmitteln den Rücken für seine ausgreifende Sicherheitspolitik zu stärken, mit der es seine islamische Umgebung in Schach hält. Bush will den Sturz Saddam Husseins und ein nachfolgendes Besatzungsregime als Hebel für die Umgestaltung des ganzen Nahen Ostens nutzen. Die „Problemstaaten“ und unsicheren Kantonisten dort brauchen noch manchen Regimewechsel, bis überall Souveräne sitzen, die ihre Macht und ihr Geld nicht erst aufgrund einer Bedrohung, sondern von vornherein im Sinn der amerikanischen Weltmacht verwenden.
So geht es in diesem Krieg durchaus um den schwarzen Stoff – allerdings etwas grundsätzlicher, als es der Vorwurf eines quasi kolonialen Rohstoff-Raubs haben will. Amerika perfektioniert seine Kontrolle über die Machtverhältnisse in der Ölregion: Erstens, um die dienende Rolle der Ölstaaten für die kapitalistische Welt zu sichern und antiamerikanischen Missbrauch der Petrodollars auszuschließen. Zweitens, um selbst als erstes die Hand auf dieses Grundnahrungsmittel des Weltkapitalismus zu legen und sich zum Garanten der globalen Energieversorgung zu machen; das heißt nämlich, Freund und Feind den Zugang zu dem unverzichtbaren Stoff gewähren oder verweigern und für beides die Bedingungen diktieren zu können.
2.
Mit der Entschlossenheit zum Angriff auf den Irak revidiert Amerika auch sein Verhältnis zur übrigen Staatenwelt und stellt klar, wie das mit der Neuen Weltordnung gemeint ist, die Bush Vater ausrief und Bush Sohn vollenden will: Washington kontrolliert den globalen Gewalthaushalt und führt Krieg, wann und gegen wen es das angebracht findet. Was immer andere Souveräne mit ihrer Staatsgewalt nach innen und außen anstellen, unterliegt einer amerikanischer Beurteilung und wird je nach Interessenslage gefördert, geduldet oder unterdrückt. Imperialistische Betroffenheit erzeugt diese Ansage bei Mächten, die das Zeug dazu haben, ähnlich zu kalkulieren wie die USA selbst; vor allem also bei den westlichen Partnern, die sich in der US-geführten Welt eingehaust, zu ökonomischen Riesen und imperialistischen Aufsteigern gemausert haben und daran arbeiten, sich von ihrer Führungsmacht nach und nach zu emanzipieren. Bush’s Lesart der „westlichen Wertegemeinschaft“ kommt einer Kündigung der Rolle gleich, die sie spielen, und einem Veto gegen die Rolle, die sie anstreben. Zugleich werden sie von der Vormacht neu in Anspruch genommen: als Vasallen nämlich, die mit ihren Potenzen für die Durchsetzung des amerikanischen Kommandos auf dem Globus gerade zu stehen und Hilfstruppen zu stellen haben.
Kein Zweifel, der amerikanische Kontroll- und Ordnungsbedarf wird in den Ländern, die einmal „der Westen“ hießen, verstanden. Den Bedarf kennt man da auch: In entfernten Regionen „Sicherheit“ und Stabilität stiften, aufpassen, dass andere Regierungen die Menschenrechte respektieren, und eingreifen, auch militärisch, wo sie es daran fehlen lassen, die Versorgung mit Öl und anderen Rohstoffen sowie deren Transportrouten sichern – das alles ist nicht nur amerikanische, sondern auch „unsere Sache“. Imperialistisches Kalkulieren ist den europäischen Partnern selbstverständlich, und ihrer öffentlichen Meinung ebenso; spätestens seit man sich mit der Phrase von der „Globalisierung“ daran gewöhnt hat, dass „uns“ kein Winkel der Erde gleichgültig sein kann, weil „unsere Interessen“ von Chaos, Krise und verkehrtem Regieren überall betroffen sind. Deswegen wird das amerikanische Programm globaler Ordnungsstiftung aber noch lange nicht gebilligt – im Gegenteil: „Wir“ Europäer haben eigene Vorstellungen davon, wo die Verkehrten regieren, wo der Fortschritt der Menschenrechte einen Krieg braucht und Völker von Tyrannen befreit werden müssen – auf dem Balkan etwa. Und eben auch davon, wo das weniger passend ist: Im Irak zum Beispiel. Die europäischen Mittelmächte fühlen sich von den Waffen des Irak nicht bedroht, wollen längst das amerikanisch-britische Sanktionsregime los werden und mit dem Irak wieder offiziell ins Geschäft kommen dürfen – inoffiziell läuft ohnehin eine Menge. Deutschland hat schon Mitte der neunziger Jahre auf unterer diplomatischer Ebene protestiert, Frankreich und Russland haben 1998 auf einen Abschlussbericht der Waffeninspekteure und ein Ende der Sanktionen gedrungen.
Jetzt verlangen die USA von den alten Partnern, sich von Waffen bedroht zu sehen, die nur Amerika stören, für ihren Feind zu halten, wen es nicht dulden will, und für dessen Bekämpfung ihre Soldaten zur Verfügung zu stellen. Amerika macht seine global definierte Sicherheit zur Aufgabe, der die Partner sich zu widmen haben, und verlangt dafür Opfer: Sie haben Feinde der USA aktiv zu isolieren und Wirtschaftsbeziehungen mit ihnen abzubrechen, also auf Geschäfte und eigenen imperialistischen Einfluss zu verzichten. Die Beschädigung nationaler Reichtumsquellen bleibt nicht auf solche beschränkt, die mit dem ins Visier genommenen Feind zusammenhängen. Mit dem Krieg mitten in einer Weltwirtschaftskrise zerstört die Weltmacht Geschäftsbedingungen in einem noch gar nicht abschätzbaren Umfang und mutet den Partnern und Konkurrenten zu, diese Beschädigung ihrer Wirtschaftskraft zu ertragen. Sie haben ihr ökonomisches Konkurrieren dem Sicherheitsbedürfnis der Vormacht unterzuordnen. Und das nicht nur dadurch, dass sie bereitwillig Verluste hinnehmen.
Vielmehr haben sie sich ihren Zugriff auf auswärtige Reichtumsquellen durch aktive Vasallendienste an der amerikanischen Vorherrschaft erst noch zu verdienen. Darauf weist Bush sie ausdrücklich hin, wenn er droht, Staaten, die beim Angriff auf den Irak nicht mitmachen, von der späteren Verteilung der Öl-Konzessionen auszuschließen. Der Präsident erinnert hier an eine imperialistische Wahrheit, die fast in Vergessenheit geraten ist: Auch das Maß an Freiheit, das Nationen sich zu ihrer wechselseitigen Benutzung sowie der Benutzung des Rests der Welt abpressen und einräumen, ist ein Resultat der strategischen Über- und Unterordnungsverhältnisse zwischen den kapitalistischen Mächten. Amerika ordnet die Konkurrenz auf dem Weltmarkt und definiert entscheidend ihre Regeln. Dass Konkurrenznationen auf dieser Basis ihren ökonomischen Vorteil suchen dürfen, haben sie als eine Konzession zu verstehen, die nicht selbstverständlich ist, sondern immer wieder erworben werden muss – durch Leistungen bei der Festigung der Über- und Unterordnung.
Für solche Leistungen können sich die Amerikaner noch einen Nutzen des überkommenen antisowjetischen Kriegsbündnisses vorstellen: Sie verlangen die Umgestaltung des nordatlantischen Verteidigungspaktes in ein Instrument ihres globalen Interventionismus. Unabhängig von einem offiziellen Beschluss dieses Funktionswechsels nehmen sie die Nato-Infrastruktur, die Basen bei den Verbündeten, deren Luft- und Verkehrswege für ihren Irakkrieg in Anspruch und bugsieren das unwillige Bündnis durch den Krieg selbst in die Rolle eines halben Mitmachers: Unter der unglaubwürdigen Sprachregelung, der Türkei drohe nach einem Angriff irakische Vergeltung, gegen die das Bündnis zum Beistand verpflichtet sei, werden die Neinsager aus Europa in die Pflicht genommen.
Natürlich stand dieses Bündnis auch früher unter amerikanischer Führung, und die Führungsmacht hat es schon immer als Instrument ihres globalen Kriegsmonopols verstanden; aber erstens hatten die Partner angesichts ihrer Konfrontation mit dem sowjetischen Systemfeind ein eigenes Interesse an Unterordnung unter den großen Bruder und zogen einen eigenen imperialistischen Nutzen aus dem amerikanischen „Atomschirm“, so nannte man die gegen Osteuropa gerichtete Drohung mit dem atomaren Weltkrieg. Zweitens haben nicht nur die kapitalistischen Staaten Europas das Bündnis mit der Weltmacht gebraucht. Diese war umgekehrt auch auf Bastionen an der „strategischen Gegenküste“ angewiesen und hat deshalb auf Interessen der europäischen Partner Rücksicht genommen. Jetzt verlangen die USA die Bündnistreue ihrer Partner für einen Krieg, an dem kein europäisches Interesse zu sehen ist, während sie sich selbst demonstrativ freimachen von jeder Verpflichtung auf diese: Sie binden sich nicht mehr an die Abstimmungsprozeduren und Konsenszwänge der Nato, wollen keinen Bündniskrieg – „war by committee“ nennen sie das – führen, sondern schmieden eine „Koalition der Willigen“ nach ihrem Bedarf und so, dass keinem der Mitmacher eine Gelegenheit zur Mitbestimmung über Ziel und Mittel der Kriegführung zuwächst.
Entsprechend sehen sich die Vereinigten Staaten auch in der Position, der UNO die Rolle zuzuweisen, die sie ihr eigentlich immer schon zugedacht haben: die eines Gremiums, das ihre Herrschaft über die Staatenwelt zum kollektiv gebilligten Rechtszustand und damit zur anerkannten Weltordnung erhebt. Allerdings mussten die USA früher diese Aufsicht über die Souveräne des Globus mit den vier anderen Vetomächten des UN-Sicherheitsrats teilen – gegen deren Interessen konnte ein „gerechter Krieg“ nicht beschlossen werden. Heute stehen sie auf dem Standpunkt, dass auch der Respekt vor den Mit-Siegern des Zweiten Weltkriegs eine zeitweilig nötige Konzession war, der Selbstbehauptung des russischen und chinesischen Feindes sowie der daraus erwachsenen Angewiesenheit auf Verbündete wegen. Zu Kompromissen waren sie schon während des Kalten Krieges nicht bereit, so dass die UNO immerzu blockiert war; heute lehnen sie Kompromisse erst recht ab. Aber die UNO könnte endlich „handlungsfähig“ werden, dann nämlich, wenn sich ihre wichtigen Mitgliedsländer ohne Einspruch, Korrektur und Mitsprache zu einer klaren Billigung und Unterstützung amerikanischer Waffengänge verstehen. Wenn die UNO dazu nicht taugt, hat sie ihre weltpolitische Berechtigung verloren.
Diese Botschaft übermittelt schon der Stil des amerikanischen Auftretens in New York: Präsident Bush wendet sich nicht an den Sicherheitsrat, um eine Erlaubnis für seinen Krieg zu beantragen; vielmehr nimmt er den Rat in die Pflicht und droht, dessen Beschlüsse nur zu respektieren, wenn sie in seinem Sinn ausfallen. Es ist nicht Amerika, das die Legitimation durch die UNO braucht, sondern umgekehrt: Die UNO kann fortexistieren, wenn sie sich die Legitimation durch Amerika verdient. Nicht ohne Ironie erinnert Bush die versammelten Großmächte daran, dass ihre Resolutionen nur so viel wert sind – und damit ihr Gewicht in der Weltpolitik nur so groß ist –, wie kriegerischer Wille und Potenz der USA zu ihrer Durchsetzung dahinterstehen. Sofern ihnen am Respekt vor ihrem Wort gelegen ist, sollten sie also so klug sein, nur Resolutionen zu beschließen, wie sie die USA von sich aus und auch ohne UN-Beschluss vollstrecken. Im Namen des Respekts vor der Autorität der Vereinten Nationen verlangt der Präsident deren unbedingte Unterordnung unter amerikanisches Diktat. So oder so haben die alten Veto-Mächte ihre Deklassierung zu unterschreiben; ihr Ja wird ebenso wie ihr folgenloses Nein dokumentieren, dass sie der Supermacht nicht hineinreden können.
3.
Eine solche Rollenzuweisung fordert die Reaktion anderer imperialistischer Staaten heraus. Die europäischen Mittelmächte und andere haben nicht vor, die Errichtung einer amerikanischen Ordnung hinzunehmen, die ihren Ambitionen keinen Raum lässt. Sie stellen sich der Herausforderung und suchen eine Fassung für ihre Ablehnung – freilich eingedenk des Kalibers, mit dem sie sich anlegen. Sie antworten dem US-Interesse nicht mit einem entgegengesetzten eigenen Interesse und schon gleich nicht mit Gegenmaßnahmen, sondern verlegen sich auf einen Streit um die Legitimität des geplanten Krieges. Wo die Amerikaner die Gemeinsamkeit des „Westens“ kündigen bzw. als eindeutiges Vasallenverhältnis neu definieren, halten die Degradierten zugleich vorsichtig und hartnäckig am Standpunkt einer gemeinsamen Rechtsfindung in Kriegsfragen fest und verweigern die Anerkennung des US-Angriffs als „gerechten Krieg“.
Die Mitglieder der Anti-Fraktion im UN-Sicherheitsrat missverstehen gezielt die amerikanischen Forderung nach ihrem Ja zum Krieg und lesen sie umgekehrt: Ihr Ja ist gefragt, Bush ist zu ihnen gekommen und anerkennt soweit ihre Mit-Zuständigkeit für Krieg und Frieden. Also ist es auch ihr Recht, seinen Präventivkrieg völkerrechtlich zu würdigen. Während die USA nichts als Gefolgschaft dulden wollen, nehmen die angesprochenen Nationen ihre Zuflucht bei den überkommenen UN-Bräuchen, tun so, als sei ihr Gremium eingeladen zu entscheiden, und verweigern den Amerikanern dadurch den Übergang, den sie verlangen.
Sie nehmen die amerikanischen Unwert-Urteile über den Verbrecher von Bagdad – er verhöhnt UN-Resolutionen und verweigert die darin beschlossene Abrüstung – als quasi juristische Anklagen, deren Stichhaltigkeit zu prüfen sie sich vorbehalten. Dabei tun die Sicherheitsratsmitglieder allen Ernstes so, als ginge es darum, dass die Weltgemeinschaft zu einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse findet, Grad und Dringlichkeit der Gefahr bestimmt, die ihr vom Irak droht, und der ermittelten Bedrohung entsprechende Gegenmaßnahmen zum „Schutz des Weltfriedens“ ergreift. Mit dieser Fiktion schaffen sich die beiden Seiten ein gemeinsames Interesse – die Vollendung der von den Vereinten Nationen vor Jahren verordneten Abrüstung des Irak von Massenvernichtungswaffen –; ein Interesse, das keine Seite wirklich hat, das aber dazu taugt, die jeweils andere auf Lösungen und Konsequenzen zu verpflichten, die die nicht mag. Die Amerikaner wollen das Regime beseitigen und nicht ein paar Waffen verschrotten, die ihm eventuell geblieben sind. Ihre Opponenten fingieren als gleichwertige und dabei friedliche Alternative zum Regimewechsel eine groß angelegte gemeinsame Verschrottungsaktion. Sie stören sich ohnehin nicht an irakischen Waffen und haben sich das ganze Problem nur durch den kompromisslosen amerikanischen Kriegswillen aufdrängen lassen. Im Interesse der Konstruktion eines gemeinsamen Anliegens unterschreiben sie ein Recht der USA auf einen wehrlosen Irak und akzeptieren, dass Massenvernichtungswaffen in seinen Händen ein Unrecht wäre, um auf diesem Boden der Gemeinsamkeit dem amerikanischen Kriegswillen in den Arm zu fallen. Sie halten sich – diplomatisch verlogen – an die völkerrechtliche Legitimation, die die USA für ihren Feldzug anbieten, anerkennen diese, jedoch nicht das wahre Kriegsziel, und bieten den USA einen besseren Weg zu einem Ziel an, das die gar nicht verfolgen.
Die amerika-kritische Fraktion des Sicherheitsrates funktioniert die von Bush angebotenen Völkerrechts-Titel um und wendet sie gegen ihren Erfinder. Der hat den Veto- und anderen Mächten Legitimationen angeboten als eine Brücke, über die sie ihm nachlaufen und dabei den Schein wahren können, sie seien einem eigenen Urteil gefolgt. Sie sollten keine Zicken machen beim Ja-Sagen, und sich dafür den Schein amerikanischen Respekts vor der Zuständigkeit des Sicherheitsrates in Kriegsdingen und den Schein des Werts ihrer Stimme einhandeln. Sie nehmen ihre Gesichtswahrung jedoch ernster und versuchen, die USA auf eine „friedliche Entwaffnung des Irak“ festzulegen.
Das handeln sie den USA in der vielzitierte Resolution 1441 erstens als das offizielle Ziel der Weltgemeinschaft ab und setzen zweitens durch, dass die amerikanischen Anklagen durch eine neue Runde von Waffeninspektionen international verifiziert werden sollen. Dafür drohen auch sie dem Irak für den Fall von Widersetzlichkeit bei seiner Durchsuchung „ernste Konsequenzen“ an. Die Formulierung ist gerade weit genug von einer klaren Kriegsdrohung entfernt, dass die Mehrheit im Sicherheitsrat darin einen Einstieg in ein neues Inspektions- und Sanktionsregime sehen und darauf bestehen kann, keinen Freibrief zum Schießen, „keinen Automatismus“ unterschrieben zu haben. Sie ist zugleich nahe genug an einer Kriegsdrohung, dass die USA behaupten können, vom Sicherheitsrat keine Fesseln angelegt bekommen zu haben, vielmehr mit dieser Formulierung schon hinreichende Zustimmung eingesammelt, eine ausdrückliche Ermächtigung zum Krieg nicht mehr nötig zu haben.
Folgerichtig leisten die Inspektorenteams für die USA und ihre Kontrahenten Entgegengesetztes – und bieten damit ein weiteres Feld rein fiktiver Gemeinsamkeit. Die USA sind entschlossen, mit Hilfe der Inspektoren die Beweise für irakische Lügen und Täuschungen zu liefern, notfalls zu fabrizieren, denen die anderen ihre Zustimmung nicht verweigern können. Deshalb bestehen sie auf einer entsprechenden Abfassung des Inspektionsauftrags: Der Irak muss beweisen, dass er Waffen nicht hat, derer man ihn verdächtigt – das kann nicht gelingen; dafür muss er vorweg deklarieren, was er hat und an welchen militärischen Programmen er arbeiten lässt. Finden die Inspektoren irgendetwas nicht Deklariertes, ist der Schurke überführt. Finden sie nichts, beweist das die kriminelle Energie, die Saddam aufs Verstecken dessen verwendet, was nicht gefunden wird. Schließlich handeln die USA den Umstand, dass nichts gefunden wird, als unmittelbaren Beweis für die mangelnde Kooperation der irakischen Behörden; andernfalls müsste ja wohl jede Menge Verbotenes gefunden werden. Die andere Fraktion im Sicherheitsrat benutzt die Inspektoren als Institutionen des Misstrauens gegen Bush. Finden diese nichts, ist der Irak auch nicht überführt. Dann muss weiter gesucht, muss Hans Blix und den Seinen so viel Zeit eingeräumt werden, wie sie brauchen – möglichst mehr, als mit einem Wüstenkrieg bei angenehmen Außentemperaturen vereinbar ist. Überhaupt versteht diese Fraktion das Inspektionsregime, das für Amerika Kriegsgründe und sonst nichts liefern soll, als alternative Methode der geforderten Abrüstung, mit der man die „Gefahr, die vom Irak ausgeht“, Schritt für Schritt auf Null bringen kann. Den Aufmarsch von 200.000 Soldaten würdigt sie als hilfreiche Drohkulisse für ihren Weg der Krisenbewältigung – als ob die dafür angetreten wären! Sollten die Inspektoren nämlich tatsächlich verbotene Waffen finden, wären sie unter diesem „Druck“ leicht zu vernichten; mehr Gewalt wäre höchstens gerechtfertigt, wenn die internationale Gemeinschaft zu dem Schluss kommen sollte, dass der Irak dabei Schwierigkeiten macht.
Die UN-Kontrollen, die sich die Kontrahenten als objektive Prüfinstanz geschaffen haben, mit deren Hilfe die jeweils andere Seite verpflichtet und gebunden werden soll, sind somit die zu diesem Ringen passenden diplomatischen Machenschaften. Es kommt furchtbar darauf an, dass Saddam den Inspekteuren alle Türen öffnet, und er wird von allen Seiten immer dringlicher dazu aufgefordert, immer unbedingter zu kooperieren. Zugleich hängt davon gar nichts ab, denn die fabrizierten oder echten Beweise beziehen ihr Gewicht dann eben doch aus der Beweiswürdigung, die sich die Weltmächte im Rat vorbehalten.
Alle Stellungnahmen zum Thema sind Verstellung. Die Vertreter aller Staaten, die mitreden wollen, äußern ihren Abscheu vor Saddam Hussein; heißen ihn einen schlimmen Tyrannen und eine Gefahr für die Menschheit, weil das eben die Basis diplomatischer Gemeinsamkeit ist, auf die sich stellen muss, wer dem amerikanischen Kriegswillen auf der Ebene der Legitimation entgegentreten will. Die Mitglieder des Sicherheitsrates vertreten Auffassungen vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Massenvernichtungswaffen – und bekennen sich damit in Wahrheit doch nur zu dem Verhältnis, das sie zur Supermacht beanspruchen, sich herausnehmen oder eben nicht. An den „Erfolg und Nutzen der Inspektionen“ und die „Möglichkeit einer friedlichen Abrüstung des Irak“ glaubt, wer sich noch ein weiteres Stück Eskalation in der Konfrontation mit Washington zutraut. Von Powells „Beweisen“ vor dem Sicherheitsrat zeigen sich Regierungen „beeindruckt und beunruhigt“, die die Gelegenheit ergreifen wollen, Einverständnis mit den USA zu bekunden oder bisherige Einsprüche zurückzuziehen – nicht etwa, weil sie von Powell Neues und Besseres als die alten Beschuldigungen zu hören bekommen hätten, sondern weil sie seinem Auftritt die amerikanische Entschlossenheit zum Krieg entnehmen – und dann auf der richtigen Seite stehen wollen.
Wie jede Heuchelei enthält auch die diplomatische eine ehrliche Botschaft: Wer um die Gerechtfertigtheit des geplanten Krieges rechtet, ihn als ultima ratio in Erwägung zieht, um ihn abzulehnen, solange nicht alle „friedlichen Mittel“ ausgeschöpft sind, wer eine gemeinsame völkerrechtliche Problemdefinition zu erreichen sucht, um dem amerikanischen Kontrahenten das Recht auf seine Konsequenz streitig zu machen, signalisiert bei allem Gegensatz, dass er den Boden der Kooperation in imperialistischen Weltordnungsfragen nicht verlassen, dass er vielmehr der amerikanischen Seite Kooperationsbereitschaft abringen will. Sie soll den alten Partnern Mitsprache bei der Auswahl ihrer Feinde, den Mitteln ihrer Bekämpfung und den Zielen der nachfolgenden Neuordnung einräumen. Dafür wäre man zu einiger Unterordnung beim Mitmachen bereit.
Eine andere Bedeutung messen die Nationen, die mit einem Veto im Sicherheitsrat drohen, wohl auch diesem Schritt nicht bei. Den amerikanischen Auskünften, wer im Fall einer Entzweiung des hohen Gremiums der Blamierte sei – die „Völkergemeinschaft“ oder die Vereinigten Staaten –, haben sie längst entnommen, dass Amerika sich eine Legitimation zwar beschaffen will, aber keineswegs braucht. Insofern verlegen sie sich mit ihren Andeutungen eines Nein auf das matte Ziel, eine Gelegenheit zur Zustimmung auf Basis einer für sie akzeptableren Resolution eingeräumt zu bekommen.
Die europäische Verweigerungsfront ergänzt ihren hinhaltenden Widerstand im Sicherheitsrat denn auch um eher werbende Argumente. Ihre Mitglieder werden nicht müde, die USA vor Gefahren und kontraproduktiven Wirkungen ihres Waffengangs zu warnen. Sie kommen ihnen damit, dass der Krieg den ganzen Nahen Osten „zur Explosion bringen“, einen unbeherrschbaren Anti-Amerikanismus in der Region sowie neue Terroranschläge gegen „den Westen“ auslösen könnte und dabei im Irak nichts „lösen“ würde; der nämlich müsste, wenn er nach einem Krieg sowohl stabil wie berechenbar gemacht werden sollte, jahrzehntelang besetzt und umerzogen werden. – Ist Bush’s Amerika etwa dazu bereit? Derartige Warnungen, die sich scheinbar auf denselben Ordnungsstandpunkt wie die USA stellen, um ihnen ihren Krieg madig zu machen, sind lächerlich. Bush will den Nahen Osten ja umkrempeln, ihm ist der kaputte Irak immer noch zu stabil. Neue Terroranschläge nach seinem Angriff erwartet er selbst – und das ist ein Grund mehr für ihn, im arabisch-islamischen Raum alles auszuräuchern. Dass dortige Kämpfer sich zu Anschlägen herausgefordert fühlen, wundert den Präsidenten nicht, dass es sie immer noch gibt und geben kann, ist in seinen Augen der Skandal, den er aus der Welt schaffen will. Lächerlich ist ferner die Sorge, das amerikanische Beispiel des Präventivkriegs könnte Schule machen und andere Nationen könnten sich Gleiches herausnehmen – als ob es zum vorsorglichen Überfall auf andere Länder nicht ein bisschen mehr bräuchte als die Erosion des offenbar veralteten Aggressionsverbotes der UNO. Wenn Europäer schließlich mit der Sorge herausrücken, im Kriegsfall könnte die „Koalition gegen den Terror“ zerbrechen, dann verfängt zwar auch das bei den Amerikanern nicht, sie verstehen aber: Warnungen vor dem Antiamerikanismus anderer Völker und Religionen sind eine vorsichtige Drohung mit dem eigenen. Wer sollte der Koalition gegen den Terror schon gewichtige Beiträge entziehen können, wenn nicht die nach den USA nächst-mächtigen Nationen?
4.
In Form eines Theaters, das Kooperation beschwört, um sie einzuklagen, nehmen die Neinsager im UN-Sicherheitsrat dann doch eine Konfrontation mit den USA auf. Der transatlantische Partner meint es nämlich ernst mit der Erneuerung und Vollendung seiner Führung auch gegenüber konkurrierenden Mit-Imperialisten. Die sehen sich gedrängt, ihren Status zu verteidigen und ihrerseits prinzipiell zu werden. Sie wissen, dass mit dem, was Amerika jetzt durchsetzt, und ihren Reaktionen Weichen gestellt werden dafür, wie die Supermacht künftig mit ihnen umspringt. Sie fragen sich, wie sie in der neuen amerikanischen Weltordnung noch vorkommen, und was ihre Interessen noch zählen. Sie haben abzuschätzen, was passiert, wenn sie dem Konflikt aus dem Weg gehen und sich gar nicht erst aufstellen, müssen aber auch prüfen, ob sie sich eine Absage an die USA leisten können und wie sie den Bruch, den sie damit riskieren, aushalten. Der negative Ausgangspunkt aller Kalkulationen – durch welche Haltung verliert die eigene Nation am wenigsten, wenn sie schon nichts gewinnen kann – stürzt die alten und neuen Partner Amerikas in peinliche Alternativen, spaltet jede Nation im Inneren und die Verbündeten untereinander. Unter ihnen hebt ein Kampf darum an, wer sich für seine Position wie viel Gefolgschaft sichern, wer wen isolieren kann – kurz: Wie es in aller Abstraktheit um die imperialistischen Kräfteverhältnisse bestellt ist. Der Irak und die Bezugnahmen auf ihn sind nur noch Chiffren für das, was man Amerika und im Gefolge davon einander abfordert oder einräumt.
Die ultimative Forderung, die alten und neuen Alliierten sollten sich gefälligst dem Bedürfnis Amerikas nach Komplettierung seiner Kontrolle über die Staatenwelt unterordnen und ihre Potenzen dafür zur Verfügung stellen, richtet sich an Partner, die auch Partner bleiben wollen – allerdings solche, auf die die Vormacht hört, und die ihre nationalen Ambitionen auf Mitwirkung bei der Kontrolle der Staatenwelt in deren Programm ein- und unterbringen können. Das genau aber ist es, was die USA deutlicher denn je ablehnen. Ihre Forderung nach Unterordnung enthält kein Angebot mehr, stattdessen Drohungen: Wer sich ihrem Antrag verweigert, wird nicht nur übergangen, sondern klein gemacht. Die Neinsager vergleicht US-Außenminister Powell mit dem alten Ärgernis de Gaulle und bezichtigt sie wie diesen der Sabotage, der gezielten Beschädigung der Weltmacht sowie der Kumpanei mit Saddam Hussein. Sie sollen von der ökonomischen Nutzung des Nahen Osten und darüber hinaus von weltpolitischen Entscheidungen ausgeschlossen werden. Präsidentenberater Perle sieht vor, Deutschland „irrelevant“ zu machen.
Alle betroffenen Mittelmächte finden es nötig, die USA auf diesem Weg zu stoppen und sie, wie es heißt, auf den „Pfad des Multilateralismus“ zurückzuholen. Mitmacher und Rebellen kämpfen um die Anerkennung ihres Status als zur Mitsprache berechtigte Partner. Dafür bringen sie ihre Dienste in Anschlag. Sie erinnern den transatlantischen Partner an einen Nutzen, den sie ihm stiften, – und das in einer Lage, in der ihm dieser Nutzen keinen Preis mehr wert ist. Bei dem schwierigen Unternehmen heißt es abwägen zwischen dem rechten Maß an Kooperationsbereitschaft, die Amerika verpflichten, und dem nötigen Maß an Verweigerung, die es den Wert der Kooperation lehren soll. Die heikle Abwägung führt die Partner der USA auf entgegengesetzte Wege ihrer Selbstbehauptung.
Auch die Briten, die so heftig für den Krieg trommeln und jeder amerikanischen Scharfmacherei sekundieren, sind vom Kurs der US-Regierung betroffen und wehren sich gegen die imperialistische Degradierung. Blair begründet seine Stellung zum Irak damit, dass das Verhältnis zu Washington existentiell sei für Großbritannien und seine Rolle in der Welt: Nicht wegen britischer Interessen am Irak macht er gemeinsame Sache mit den Amerikanern; sondern umgekehrt: Wegen des „special relationship“ macht er den Sturz Saddams zu einem britischen Interesse. Dabei ist Blair bestrebt, Bush in die Prozeduren der „Weltgemeinschaft“ einzubinden, ihn am Alleingang zu hindern und auf „Rechtssetzungen“ des Sicherheitsrats festzulegen, von denen der sich keinesfalls mehr „fesseln“ lassen möchte. Das Mittel, britischen Anliegen Gehör zu verschaffen, ist unbedingte britische Treue zu dem Partner, der keine Partner mehr aushält – also kein übermäßiges Druckmittel. Daheim, sogar aus seiner eigenen Partei bekommt Blair für seine Treue den Vorwurf zu hören, er sei „Bush’s Pudel“ – ein Vasall, dessen eifrige Gefolgschaft ohne Gegenleistung bleibt, der britischen Nation also nichts nützt. Der Premier jedenfalls versucht aus dieser Lage für das imperialistische Gewicht seines Landes das Beste zu machen: Mit dem Argument, Europa könne durch eine Konfrontation mit der Supermacht nur verlieren, fordert er in der EU Gefolgschaft erstens für die amerikanische Führungsmacht und zweitens für sich als Mittler, der diese immerhin noch zu einem formellen Supranationalismus bewegen kann, wenn sie sich der Sache nach davon verabschiedet. Mit dem Gewicht der amerikanischen Drohung im Rücken sucht Blair England zur weltpolitischen Führungsrolle in der EU zu verhelfen, und zugleich Bush den Wert eines Partners vor Augen führen, „who delivers Europe“ (deutsch: abliefern, übergeben). Die Methode, mit der er seine Güterabwägung in der europäischen Union verbindlich machen will, ist ähnlich ultimativ wie die amerikanische: Blair bringt nicht etwa sein Argument in eine gemeinsame Suche nach einem europäischen Standpunkt ein, sondern stellt sich praktisch an die Seite der USA, schickt Truppen an den Golf und legt damit fest: Eine einheitliche europäische Haltung gibt es nur, wenn die anderen ihm folgen.
Um den amerikanischen und in seinem Gefolge den britischen Führungsanspruch zurückzuweisen tun sich Frankreich und Deutschland zusammen, verweigern die Gefolgschaft und stellen die USA vor die Frage, ob sie wirklich auf die Zusammenarbeit der europäischen Zentralstaaten verzichten, sich mit Polen, Lettland etc. wirklich so leicht Ersatz für das unwichtig gewordene „alte Europa“ verschaffen können, wie sie vorgeben. Sie kontern die amerikanische Kündigung des alten Verkehrs mit einer Gegendrohung: Auch sie könnten kündigen. Das wollen sie allerdings nicht; sie wollen die Einsicht des großen Partners in die Notwendigkeit der Partnerschaft erzwingen, um unter verbesserten Bedingungen mit ihm wieder ins Geschäft zu kommen. Sie nehmen eine Verschlechterung der Beziehungen in Kauf, um mehr Rücksicht zu ertrotzen. Kein Wunder, dass die Opposition in Deutschland spiegelbildlich zur englischen die Gefährlichkeit des Kurses kritisiert und den Schaden an die Wand malt, der der Nation durch amerikanische Isolierung droht.
Frankreich hat von Anfang an das zugleich Prinzipielle und Relative seines Nein zum Ausdruck gebracht. Die Grande Nation verteidigt ihre Rolle als imperialistische Macht mit Vetorecht im Sicherheitsrat. Sie will die USA, solange die überhaupt noch ein Interesse an der Gefolgschaft der Welt zeigen, auf einen Kotau vor dem Beschlussgremium der „Weltgemeinschaft“ verpflichten; und der besteht eben in der autonomen Prüfung amerikanischer Vorwürfe, in Inspektionen und einer möglichst friedlichen Abrüstung des Irak. Dass Frankreich amerikanische Alleingänge nicht dulden wird, hat für Chirac freilich auch die andere Bedeutung: Im Ernstfall behält sich Frankreich vor mitzuschießen – auch so wird ein Alleingang verhindert. Natürlich nur, nachdem sich Frankreich selbständig davon überzeugt hat, dass die ultima ratio angebracht ist und alle friedlichen Optionen ausgeschöpft sind. Dass die Bildung dieser Überzeugung durch die Intransigenz der USA und ihren unaufhaltsamen Fahrplan zum Krieg beschleunigt werden könnte, ist kein Geheimnis. So hat die Welt erwartet und die französische Führung sich wohl darauf eingestellt, dass Frankreich den Wert seines Vetos dadurch wird verteidigen müssen, dass es keinen antiamerikanischen Gebrauch davon macht, um die Aufdeckung seiner Irrelevanz zu vermeiden. Die Unerbittlichkeit, mit der die USA auf Eigenständigkeits-Demonstrationen eindreschen, und das Bündnis mit Deutschland, das Chirac daraufhin gesucht hat, haben die ursprünglich flexible Verteidigung französischer Selbstachtung allerdings ziemlich verhärtet. Es ist denn auch vor allem dieses Bündnis, das die Amerikaner übel nehmen; französische Umständlichkeit beim Ja-Sagen, wenn es dabei bleibt, sind sie gewohnt.
Auch die deutsche Absage gerät nach dem Schlagabtausch mit Bush und Rumsfeld und der Weigerung Schröders, etwas zurückzunehmen, radikaler, als sie ursprünglich gemeint war. Der bisher so zuverlässige Juniorpartner der USA hatte erklärt, er werde sich nach allen Beiträgen und Lasten, mit denen er im „Krieg gegen den Terror“ Solidarität beweist, an einer weiteren Militärkampagne nicht beteiligen, die nach seiner Einschätzung kein Teil des Anti-Terror-Krieges ist und mit dem Regimewechsel in Bagdad andere als die vereinbarten Ziele verfolgt. Als tatsächliche Behinderung des US-Krieges sollte der Einspruch nicht gemeint sein. Wo die Regierung den USA praktisch Schwierigkeiten machen könnte – bei Überflugrechten, der Benutzung ihrer deutschem Basen und hier stationierter Truppen, beim Rückgriff auf Bündnis-Einrichtungen wie die AWACS-Flugzeuge –, hat sie längst volle Kooperation gelobt. Beides zusammen sollte ein wohlausgewogener Test darauf sein, wie viel Distanz und eigenes Kalkül einem so wichtigen Verbündeten von Washington noch zugestanden wird. Der Test ist sehr eindeutig ausgegangen: Rüde Attacken von jenseits des Atlantiks und der öffentliche Verdacht, alles sei unverantwortliche Wahlkampfrhetorik gewesen, drängen die politische Person und den Staat, dem sie vorsteht, zur Eindeutigkeit. Darüber legt sich der Kanzler Schritt für Schritt auf nationale Selbstbehauptung fest – am Ende deutlicher als die anderen Kritiker der USA im Sicherheitsrat. Er besteht auf deutscher Entscheidungsfreiheit auch gegenüber den USA und verspricht, sich auch durch ein Mehrheitsvotum im UN-Sicherheitsrat und durch die dort vorgelegten Beweise nicht von seinem Nein zum Krieg abbringen zu lassen. Mit der Festigkeit gerät Deutschland in die Rolle eines Ankers der wackeligen Koalition der Neinsager, von denen jeder weiß, dass der andere gar nicht mit der Supermacht brechen will, sondern kämpferisch um Berücksichtigung nachsucht, um wieder zurück ins Boot zu kommen. Die Partner in der Ablehnung verdächtigen einander – die Kalküle der anderen sind ihnen von den eigenen her vertraut – des Umfallens; und wenn es so weit ist, will keiner der letzte und isoliert dem Zorn der Supermacht ausgesetzt sein. Da stiftet die „politisch unprofessionelle“, „unflexible“ „Vor-Festlegung“ der wichtigen Euro-Nation, die mit einem Veto ohnehin nicht drohen könnte, einige Sicherheit. Der Kanzler, der amerikanische Abenteuer nicht mitmachen will, wird selbst zum Abenteurer: Er ergreift eine Gelegenheit, die er sich nicht herausgesucht hat, und macht Berlin zum Bezugspunkt des Unwillens in großen und kleinen Nationen über Amerikas neue Linie.
Nicht viel anders sehen sich Russland und China vom amerikanischen Monopolanspruch und seiner kriegerischen Durchsetzung gedrängt, eine ihren strategischen Kalkulationen entsprechende Stellung einzunehmen. Sie wollen nun wirklich keine Rückkehr zu einem Kalten Krieg mit der Supermacht, den Russland nur durch seine weltpolitische Kapitulation losgeworden ist; China ist ohnehin stets von einem Rückfall in die Konfrontation bedroht. Dennoch suchen auch diese Staaten einen Weg zwischen dem Abnicken der Statusdefinition, die ihnen zugemutet wird, und einem Njet, das in einen Bruch ausarten könnte. Die Gelegenheit, bei der Spaltung der Nato ein wenig nachzuhelfen, lassen sie sich nicht entgehen, solange sie nicht fürchten müssen, alleine zu stehen. Russland hat sich für seine Unterstützung der deutsch-französischen Ablehnungsfront schon eine Drohung eingehandelt: Wenn es Amerikas Krieg nicht unterstützt, kann es seine irakischen Öl-Interessen einschließlich schon existierender Verträge vergessen – und die sind ein riesiger Brocken für das russische Nationalprodukt.
Die Entschlossenheit der US-Regierung, dieses Gefecht mit den Imperialisten der zweiten Reihe durchzuziehen und ihre Demütigung zu erzwingen, hat aus den versuchsweisen diplomatischen Einsprüchen und dem hinhaltenden Werben um Berücksichtigung einen Machtkampf werden lassen, dem sich die gesamte Staatenwelt mit ihren Interessen und Händeln zuordnet. Die amerikanisch-britische nicht weniger als die deutsch-französisch-russische Fraktion fordern alle Welt dazu auf, sich auf ihre Seiten zu schlagen und die jeweils andere zu isolieren.
Noch ehe der erste Schuss fällt, steht ein Opfer des weltpolitischen Kräftemessens fest: Die Europäische Union ist als so etwas wie eine imperialistische Größe und ein außenpolitisches Subjekt gründlich blamiert. Amerikas Krieg spaltet die europäischen Staaten, die versuchen, ihr Gewicht bei der Vormacht auf entgegengesetzte Weise und damit gegen einander zu verteidigen. Es gibt in Fragen der äußeren Machtentfaltung keinen europäischen Standpunkt, von dem aus gemeinsam eine Stellung zu Amerika bezogen würde; manchen Mitgliedsländer ist das Verhältnis zu den USA erklärtermaßen wichtiger als das zu den Partnern in der Union. Die Spaltung rührt alle innereuropäischen Gegensätze und Führungsfragen auf und funktionalisiert sie für den transatlantischen Streit; wie auch umgekehrt dieser für innereuropäische Abrechnungen eingesetzt wird: Etablierte EU-Partner entdecken eine Chance dem Führungsduo Paris-Berlin eine Niederlage beizubringen und versprechen sich davon einen Zuwachs an eigener Handlungsfreiheit und Fähigkeit, zu bestimmen, was aus diesem Europa wird. Dafür entbieten Italien, Spanien und Portugal den Briten und Amerikanern gerne kriegerische Solidaritätsgrüße. Zu allem Überfluss entdecken auch die Anschlusskandidaten im Osten die Vorherrschaft der USA über das Europa der EU als Bedingung ihrer nationalen Freiheit. Das ist mal ein feiner Schluss aus den Beitrittsverhandlungen, in denen sie ihre Staatsräson europäisch neu definiert und europäischem Reglement unterworfen bekommen. Sie bedanken sich dafür, indem sie Loyalität zu Amerika und seinen Kreuzzug gegen Saddam schwören. Chiracs Ausfälligkeiten gegen die „undankbaren und ungezogenen“ Kandidaten klären ein Stück mehr, wie das europäische Einigungswerk von seinen Schöpfern gemeint ist – aber auch, um wie viel weiter sie von seiner Verwirklichung entfernt sind, als sie selbst vor kurzem noch glaubten.
Erst einmal ist Schadensbegrenzung an der Heimatfront angesagt. Die schon fast in entgegengesetzten Lagern aufgestellten EU-Regierungen werden gewahr, wie sehr ihre Spaltung in der Causa Irak ihr Projekt schon beschädigt hat. Es drängt sie zur Verabschiedung eines Dokuments, das nur eines enthält: die Willenserklärung, dass man sich von Amerikas neuer Linie den Aufbau der Union nicht gleich von der Tagesordnung streichen lässt. Man will beieinander bleiben. Abgesehen davon ist die Resolution des Sonder- und Krisengipfels ein einziges Dokument ihrer fortgesetzten Spaltung: Der Text verbindet die Zustimmung zum Krieges mit seiner Ablehnung zu der berühmten einen Stimme, mit der Europa immer sprechen will, um gehört zu werden. Die vernehmbare europäische Stimme fordert nun gar nichts mehr und ist von keiner Seite als eine irgendwie bindende Handlungsanweisung zu verstehen. Das gleichzeitige Bekenntnis zu Krieg als einem nützlichen, wenn auch letzten Mittel der Politik und zur friedlichen Entwaffnung ist eigentlich überhaupt keine Stellungnahme mehr zum Irak und dem amerikanischen Krieg, sondern nur noch eine zu dem Stellenwert, den der Streit innerhalb der EU darüber bekommen darf oder besser nicht. Wenn die Regierungschefs die unversöhnlichen Standpunkte, die sie festhalten, für vereinbar erklären mit ihrem Willen zur Einheit, dann stellen sie nur fest, dass sie es „nur wegen des Irak“ – als ginge es noch um den! – untereinander nicht zum Äußersten treiben wollen. Das Stück Deeskalation, das sie untereinander nötig finden, ist zugleich ein Signal der Deeskalation an die USA. Unbeschadet fortbestehender, keineswegs zurückgenommener Gegensätze will man auch den Konflikt mit ihnen nicht bis zum Bruch treiben. Damit Europa nicht noch mehr Schaden nimmt, darf es sich die Rolle des Gegengewichts gegen den Hegemon nicht zumuten, für die seine Gründer es auf- und ausbauen. Die weit gediehene, beiderseitige Drohung mit dem Bruch ist, wenigstens was die antiamerikanische Seite des Konflikts betrifft, eben nach wie vor als Auftakt zur neuen und verbesserten Kompromiss-Suche gemeint. Für die „unschuldigen Menschen im Irak“ heißt das nichts Gutes. Europa wird ihnen den Bombenhagel nicht ersparen. Aber darum ist es ohnehin nie gegangen.
5.
Über das Quid pro quo ihrer Stellungnahmen täuschen sich die diplomatischen Profis nicht. Wenn sie nationale Ansprüche als Erfordernisse des Völkerrechts ausdrücken, dann wissen sie, was sie tun, und werden von ihrem Gegenüber auch genau so verstanden. Mit denselben Chiffren, in denen die nationalen Egoismen zugleich versteckt und überhöht werden, versorgt man auch die Völker, die sich in den internationalen Affären orientieren sollen – und bei denen steht es nicht so gut mit dem Unterscheiden. Sie dürfen Moral und nationales Interesse so lange verwechseln und durchmischen, bis beides ein und dasselbe wird: Dann treiben sie sich ernsthaft in Fragen der Glaubwürdigkeit der Legitimation des Krieges herum – als ob es darum ginge oder gehen sollte. Mitdenkende Idealisten machen sich stark für die friedliche Abrüstung des Irak, als ob das schon immer ihr Anliegen gewesen wäre. Aktivisten demonstrieren für Frieden und gegen Krieg und fordern Standhaftigkeit von ihrer Regierung. Dabei geht es weder der noch einer anderen Regierung um diese Alternative. Schröder, Chirac, Putin und andere, die schon manchen Krieg nützlich gefunden haben, sorgen sich im aktuellen Weltkonflikt nicht um den Frieden, sondern um ihren imperialistischen Einfluss. Aber das ist wohl schwer auseinander zu halten.
[1] Das Kriegsprogramm, das unter dem Titel „war on terror“ angekündigt und durchgezogen wird, ist in dieser Zeitschrift schon mehrfach charakterisiert worden. Zuletzt in GegenStandpunkt 3-02, S.89: „Wirtschaftskrise und Kriegswirtschaft in den USA“; sowie in GegenStandpunkt 4-02, S.123: „Die offizielle Propaganda für einen Weltkrieg neuen Typs“ und in GegenStandpunkt 4-02, S.136: „Die US-Strategie im Nahen Osten“.