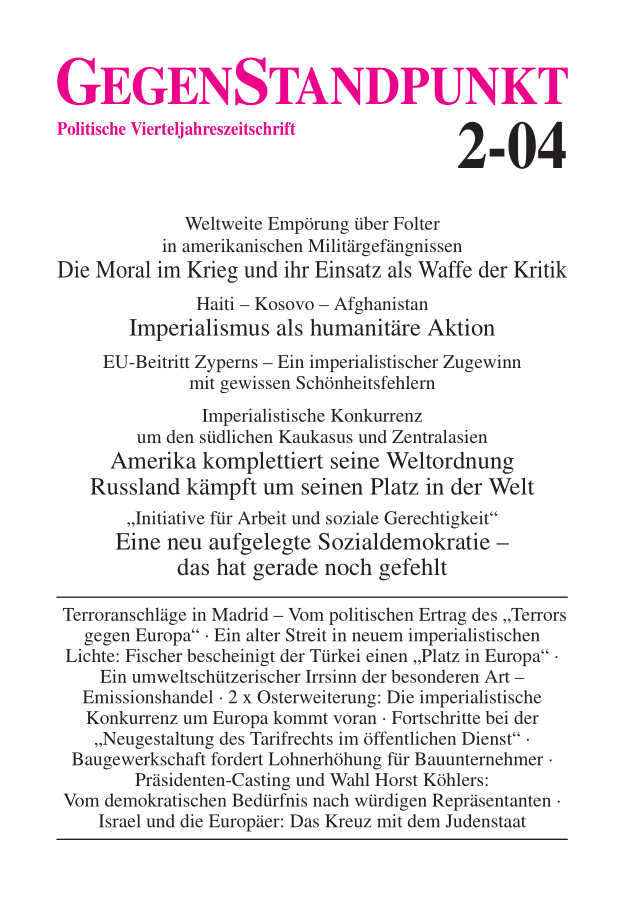Haiti – Kosovo – Afghanistan
Imperialismus als humanitäre Aktion
Auch in Ländern, in denen wirklich nichts weltwirtschaftlich Nennenswertes zu holen oder zu beschützen ist, intervenieren die Nato-Verbündeten, einzeln oder auch gemeinsam, mit ihren Verteidigungsarmeen. In Haiti, im Kosovo, in Afghanistan nehmen sie einigen militärischen und finanziellen Aufwand auf sich, um gewalttätige Streitigkeiten zwischen verfeindeten Landesbewohnern bzw. zwischen Obrigkeit und bewaffneten Oppositionellen zu befrieden, und demokratische Sitten einzuführen, auch wenn das nach ihrer eigenen Schätzung unter Umständen Jahrzehnte dauern kann.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Ein erneutes „demokratisches Experiment“ für Haiti: Im Elend stillhalten als Staatsräson
- Selbstbestimmung für die Kosovo-Albaner: „Standards vor Status“ = Nationale Freiheit durch Unterwerfung unters EU-Regime
- Die Freiheit, die das ‚Amselfeld‘ den Nato-Bomben verdankt: Ein Staat für Albaner – kein Platz für Nicht-Albaner
- Ein menschenrechtlicher Einspruch aus Europa: Kein Albanerstaat ohne Reservate für Volksfremde
- Das Quidproquo der europäischen Kosovo-Politik: Respekt vor demokratischen Werten = Unterwerfung unter Europas regierende Demokraten
- EU oder USA: Konkurrenz um die Zuständigkeit für den Balkan
- Freie Wahlen für Afghanistan: Eine Nato-Front am Hindukusch
- Demokratie für alle: Zynismus und Zielstrebigkeit des demokratischen Imperialismus heute
Haiti – Kosovo – Afghanistan
Imperialismus als humanitäre Aktion
Die Führungsmächte der demokratischen Welt sind mit ihren Truppen weltweit in humanitärer Mission unterwegs: Sie exportieren Demokratie. Gleich drei Fälle sind im Laufe eines Vierteljahres akut geworden, in denen sie sich Freiheit stiftend engagieren. Nicht bloß im Irak, wo das handfeste Interesse der Weltmacht Nr. 1 am Zugriff auf eine wichtige Ölregion kaum zu übersehen ist – und von ihren europäischen Rivalen auch kein bisschen übersehen wird –, auch in Ländern, in denen wirklich nichts weltwirtschaftlich Nennenswertes zu holen oder zu beschützen ist, intervenieren die Nato-Verbündeten, einzeln oder auch gemeinsam, mit ihren Verteidigungsarmeen. In Haiti, im Kosovo, in Afghanistan nehmen sie einigen militärischen und finanziellen Aufwand auf sich, um gewalttätige Streitigkeiten zwischen verfeindeten Landesbewohnern bzw. zwischen Obrigkeit und bewaffneten Oppositionellen zu befrieden, ganz unparteiisch mal zugunsten einer amtierenden Regierung, mal zugunsten von Aufständischen, und demokratische Sitten einzuführen, auch wenn das nach ihrer eigenen Schätzung unter Umständen Jahrzehnte dauern kann.
Das findet alle Welt äußerst anständig. Auch Pazifisten können derart humanitären Militäreinsätzen viel Gutes abgewinnen. Bedenken hegen allenfalls anspruchsvolle Strategen, denen für ein militärisches Eingreifen, das nicht auf die bedingungslose Kapitulation eines Feindes zielt, jedes Verständnis abgeht. Ansonsten ernten die zuständigen politischen Befehlshaber allseits Zuspruch. Eine Kleinigkeit übersieht dieses Lob „Frieden schaffender“ Militäreinsätze freilich schon. In allen drei Fällen intervenieren die demokratischen Großmächte in Verhältnisse, die sie selber, und zwar gleichfalls schon durch äußerst edelmütige Militäreinsätze, herbeigeführt haben. Sie selber haben maßgeblich an der Schaffung der politischen Zustände mitgewirkt, die sich nun, auch das Übrigens nicht zum ersten Mal, als prekär bis unhaltbar erweisen und nur aufrecht zu erhalten sind, weil und solange sie – weiterhin oder immer wieder einmal – mit bewaffneter Gewalt den Daumen drauf halten. Und mit ihrem Eingreifen erhalten sie auch nichts anderes aufrecht als genau diese Zustände. Mit reiner Humanität und demokratischer Ordnungsliebe haben die Gründe, aus denen sie das tun, ebenso wie die Ziele, die sie damit verfolgen, dann doch nicht so sehr viel zu tun.
Ein erneutes „demokratisches Experiment“ für Haiti:
Im Elend stillhalten als Staatsräson
Anfang des Jahres, nach wenigen Wochen schon wieder so gut wie vergessen, machen zunehmende Unruhen auf Haiti Schlagzeilen. Man erfährt, dass es in der Hauptstadt eine ehrenwerte Opposition sowie unzufriedene Studenten gibt, die den amtierenden Präsidenten, den einstigen Armenpriester Jean-Bertrand Aristide, weg haben wollen. Durch Bilder von bewaffneten Trupps, ausgebrannten Polizei-Stationen und Barrikaden aus brennenden Reifen wird man darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein wachsender Haufen bewaffneter Aufständischer, verstärkt durch Überläufer aus der Präsidenten-Miliz, den Norden des Landes unter seine Kontrolle bringt und in Richtung Hauptstadt zieht, um den Präsidenten gewaltsam zu verjagen. Anschaulich wird vorgeführt, wie es um das politische Gewaltmonopol in Haiti bestellt ist: Ein konsolidierter Staatsapparat, der das Land im Griff hätte, ist nicht vorhanden; die Macht des Präsidenten über sein Volk reicht nur so weit wie die Schlagkraft der bewaffneten Trupps, die zu ihm halten; eine größere feindliche Bande reicht aus, um der nominellen Herrschaft wirksam den Gehorsam aufzukündigen. Das politische Ziel, in dem die offizielle Opposition aus den „besseren Kreisen“ der Hauptstadt, eine Hand voll national-idealistischer Studenten und die Aufständischen aus der Provinz sich einig sind, ist mit dem Vorwurf der „Vetternwirtschaft“ und der „Korruption“ gegen den Präsidenten bereits vollständig umschrieben. Von irgendwelchen wirtschafts- oder sozialpolitischen Programmen ist nicht die Rede, weder von solchen der Regierung, mit denen die sich unbeliebt gemacht hätte, noch von irgendwelchen Alternativen, mit denen die Regierungsgegner aufzuwarten hätten: Es gibt sie nicht. Die Anklage, die paar Geldmittel, die dem Präsidenten, aus welcher Quelle auch immer, zu Gebote stehen, würden von den Falschen eigennützig, also zur Bereicherung der Falschen missbraucht, zielt ersichtlich auf nichts anderes als die Vertreibung der Nutznießer dessen, was in Haiti Staatsmacht heißt und an Reichtümern greifbar ist, und ihre Ersetzung durch Figuren, die bislang zu kurz gekommen sind. Darüber macht sich auch kein Berichterstatter etwas vor: Die Rebellen ebenso wie die „gutbürgerlichen“ Oppositionellen wollen nur Bereicherung und Rache
(SZ, 18.2.) – Rache dafür, dass Aristide sie seinerseits, übrigens auch schon unter der Parole „Kampf der Korruption“, aus den Regierungsämtern vertrieben bzw. im Kräftemessen der Milizen und Banden besiegt hat.
Über die Gründe, warum es in Haiti so wüst zugeht, weiß der antirassistische demokratische Sachverstand Bescheid: Das war dort schon immer so; die sind einfach so.
„Haiti ist von jeher eine Brutstätte der Gewalt.“ (FAZ, 14.2.) „In Haiti gibt es keine Tradition, Konflikte in der geordneten Regulierung durch Rechtsstaat und demokratische Entscheidungsprozesse auszutragen, hingegen eine lange und vielfältige Tradition unterdrückender und rebellierender Gewaltsamkeit.“ (FAZ, 10.2.04)
Mit dieser erhellenden Diagnose und der Erkenntnis, dass niemand mehr auf der Insel in der Lage ist, das Chaos aufzuhalten
, ist auch schon klar, was zu tun ist:
„Höchste Zeit, dass sich die Außenwelt auf eine Verantwortung besinnt, die ihr in diesem Falle gewiss ist. Wenn ein so groß angelegtes Experiment in Demokratieexport“ (nämlich Aristides Einsetzung vor 10 Jahren durch die USA) „sich als totale Pleite erweist, können dessen Erfinder nicht nur wegschauen.“ (SZ, 18.2.)
Nach längerem Drängen nehmen sich die Weltmacht USA sowie – aus alter frankophoner Verbundenheit, wie es heißt – die Großmacht Frankreich die Ermahnungen aus München zu Herzen, besorgen sich ein UN-Mandat und machen mit einer sparsam dimensionierten Interventionstruppe dem Spuk ein Ende: Der Präsident wird ausgeflogen, die Rebellen-„Armee“ in die Hauptstadt gelassen und amerikanischer Aufsicht unterstellt, ein neuer, aus Florida eingeflogener Interims-Präsident eingesetzt, der alsbald freie Wahlen abhalten soll. So nimmt das nächste „Experiment in Demokratieexport“ seinen Anfang, dessen bitteres Ende die Sachverständigen demnächst dann wieder beklagen können. Denn so viel steht fest: An der inneren Verfassung des haitianischen Gemeinwesens, die sich soeben als so „chaotisch“ und „gewalttätig“ herausgestellt hat, ändert die Intervention der Demokratieexportweltmeister überhaupt nichts.
Das liegt allerdings, allen FAZ-Recherchen zum Trotz, wirklich nicht am „Volkscharakter“ der Leute, die in den karibischen Slums der wohl geordneten freien Welt verelenden und verwahrlosen. Was die Affäre zur Anschauung bringt, ist der Charakter der Staatsmacht in dem Land. Die Macht des Präsidenten und seiner Regierung steht offensichtlich in einem ganz unproduktiven, rein negativen Verhältnis zur Bevölkerung, die ihrerseits mit ihrem ebenso unproduktiven, für die Herrschaft im Land jedenfalls völlig nutzlosen Überleben beschäftigt ist.
Ein Staat ohne Gewaltmonopol und politische Ökonomie
Um vom Ende her anzufangen: Es ist schon bezeichnend, dass ‚Der Spiegel‘ für seinen Nachweis, wie hemmungslos der „korrupte“ Präsident „abkassiert“ hat, nicht viel mehr anzubieten hat als dessen Zugriff auf die Einnahmen der nationalen Telefongesellschaft, die das Monopol auf die lukrativen Auslandsverbindungen hat.
Das ist offenbar schon die dickste offizielle Geldquelle im Land: Gebühren für Ferngespräche der Daheimgebliebenen mit Verwandten und Bekannten, denen die Flucht in die „1. Welt“ gelungen ist und die von dort Dollars schicken sollen. Aus dem Land und seinen Leuten selbst ist einfach nichts Geldwertes herauszuholen, seit die Reste einer heimischen Produktion für den Weltmarkt – Abbau von Kupfer und Bauxit, Anbau von Zuckerrohr, viel mehr war ohnehin nie – mangels Rentabilität eingestellt worden sind. Die Haitianer sind keine produktive Gesellschaft und deshalb schlicht nicht in der Lage, ihre Herrschaft, geschweige denn einen flächendeckenden gewaltmonopolistischen Herrschaftsapparat zu finanzieren. Umgekehrt weiß die Herrschaft, die es trotzdem gibt, mit ihrem Volk nichts Produktives, für sie selbst und dann auch für die benutzten Leute Nützliches anzufangen. Dem Gewaltverhältnis zwischen Machthabern und Landesbevölkerung geht der Inhalt ab, auf dem es unter „bürgerlichen“ Verhältnissen beruht: die im Prinzip erfolgreiche Nötigung der Masse der Leute zu einem Erwerbsleben, an dessen Erträgen die politische Macht sich bedient und das deren Untertanen zugleich als ihr Lebensmittel und ihre Lebensweise akzeptieren, so dass sie den elementaren staatsbürgerlichen Widerspruch hinkriegen und die über sie ausgeübte Gewalt als notwendig und nützlich anerkennen. Die Mittel, über die die Regierung verfügt, zu wesentlichen Teilen aus ausländischen Quellen, aus Krediten und Hungerhilfe – und ein wenig Zwischenhandel mit Kokain –, reichen nicht im Entferntesten, um irgendwelche Reichtumsquellen für den Staat aufzutun und dadurch auch Erwerbsmöglichkeiten wenigstens für eine starke Minderheit im Land zu schaffen; schon gar nicht solche, die in der Konkurrenz der Nationen um Kapitalanlage heute eine Chance hätten. Sie reichen gerade aus, um die herrschenden Figuren zum Unterhalt bewaffneter Trupps, nicht zuletzt in Polizeiuniform, zu befähigen und mit allerlei sonstigen Insignien staatlicher Souveränität auszustatten. Der haitianische „Staatshaushalt“ ist insofern seiner politökonomischen Natur nach, ganz gleich, wie geldgierig oder bescheiden die jeweils Regierenden damit umgehen, nicht mehr als die – noch nicht einmal besonders standesgemäße – „Revenue“ der Typen, die sich in der permanenten Konkurrenz um Herrschaftsposten und den Zugriff auf besagte Mittel gerade durchgesetzt haben und auch mit nichts anderem beschäftigt sind, allerdings auch genug damit zu tun haben, sich zu behaupten und ihre Macht zu behalten. Was Volk und Führung verbindet, ist nichts als Gewalt: Unterdrückung, die die Menschen in ihrem Elend festhält, auf der einen Seite, auf der anderen das äußerst begrenzte Angebot, sich als eine Art Milizionär an die Gewalthaber zu verdingen. Hinzu kommt immer wieder einmal, als sehr passende positive Seite dieses rein negativen Verhältnisses, die völlig grund- und substanzlose Hoffnung, die größere Volksmassen gelegentlich auf einen „Erlöser“ setzen, der ihnen hinreichend glaubwürdig vormacht, die Beseitigung der gerade herrschenden Figuren und ihr Ersatz durch eine neue volksverbundene Mannschaft wäre der Königsweg heraus aus ihrer Misere. Der jetzt entthronte Präsident Aristide ist selber auf die Art vom Armenpriester und geistlichen Idol der Slumbewohner zum Staatschef aufgestiegen; in den ersten regulären freien Wahlen seit Menschengedenken in dem Land.
Kurzgeschichte eines ‚demokratischen Experiments‘
Die Inszenierung jener Wahlen, ihre Vor- und Nachgeschichte sowie vor allem die neuerliche Absetzung Aristides in diesem Frühjahr sind lauter drastische Beispiele dafür, worauf die Herrschaft im „Staate“ Haiti, wenn schon nicht auf dem eigenen Volk, tatsächlich beruht. Schon die erste Aristide-Wahl im Jahr 1991 kommt auf Grundlage der Entscheidung Washingtons zustande, der bis dahin amtierenden antikommunistischen Kampftruppe der Duvaliers die Unterstützung zu entziehen und stattdessen Demokratie anzuordnen – eine Sparmaßnahme nach dem Ende der „sowjetischen Gefahr“, ein Stück „Friedensdividende“ aus dem Sieg im „kalten Krieg“: Freie Wahlen sollen die Zuschüsse für den bisherigen Unterdrückungsapparat überflüssig machen. Den anschließenden Putsch der Armee gegen den seltsamen Heiligen, der, mit nichts als einer religiös-familiären Massenbewegung, eigenen Gangs und den Stimmen der Armen im Rücken, den etablierten Machthabern glatt ihre Positionen und ihre Revenue streitig macht, lässt die US-Regierung jedoch geschehen: So richtig zuverlässig und demokratisch zurechnungsfähig kommt der Mann ihr dann doch nicht vor. Die Putschisten dürfen an der Macht bleiben, bis wieder eskalierende Unruhen größere Mengen haitianischer Boatpeople an Floridas Küste treiben. Dann ist es wieder an den Amerikanern, der Clinton-Regierung mittlerweile, den gewählten, vertriebenen und in den Vereinigten Staaten aufbewahrten gewählten Präsidenten von neuem in sein Amt einzusetzen; mit der Maßgabe, bei den anstehenden Neuwahlen auf eine Kandidatur zu verzichten; dafür wird die jederzeit Putsch-bereite Armee aufgelöst. Mit Hilfe ihres Kommandos über die Polizei sowie mit ihren Schlägertrupps hält sich die Partei Aristides volle 10 Jahre an der Macht, am Ende wieder mit dem nach seiner Karenzzeit wieder gewählten arrivierten Armenpriester an der Spitze. Das fromme Vertrauen der verelendeten Massen in ihren geistlichen Repräsentanten erweist sich allerdings als weniger haltbar: Die fälligen Wahlen müssen wieder mehr durch Fälschung entschieden werden. Die Gegner des Präsidenten finden Gehör in Washington, außerdem genügend Unterstützung, um Unruhen anzuzetteln. Mit den erneut ansteigenden Flüchtlingszahlen wird „die Lage“ nach und nach von neuem unhaltbar – für die USA; und Frankreich, UN-Sicherheitsratsmitglied mit Vetorecht, deswegen für ein völkerrechtlich einwandfreies Mandat zum Eingreifen unentbehrlich und seinerseits an einer Einmischung in Amerikas karibischem „Hinterhof“ interessiert, schließt sich dieser Lagebeurteilung an. Prompt entdecken die Experten von der Abteilung Weltöffentlichkeit lauter unmögliche Zustände, die ihnen jahrelang keine Heuchelei wert waren:
„Unten im Hafenviertel von Port-au-Prince, wo Aristide besonders treue Anhänger fand, bevor er 1990 zum ersten Male auf damals noch weitgehend saubere demokratische Weise zum Präsidenten gewählt wurde, ist am eindrucksvollsten zu sehen, was aus dem Land unter der Herrschaft des ehemaligen Arbeiterpriesters und Befreiungstheologen geworden ist. Dort hausen die Bewohner in notdürftig zusammengeschusterten Wellblechhütten in drangvoller Enge auf einem stinkenden und dampfenden Terrain, einer einzigen Kloake.“ „Der Mythos des Politikers Aristide, der für die verarmten und verelendeten Bevölkerungsschichten ein Hoffnungsträger war, weil er ihnen bessere Lebensbedingungen versprochen hatte, ist längst verblasst.“ (FAZ, 21.2.)
Und im Konsens unter Konkurrenten, die in dem Fall Kooperation für die zweckmäßigste und billigste Lösung halten, beschließen die französische und die US-Regierung einen Neustart des Programms „Demokratie für Haiti“; eine Abordnung bewaffneter Kräfte setzt ihn durch.
Regierungsauftrag: Fremdherrschaft, demokratisch selbst gemacht
Hier wie schon in den vorangegangenen Interventionen betätigen sich die USA nicht bloß als maßgebliche Aufsichtsmacht in dem Sinn, dass sie sich die Unterstützung oder Entmachtung einer wie auch immer zustande gekommenen Staatsmannschaft in Lateinamerika vorbehalten und bedarfsweise nach dem Rechten schauen. Auch wenn es immer wieder so ähnlich abläuft: Die Sache selbst ist fundamentaler. Was in Haiti an Staat stattfindet, dass es dort überhaupt eine politische Herrschaft gibt, verdankt sich einem ganz grundsätzlichen Interesse der Weltordnungsmächte: dem Interesse, dass auch dort Herrschaft exekutiert werden und Staat stattfinden soll, wo ein Land weder die Mittel für ein flächendeckendes Gewaltmonopol hergibt, noch ein gesellschaftliches Bedürfnis nach ordentlicher Regierung vorhanden ist. Haitis Präsidenten, ob von zur Wahl aufgerufenen Massen akklamiert oder aus Florida eingeflogen, erfüllen alle Mal in einem ganz grundsätzlichen Sinn den Tatbestand einer Fremdherrschaft: Sie sind noch nicht einmal quasi-autonome Sachwalter eines auswärtigen Benutzungsinteresses, das sich auf ihren politischen Besitz an Land und Leuten, Ressourcen und Arbeitskraft richtet; vielmehr repräsentieren sie den Widerspruch, dass ein Land wie ein ordentlicher Staat funktionieren soll, weil die herrschende Weltordnung keine „weißen Flecken“ auf der politischen Landkarte duldet, obwohl dieselbe Weltordnung für seine Einwohner gar keine Verwendung hat und es im Grunde zur Existenzunfähigkeit verurteilt. Die politische Agenda haitianischer Regierungen erschöpft sich in dem Auftrag, daran nichts zu ändern; weder zum Besseren – dazu fehlen ihr alle Mittel und dafür bekommt sie auch keine –, noch zum Schlechteren in dem Sinn, dass das einheimische Volk mit Unruhen und einem drohenden Exodus die allgemeine Ordnung anderswo stört – dafür werden sie inthronisiert und alimentiert.
Diese großzügige Hilfestellung ist, seit es den großen antiimperialistischen Gegenspieler in Moskau nicht mehr gibt, mit einer Forderung verbunden, die den Widerspruch einer derartigen Auftrags-Regentschaft auf die Spitze treibt: Amerika erwartet eine funktionierende Herrschaft ohne politökonomische und nationale Grundlage als pflichtschuldige Eigenleistung der installierten Regierungsclique selbst, der man gewissermaßen nur Geburtshilfe geleistet haben will. Dafür stand schon bei der Ablösung des Duvalier-Clans, der in Zeiten des „kalten Krieges“ die antikommunistische Ausrichtung seines Landes in der Nachbarschaft zu Fidel Castros Kuba mit Unterstützung der USA gewaltsam gewährleistet hatte, und steht jetzt wieder die Parole Demokratie: Vermittels eines freien Wahlakts ihrer Untertanen sollen die Machthaber in Haiti sich ihrer Macht versichern; dann – so die zynische Rechnung aus den Kapitalen des demokratischen Imperialismus – brauchen sie keine kostspieligen Machtmittel mehr, und die Last ihrer Unterstützung sinkt gegen Null. Umgekehrt soll das Volk sich per freie Wahl mit seiner Führung einverstanden erklären, auch wenn es außer Elend überhaupt nichts von ihr hat; dann hat es keinen akzeptablen Grund mehr und jedes Recht verwirkt, zu stören oder gar anderswo, an den Außengrenzen der „1. Welt“, störend in Erscheinung zu treten.
Dass man den Haitianern eine kleine Kolonialarmee schicken muss, um sie praktisch daran zu erinnern, was sie in ihrem nutzlosen Elend der ‚Internationalen Gemeinschaft‘ schuldig sind, definieren die Entsendestaaten USA und Frankreich als Zumutung und dementsprechend ihre Bereitschaft, dem Land seinen alten Präsidenten wegzunehmen und einen neuen vorbeizuschicken, geradezu als Gnadenakt. Sie tun das auch nicht ohne eine kleine diplomatische Auseinandersetzung untereinander über vor- und nachrangige Zuständigkeiten der einen und der anderen Weltordnungsmacht für die karibische Inselwelt und geben damit immerhin Auskunft über die beiden höherrangigen Gesichtspunkte, unter denen sie sich überhaupt zu einer Intervention entschließen und das Maß ihres Engagements festlegen: Sie haben beide ein Interesse, sich als oberhoheitlicher Aufpasser in dieser Region zu betätigen und konkurrierend gegeneinander in Position zu bringen; und sie stellen beide das Kalkül an, wie viel Aufwand sie es sich kosten lassen wollen, den „Fall Haiti“ zum Exempel für die eigene imperialistische Kompetenz zu machen. Am Ende, wie gesagt, einigen sich Washington und Paris auf eine Teilung von militärischem Aufwand und diplomatischem Ertrag – zu Lasten eines Präsidenten, der sich allein schon dadurch einer Amtspflichtverletzung schuldig gemacht hat, dass er sein Land nicht problemlos im Griff hat, und deswegen mit einem afrikanischen Exil noch gut bedient ist.
Selbstbestimmung für die Kosovo-Albaner:
„Standards vor Status“ = Nationale Freiheit durch Unterwerfung unters EU-Regime
Im Kosovo sind die wichtigsten EU-Mächte seit Jahren im Auftrag der Vereinten Nationen mit Polizisten und zivilen Verwaltungskräften als Unmik präsent, außerdem zusammen mit den USA mit Soldaten, einstweilen noch unter Nato-, demnächst eventuell unter EU-Kommando, unter dem Uno-Kürzel Kfor engagiert. Fast auf den Tag genau fünf Jahre nach Beginn des Nato-Bombenkriegs gegen das damalige Rest-Jugoslawien sind diese Aufsichtskräfte mit einem Aufruhr der seinerzeit befreiten Kosovo-Albaner, dem größten Gewaltausbruch im Kosovo seit dem Ende des Luftkriegs der Nato
(FAZ, 19.3.), konfrontiert.
„Zwar wurde die Kfor nicht als eigentliches Ziel attackiert, sondern nur dort, wo sie sich den Extremisten zum Schutz von angegriffenen Serben in den Weg stellte; doch schon das stellt ein neues Element dar.“ (FAZ, 25.3.04)
Die Oberaufseher sind empört und beleidigt:
„Solana … nannte es … eine ‚Sünde‘, dass Kosovo-Albaner bei den Unruhen Kfor-Soldaten und damit jene angegriffen hätten, die ihnen vor fünf Jahren ‚zu Hilfe gekommen‘ seien.“ (FAZ, 19.3.) „Die Bundesregierung sei ‚enttäuscht‘ von dem jüngsten Gewaltausbruch, so Bundesverteidigungsminister Struck.“ (FAZ, 6.4.)
Ein Rückzug kommt deswegen aber nicht in Frage. Im Gegenteil: Die engagierten EU-Mächte, die BRD vorneweg, verstärken ihre Truppe und zeigen sich fest entschlossen, einen Einsatz fortzusetzen, mit dem sie sich vor Ort offenbar zunehmend unbeliebt machen – was auch kein Wunder ist. Seit Jahren muten sie den Völkerschaften auf dem ‚Amselfeld‘ ein Zusammenleben zu, das weder ein ‚Zusammen‘ noch ein Leben ist. Die nicht-albanischen Kosovo-Bewohner haben sie der Belgrader Staatsmacht entzogen, verwehren ihnen deren Schutz, bieten selber aber bestenfalls eine fragwürdige Garantie fürs nackte Überleben inmitten einer feindlichen Umgebung und verhindern jede Alternative. Umgekehrt haben sie die Kosovo-Albaner von der Belgrader Herrschaft befreit; nun diktieren sie, wie die ihre Freiheit zu gebrauchen haben: ganz entgegen dem Inhalt, den die ihrer Freiheit geben.
Die Freiheit, die das ‚Amselfeld‘ den Nato-Bomben verdankt: Ein Staat für Albaner – kein Platz für Nicht-Albaner
Die politisierte Mehrheit im Kosovo hat nämlich ein glasklares politisches Programm: Sie will einen eigenen albanischen Staat; darin sind alle politischen Parteien und Häuptlinge sich mit ihrer Basis absolut einig. Und sie fühlen sich damit im Recht: Immerhin hat kein Geringerer als die Nato sie mit ihrem kämpferischen Ethno-Nationalismus vor fünf Jahren äußerst gewaltsam ins Recht gesetzt. Uno und EU haben ihnen anschließend einen frei gewählten Präsidenten, eine eigene Regierung, ein reguläres Parlament gewährt – also alles, was man heutzutage an demokratischen Institutionen fürs Staat-Machen braucht. Eine Vollendung ihrer Autonomie in einem wirklichen Staat stellt die ‚Internationale Gemeinschaft‘ den Kosovo-Albanern in Aussicht, indem sie den völkerrechtlichen Status der Provinz, ungeachtet ihrer einerseits formell anerkannten Zuordnung zum serbischen Staat, andererseits für ungeklärt und offen erklärt.
Einstweilen hat die quasi-staatliche albanische Obrigkeit zwar nicht viel zu sagen:
„Der ‚Verfassungsrahmen‘ (enthält) nur begrenzte Kompetenzen für Regierung und Präsident … Rechtsprechung, innere und militärische Sicherheit sowie die Außenbeziehungen regelt weiterhin die Unmik; sie entscheidet auch über die Verwendung des größten Teils der Haushaltsmittel, darf Gesetze, … außer Kraft setzen und das Parlament auflösen.“ (Fischer Weltalmanach 2002)
Über materielle Mittel, politökonomisch Staat zu machen, was heutzutage und auch auf dem Balkan gleichbedeutend ist mit: einen attraktiven nationalen Kapital-Standort zu eröffnen, verfügt sie schon gleich nicht:
„Überall fehlen Arbeitsplätze. Junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte suchen … ihr Glück im Ausland.“ (FAZ, 9.12.03) „Die Arbeitslosenrate beträgt 49 Prozent, bei den 16- bis 24-Jährigen über 70 Prozent… Im vergangenen Jahr gingen die Wiederaufbaumittel für das Kosovo um ein Viertel gegenüber 1999 bis 2002 zurück, sogleich sank auch die Wirtschaftsleistung. Und mit dem Abbau ausländischen Personals fließen immer weniger internationale Gehälter in den Wirtschaftskreislauf. Das durch die ausländischen Hilfen ausgelöste Scheinwachstum wird früher oder später in sich zusammenfallen… Die Unmik schätzt, dass von mehreren hundert zu privatisierenden Unternehmen nur vierzig Aussichten besitzen, jemals Investoren anzuziehen.“ (Die Zeit, 25.3.)
Mit der Zerstörung Jugoslawiens und dem schließlich siegreichen Befreiungskampf der Kosovo-Albaner ist eben alles zugrunde gegangen, was es zuvor auf dem ‚Amselfeld‘ an Erwerbs- und Überlebensmöglichkeiten gegeben haben mag. Die großzügig versprochene Wiederaufbauhilfe der potenten kapitalistischen Nationen besteht im Wesentlichen im Unterhalt ihrer eigenen Aufsichts- und Ordnungskräfte, an dem von den Eingeborenen allenfalls die Einzelhändler und Zuhälter verdienen. Menschenhandel, Waffenschieberei und Geldwäsche
(Die Zeit, 25.3.) sind die ergiebigsten Geldquellen. Von irgendwelchen Voraussetzungen einer kosovarischen Nationalökonomie kann schlechterdings nicht die Rede sein. Aber das stört sogar die Betreuer aus dem reichen Norden, lauter Anwälte der „Globalisierung“, nur bedingt –
„Die Gesamtbilanz bleibt dennoch positiv; als den wohl größten Erfolg bezeichnet Busek (sc. der Sonderkoordinator des Stabilitätspaktes für Südosteuropa) die ‚Irreversibilität des demokratischen Prozesses auf dem westlichen Balkan‘.“ (FAZ, 9.12.03) –;
und die Fanatiker einer kosovo-albanischen Eigenstaatlichkeit stört das akkumulierende Elend in ihrem Landstrich schon überhaupt nicht in ihrem National-Projekt. Das hat auch ohne ‚politische Ökonomie‘ Inhalt genug, nämlich dass es albanisch ist und alle Volksfremden ausschließt, die doch nichts weiter sind als die Repräsentanten des Belgrader Machtanspruchs, von dem man sich glücklich befreit hat. Diese Freiheit ist für die albanische Mehrheit der positive Inhalt des „demokratischen Prozesses“ in ihrem Winkel des „westlichen Balkan“, den insoweit auch sie für den „größten Erfolg“ ihrer jüngeren Geschichte halten. Dass Nato-Bomben ihnen dazu verholfen haben, vergessen sie nicht: Eben dadurch finden sie sich in ihrem Sonder-Nationalismus absolut bestätigt, machtvoll bekräftigt und einwandfrei dazu ermächtigt, auf Vollendung ihres ‚Nation-Building‘ zu drängen:
„Die Albaner fühlen sich bereits als alleinige Herren im Haus.“ (Der Spiegel, 13/04)
Ein menschenrechtlicher Einspruch aus Europa: Kein Albanerstaat ohne Reservate für Volksfremde
Genau das verwehren die mächtigen demokratischen Patrone ihren Schützlingen jedoch. Von ihrer Großtat, die Kosovo-Albaner aus Belgrads Klauen zu befreien, von ihrer machtvollen Parteinahme für deren völkisch-sezessionistisches Selbstbestimmungsrecht nehmen sie nichts zurück; für den tatsächlichen Gebrauch der errungenen Volksfreiheit schreiben sie aber eine Bedingung vor, deren Erfüllung den ganzen Erfolg der „albanischen Sache“ wieder zunichte machen würde: Mit allen Volksgruppen, gegen die ihr ganzer Staatswille sich richtet, den als Schergen Belgrads verhassten Serben, den verachteten Zigeunern usw., soll die albanische Mehrheit ihren Frieden machen und unbeschwert koexistieren. Die Verheißung eines souveränen Kosovo bleibt bestehen, ist aber mit der Zumutung verbunden, den nicht-albanischen Landesbewohnern den Status einer geschützten und respektierten Minderheit zu garantieren – einen Status, den alle Welt zwar hochanständig findet, der aber seinerseits denselben Widerspruch enthält: Teile der Einwohnerschaft des Landes werden nach völkischen Gesichtspunkten politisch abgegrenzt, damit als Fremdkörper im eigentlichen Staatsvolk definiert, und sollen als solche Fremdkörper im Volksstaat der Mehrheit gleichwohl gut aufgehoben sein.
„Der Text mit dem Titel ‚Standards für Kosovo‘ nennt folgende Bedingungen: Neben demokratischen Institutionen und Rechtsstaatlichkeit sind das die Punkte Bewegungsfreiheit, Rückkehr der Flüchtlinge und Achtung der Rechte der ethnischen Gemeinschaften. Hinzu kommt eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, die Garantie der Eigentumsrechte und der Dialog.“ (DW)
Die freundliche Aufforderung geschworener Feinde jeglicher Planwirtschaft an eine mittellose Regierung mit äußerst beschränkten Befugnissen, eine „nachhaltige Wirtschaftsentwicklung“ herbeizuregieren, bevor man sie in die Unabhängigkeit entlassen kann, ist mehr ein Treppenwitz am Rande. Entscheidend, und zwar für beide Seiten, die albanischen Staatsgründer wie die Oberaufseher von der EU, ist das Junktim zwischen dem halben Versprechen, dem albanischen Staatswillen seine Erfüllung in einem souveränen Kosovo zu gewähren, und der Maßgabe, dass es sich nicht um den sauberen Albaner-Staat handeln darf, auf den dieser Staatswille zielt. Mit der Aussicht auf den ersehnten Status wird der albanische Nationalismus angestachelt, um ihn dazu zu bringen, dass er sich mit den Standards einer multi-ethnischen „Lösung“ abfindet oder sogar anfreundet, die ihm ganz und gar widerspricht. Es kommt natürlich, wie es kommen muss: Der Nationalismus lässt sich anstacheln, die Erziehung zu ethnischer Toleranz schlägt fehl.
Dass für Mitte 2005 Gespräche „über die Lösung der Statusfrage in Aussicht“ gestellt wurden, „ist … im Kosovo … erwartungsgemäß uminterpretiert worden: Ungeachtet der Mahnungen …, ohne Fortschritte bei der Demokratisierung werde es auch 2005 keine Aufnahme von Statusgesprächen geben, gilt der albanischen Bevölkerungsmehrheit das Jahr bereits als jenes, in dem das Kosovo unwiderruflich zu einem unabhängigen Staat werde.“ (FAZ, 4.2.)
Und je deutlicher die demokratischen Oberaufseher den albanischen Volksteil daran erinnern, dass eine Staatsgründung von ihnen konzessioniert werden muss und keinesfalls so ausfällt, wie ein antiserbischer Freiheitskämpfer sich das vorstellt, umso entschiedener fällt die Reaktion der Mehrheit aus:
„Viele Albaner fühlen sich um die Früchte des Befreiungskampfes betrogen.“ (Der Spiegel, 16/04)
Deswegen lassen sie sich für den Versuch mobilisieren, schon vorweg die nötigen Fakten zu schaffen und alle Landesbewohner zu vertreiben, deren Tolerierung die demokratischen Oberaufseher dekretieren. Damit stoßen sie bei denen allerdings auf eine ziemlich klare „rote Linie“: So wäre das Ziel kosovo-albanischer Autonomie ganz entschieden nicht zu erreichen. Mit Intransigenz und Gewalt mochte der nationale Ehrgeiz der Kosovaren die Belgrader Staatsmacht herausfordern, am Ende sollte er sogar deren Zerstörung durch Nato-Bomben provozieren; aber nie und nimmer darf er Europas Ordnungsmächten lästig werden!
Das Quidproquo der europäischen Kosovo-Politik: Respekt vor demokratischen Werten = Unterwerfung unter Europas regierende Demokraten
In dieser „entschlossenen Reaktion“ ist immerhin eine gewisse Aufklärung darüber enthalten, warum die Balkan-Politiker der EU ihrerseits so stur und entschieden auf einem multi-ethnischen Kosovo bestehen, obwohl sie natürlich wissen, was mittlerweile sowieso jeder weiß:
„Der Westen habe sich im Kosovo eine multiethnische Gemeinschaft zum Ziel gesetzt, die dort letztlich keiner wolle – warnte jüngst der OSZE-Beauftragte.“ (Der Spiegel, 16/04)
Mit dem „Völkergemisch“, das sie unbedingt haben wollen, haben sie tatsächlich ja gar nichts weiter vor; die Leute, die das ‚Amselfeld‘ besiedeln, lassen sie in jeder Hinsicht vergammeln. Aber dass auch der Kosovo-Albaner auf gar keinen Fall eigenmächtig einen Staat aufmachen darf, wie er ihm gefällt; dass immer noch sie es sind, die die neue staatliche Ordnung auf dem Balkan stiften; dass es in ihrer Macht liegt, für den Status, den die ortsansässigen Nationalisten haben wollen, die Standards vorzugeben, und dass sie sich dabei nicht dreinreden lassen: Das Exempel wollen die mächtigen Europäer auf Biegen und Brechen statuieren. Sie konfrontieren die Verfechter und Anhänger eines „ethnisch gesäuberten“ albanischen Kosovo mit Konzepten für eine minderheitenrechtlich einwandfreie Staatsverfassung und stellen sich damit entschieden negativ gegen den politischen Willen, den sie selber gezüchtet haben. Gegen den Protest der betroffenen und beleidigten Nationalisten vor Ort bestehen sie nur umso härter auf dem „harten Kern“ ihres Verfassungsprojekts: darauf, dass Politiker, die im Kosovo Staat machen wollen, erst einmal ihren demokratischen Vormündern alles recht machen müssen:
„Der Nato-Pressesprecher gab zur Kenntnis, dass es ‚an den Führern in der Provinz liegt, sich in ihrer Führungsposition darum zu bemühen, die Konflikte beizulegen, Frieden zu schaffen und eine politische Lösung aller Probleme anzustreben‘.“ (md)
Wie solche ‚Problemlösung‘ und der zu schaffende ‚Frieden‘ im Einzelnen aussehen, darüber lässt die Nato mit sich reden – aber erst dann, wenn die nationalistischen Parteien im Land Unterwürfigkeit beweisen und der amerikanisch-europäischen Oberhoheit ihren bedingungslosen Respekt erweisen. Was die Aufpasser der Nato ihnen vorschreiben, ist in jedem Unterpunkt verhandelbar – in Reaktion auf die Unruhen zeigt die Unmik bei „Problemen“ und „Lösungen“ durchaus Entgegenkommen –, in dem einen Hauptpunkt aber nicht: Ihr Forderungskatalog steht für Folgsamkeit, für Unterordnung als Bedingung der Freiheit, die die Kosovo-Albaner sich erkämpft zu haben meinen. Gegen deren völkisch exklusiven Staatswillen geht es den Ordnungsmächten in letzter und entscheidender Instanz um dieselbe „europäische Sache“, die sie schon vor fünf Jahren zum Bombenkrieg gegen das Rest-Jugoslawien des Präsidenten Milosevic bewogen hat: um ihre politische Vormundschaft über die Region, um ihre Entscheidungsmacht speziell in allen dort auf die Tagesordnung gesetzten Staatsgründungs-Affären.
Natürlich verfügen Europas Ordnungspolitiker als mit allen Wassern gewaschene Demokraten alle Mal über die nötige Unverfrorenheit – Deutschlands rot-grüne Weltordner tun sich da wie immer hervor –, die Reihenfolge auf den Kopf zu stellen und treuherzig zu erklären, es wäre ihnen um nichts anderes zu tun als um die Verhinderung nationalistischer „Übergriffe“, um das hohe Rechtsgut des Minderheitenschutzes, um das zivilisierende Ethos der Toleranz und dergleichen mehr. Öffentlich machen sie sich Sorgen um unschuldig bedrängte Serben-Familien, vertriebene orthodoxe Mönche und angezündete Kirchen. Die Bilanz ihrer jahrelangen militärischen Kontrolle und zivilen Verwaltung des Landes –
Nicht-Albaner „sind Diskriminierung, Einschüchterung und Verfolgung ausgesetzt, die meisten können weder auf die Universität gehen noch eine Arbeit finden. Ärzte weisen sie ab.“ „Trotz der massiven Nato-Militärpräsenz wurden seit Mitte 1999 rund 237.000 Nichtalbaner aus der Provinz vertrieben.“ (Die Zeit, 25.3.) –
ist freilich die Gegenprobe aufs Exempel: Der Schutz, in dessen fragwürdigen Genuss die ethnischen Minderheiten im Kosovo gekommen sind, gilt nicht ihnen und ihren Existenzbedingungen, sondern den Rechten, die die demokratischen Schutzmächte ihnen zuerkennen – die bleiben intakt, auch wenn ihre Inhaber faktisch gedemütigt und ein wenig vertrieben werden. Gegen den „albanischen Mob“ machtvoll verteidigt wird die Instanz, die den Ethnien ihre politischen Mehrheits- und Minderheitsrechte zudiktiert. Ob die gut aussieht und sich den nötigen Respekt zu verschaffen weiß: das ist das wirkliche und auch schon das ganze Problem, das Nato und EU mit dem Aufruhr der Eingeborenen und dem Auftreten ihrer Truppen haben. Die mitdenkende demokratische Öffentlichkeit lässt da auch gar keine Zweifel: Die pflichtschuldig bedauerten Opfer albanischer „Übergriffe“ verkörpern den Skandal, dass unsere Truppe
dabei so schlecht ausgesehen hat;
„Deutsche Uno-Polizisten werfen der Bundeswehr vor, bei den Ausschreitungen albanischer Extremisten gekniffen und versagt zu haben“ (Der Spiegel, 19/04);
die ganze Kritik steckt bereits in der ‚Spiegel‘-Überschrift: Die Hasen vom Amselfeld
. Ebenso eindeutig fällt die Ermunterung aus, wie mit dem widerspenstigen Gesocks auf dem Balkan verfahren werden sollte, gerade wenn auch längerfristig nicht auf Besserung zu hoffen ist:
„Es ist nicht die schönste Aussicht, auf Jahre, wenn nicht auf Jahrzehnte hinaus auf dem von Politkriminellen beherrschten Amselfeld präsent zu sein – und den dummen Sündenbock geben zu sollen. Die unmittelbare Lehre? Sich nicht auf der Nase herumtanzen zu lassen.“ (FAZ, 30.3.)
Die Messlatte, die da an den Auftritt des europäischen Militärs angelegt wird, reflektiert die Sache, um die es geht: Bedingung für völkisch-nationale Freiheit ist vorauseilende Unterwerfung unter die Diktate der Ordnungsmacht; das haben auch die befreiten Albaner zu begreifen.
EU oder USA: Konkurrenz um die Zuständigkeit für den Balkan
Die Heuchelei, mit der EU-Betreuer und speziell das rot-grüne Vormundschaftsgericht aus Berlin ihre Sorge um den menschenrechtlichen Anstand auf dem Balkan in den Vordergrund rücken, verdient nicht bloß einen moralischen Ehrenpreis. Ihr kommt außerdem noch eine diplomatische Bedeutung zu. Nicht gerade in Gegensatz zu den USA, die auch auf dem Balkan „mal wieder“ mehr auf ihre militärische Präsenz Wert legen und weniger auf gute Sitten der Kosovo-Albaner, aber schon zwecks deutlicher Unterscheidung von ihrer Nato-Führungsmacht wollen die Europäer ihre europäische Gestaltungskompetenz betont und einen gewissen Vorrang ihrer eigenen Zuständigkeit für ihre südöstliche Nachbarschaft kenntlich gemacht haben, die sie auf der operativen Ebene zugleich mit dem Projekt einer EU-geführten Besatzungsmacht für die west-balkanische „Krisenregion“ vorantreiben. Ein Hinterbänkler von der FDP darf sich in der Frankfurter Allgemeinen einmal aussprechen und bringt den Zusammenhang auf den Punkt:
„Im Kosovo kann nun Europa zeigen, dass es seine Verantwortung ernst nimmt. Daher sollte die UN-Verwaltung im Kosovo beendet und das Kosovo zu einem europäischen Treuhandgebiet gemacht werden… Die EU übernähme dauerhaft die Zuständigkeit für die Außenpolitik und die Verteidigung … Nur durch ein gemeinsames Heranführen an Europa können schrittweise die ethnischen, religiösen und nationalen Unterschiede und Konflikte abgebaut werden.“ ( FDP-MdB Stinner, FAZ, 15.4.)
Freiheit fürs Kosovo heißt Zuwachs für Europas Ordnungsmacht: Damit spricht der Mann von der Opposition seiner ehrgeizigen Regierung voll aus dem Herzen.
Freie Wahlen für Afghanistan:
Eine Nato-Front am Hindukusch
In Afghanistan sind die Führungsmächte der demokratischen Staatenwelt gleich doppelt engagiert. Die finanzkräftigen kapitalistischen Nationen investieren Geld, die Deutschen und andere Stützen des „europäischen Pfeilers“ der Nato außerdem einiges an militärischer Gewalt, insgesamt fast 6000 Mann, in ein Aufbauprojekt, das – laut gemeinsamer Beschlussfassung auf ihrer mittlerweile dritten Afghanistan-Konferenz, diesmal in Berlin – auf keinen Fall scheitern darf; nicht, weil das Überleben der Völkerschaften, sondern weil das der Nato sowie „unsere Freiheit am Hindukusch“ auf dem Spiel steht; was nicht deswegen der Fall ist, weil die stärkste Militärallianz der Weltgeschichte dort auf einen über alles bedrohlichen Gegner gestoßen wäre, sondern weil das Bündnis dort exemplarisch seine Fähigkeit und Bereitschaft unter Beweis stellen will, überall auf der Welt, wo immer es seinen Hauptmächten nötig erscheint, passende politische Verhältnisse zu implantieren. Das ist dort deswegen keine leichte Aufgabe, weil die stärkste demokratische Weltmacht seit längerem und noch immer damit beschäftigt ist, mit 12.000 eigenen und etlichen alliierten Soldaten sowie mit Unterstützung der pakistanischen Armee in Afghanistan „den Terrorismus“ zu bekämpfen und damit ein Zerstörungswerk an dem schon vor zwei Jahren besiegten Taliban-„Staat“ zu vollenden, das alles andere als einen sauberen Bauplatz für ein modernes ‚Nation-Building‘ hinterlässt.
Ein freiheitlich-antiterroristisches Zerstörungswerk
Schon die Entstehung jenes frommen Gemeinwesens war bekanntlich eine freilich nicht ganz planmäßige Errungenschaft der westlichen Demokratien: ein Ergebnis des Nato-gesponserten Zerstörungswerks religiös fanatisierter Kämpfer an dem mehr oder weniger ‚realsozialistischen‘ Gemeinwesen, das eine innerafghanische Fortschrittsfraktion mit Unterstützung der Sowjetunion in Gang gebracht hatte. Am Ende des erfolgreich niedergemachten ‚Nation-Building‘ sowjetischer Machart stand zuerst ein vollends ruinöser Krieg zwischen zuvor verbündeten Kriegsparteien, dann im größten Teil des Landes die Herrschaft einer disziplinierten Moslem-Mannschaft, die ihrem Volk außer den elendesten Lebensverhältnissen vor allem einen großen ideellen Genuss zu bieten hatte: Niemand wird mehr zum Dienst am sozialistischen Fortschritt hin zu einer funktionell durchorganisierten Gesellschaft herangezogen, stattdessen wird im Gehorsam vor dem Allerhöchsten und in Unterordnung unter Stammesautoritäten dahinvegetiert – Freiheit statt Sozialismus auch „am Hindukusch“. Mit der Vernichtung des Refugiums für antiamerikanische Terroristen, zu dem die Taliban-Herrschaft sich in der Folge entwickelt, heben die USA allerdings nicht bloß ein Verbrechernest aus – der vollständige Erfolg in dieser Hinsicht steht im Gegenteil noch aus –. Mit der Zerstörung des Kombinats aus religiösem Wahn, überkommener Stammessitte und einheitlich kommandierten bewaffneten Kräften, mit dem die geistlichen Oberhäupter der Taliban für so etwas wie ein Gewaltmonopol in dem Land gesorgt hatten, wird vielmehr ein ziemlich wüstes Neben- und Gegeneinander regionaler Herrschaften freigesetzt, die ihrerseits auf Waffengewalt, vorpolitischer Stammesloyalität nebst religiöser Moral sowie, was die materielle Basis ihrer Macht betrifft, auf einer „politischen Ökonomie“ der Opium-Produktion und des Schwarzhandels mit Autos, Waffen und humanitären Hilfsgütern beruhen: Alles andere als Tabula rasa für eine neue bürgerlich-demokratische Verfassung, wie man sie in Washington, in Berlin und bei der Uno gerne hätte.
Das weiß man dort selbstverständlich auch; und es herrscht zumindest eine gewisse pragmatische Klarheit darüber, was eigentlich Not täte, um aus Afghanistan ein wunschgemäß funktionierendes Staatswesen zu machen. Verlangt ist als Erstes ein unbestrittenes flächendeckendes Gewaltmonopol; also eine in festen Institutionen vergegenständlichte, fürs Überleben der Gesellschaft und den Erfolg der Nation funktionale, allgemein als notwendig anerkannte Staatsmacht sowie eine Politikermannschaft, die – wie gut oder schlecht auch immer – die damit bereits feststehende politische Agenda exekutiert. Die muss zweitens auch etwas zu exekutieren haben, d.h. über eine politische Ökonomie gebieten, die dem regierten Volk eine staatsnützliche produktive Betätigung, einen Lebensunterhalt als erwerbstüchtige Basis der Nation erlaubt und aufnötigt. Ein Volk, das sich aus persönlichen und moralischen Abhängigkeiten löst, so weit die für ein derart funktionelles Staatsleben dysfunktional sind, braucht es schließlich drittens auch noch. Nichts von alledem, das ist den wohlmeinenden Betreuern des Landes klar und insoweit begreifen sie dessen Lage, ist in Afghanistan vorhanden. Also tun sie hin, was sie für die Neugründung einer Staatsgewalt inmitten der Trümmer der alten Herrschaft übrig haben.
Das demokratische Aufbauwerk der ‚Internationalen Gemeinschaft‘
Nämlich als Erstes einen Präsidenten, der schon mal symbolisiert, dass für Afghanistan nunmehr das goldene Zeitalter eines zivilen Gemeinwesens unter einem bürgerlichen Gewaltmonopol angebrochen ist. Da der Mann selbst zunächst über keinerlei eigene Machtmittel verfügt, weder über eine auf ihn eingeschworene Privatarmee wie die anderen Machthaber in seinem Land noch erst recht über so etwas wie einen – geschweige denn durchsetzungsfähigen – bürokratischen Herrschaftsapparat, bekommt er eine Furcht einflößende amerikanische Leibwache gestellt sowie eine internationale Schutztruppe, die die Hauptstadt sowie den Hauptort einer nördlichen Provinz militärisch kontrolliert und den hoffnungsvollen Beginn einer gewaltmonopolistischen Staatsordnung repräsentiert. Deren segensreiche Auswirkungen soll sie gleich mit zur Anschauung bringen, indem sie sich um das eine oder andere zivile Aufbauwerk kümmert, damit die Afghanen merken, was sie von einem allgemeinen Landfrieden hätten. Für einen zivilen Aufbau, die Wiederherstellung brauchbarer ökonomischer Überlebensbedingungen, stehen dem Präsidenten nämlich erst recht keine Eigenmittel zu Gebote. Die 5,4 Milliarden Dollar, die finanzkräftige Gebernationen unter der Rubrik „Afghanistan-Hilfe“ ausweisen, fließen hauptsächlich in Honorare und Spesen für Helfer, Berater und Aufbautrupps, was die Regierung mit verhaltener Kritik quittiert:
„Die Vereinten Nationen haben sicher Großartiges geleistet, aber es ist auch viel vergeudet worden. Und die Gehälter der UN-Mitarbeiter sind zu hoch. Wir möchten gerne, dass unsere Regierung mehr Geld erhält, damit wir selber mehr Arbeitsplätze schaffen können.“ (Wiederaufbauminister Farhang)
Das mit dem „selber mehr Arbeitsplätze schaffen“ ist freilich ein Witz. Für ein nationalökonomisches Aufbauwerk, wie es zuletzt die Sowjetunion mit ihrer Vasallenregierung probiert hat, fehlen alle Voraussetzungen: ein bürokratischer Apparat, der ein solches Programm in Angriff nehmen könnte; die Kontrolle über das Land und die Leute, mit denen es in Angriff zu nehmen wäre; schließlich das Programm selbst – Planwirtschaft soll schließlich nicht einreißen. Und was die alles entscheidende Instanz, den „globalisierten“ Weltmarkt, betrifft: Der hat an afghanischer Arbeitskraft nicht das geringste Interesse und für Waren, die an afghanischen Arbeitsplätzen hergestellt werden könnten, wirklich keinen Bedarf. Opium ausgenommen, mit dem sich sogar die einträglichsten Geschäfte machen lassen; dies allerdings ausgerechnet deswegen, weil sie verboten sind und schon deswegen als Basis einer Nationalökonomie auch nicht so recht in Frage kommen. Da bestehen die politischen Repräsentanten des Weltgeschäfts im Gegenteil darauf, dass die Regierung in Kabul dem boomenden Schlafmohn-Anbau „den Krieg erklärt“ und die einzige wirklich ergiebige Geldquelle lahm legt, aus der vor allem die unbotmäßigen Provinzfürsten ihre Machtmittel beziehen, denen die nominelle Zentralregierung einstweilen gar keine schlagkräftige Zentralmacht entgegenzusetzen hat, an der die Präsidentschaft andererseits, so gut sie kann, selber partizipiert und von der im Übrigen die Masse der Landbevölkerung lebt. Für deren Not zeigen die Herren der Länder, in denen eine funktionierende, zahlungsfähige Zivilgesellschaft so enorm dringend nach Betäubungsmitteln für ihr falsches Bewusstsein verlangt, sogar ein gewisses Verständnis und machen sich in Berlin glatt so ihre Gedanken über eine alternative Produktion: Den Anbau von Weizen für den Eigenbedarf könnte man sich vorstellen – was braucht der Afghane auch sonst zum Leben! –; für den Export kämen so gefragte und ertragreiche Güter wie Safran, wilder Reis und Trockenfrüchte in Frage; auch mit handgeknüpften Teppichen, weiß der deutsche Kanzler, war Afghanistan schon mal erfolgreich. Weil zugleich natürlich niemand im Ernst mit einem ernsthaften Anti-Opiumkrieg rechnet – die eigene Schutztruppe wird vorsorglich explizit für unzuständig erklärt – und schon gar nicht mit einem Erfolg, fließen Hilfsgelder für die Rauschgiftbekämpfung vor allem in die Konstruktion eines Sicherheitskordons um Afghanistan herum, in dem die heiße Ware hängen bleiben soll. Für mehr an materieller Starthilfe für ein neues Afghanistan will die ‚Internationale Gemeinschaft‘ im Übrigen nicht haftbar sein. Das fällige ‚Nation Building‘ sollen die Afghanen letztlich selber erledigen.
Dafür weiß man in der Welt des demokratischen Imperialismus immerhin das Rezept; auf das hat man das Land auch schon längst festgelegt; und in Berlin wird es sach- und kunstgerecht fortgeschrieben: Mehr Demokratie wagen!
Das absurde Ideal freier Wahlen und der reale Machtkampf des Präsidenten
Die Freunde ordentlicher Verhältnisse „am Hindukusch“ wissen aus ihren eigenen politisch gefestigten kapitalistischen Heimatländern, dass Macht und Herrschaft ganz flott und reibungslos funktionieren, wenn die Regierungsämter auf Grundlage einer freien Konkurrenz zwischen gleichermaßen national gesinnten rivalisierenden Parteien und Führerfiguren und nach Maßgabe eines freien Volksentscheids über die vorgestellten Personalalternativen besetzt werden. Dem Rest der Welt, den zu beaufsichtigen sie für ihr Recht und ihre Pflicht halten, treten sie mit dem Anspruch gegenüber, der hätte sich an ihnen ein Beispiel zu nehmen, nämlich von ihnen über die einzig wahre Herrschaftstechnik belehren und ganz nebenbei auch gleich auf den richtigen Gebrauch demokratisch abgesegneter staatlicher Macht festlegen zu lassen. In diesem Sinne haben die maßgeblichen Schutzmächte bereits eine von ihnen zusammengebrachte und gelenkte Versammlung einheimischer afghanischer Stammesautoritäten eine Wahl beschließen lassen, die, wenn sie dann mal ordentlich über die Bühne gegangen ist, überall im Land für Herrschaftsverhältnisse sorgen soll, die nach Wunsch funktionieren. Daran, dass ein wackliges Einvernehmen zwischen Respektspersonen, deren höchst partikulare Macht auf gar nicht bürgerlichen, vorpolitischen persönlichen Abhängigkeiten und frommem Gehorsam beruht, den Beginn einer funktionierenden Parteien-Demokratie markieren soll, finden die wohlmeinenden Demokratie-Exporteure keinen Widerspruch.
Tatsächlich ist damit alles auf den Kopf gestellt. Wenn eine freie Konkurrenz ehrgeiziger politischer Führungsfiguren um die Macht friedlich vonstatten gehen und für verlässliches, von der Willkür des jeweiligen Machthabers unabhängiges Regieren sorgen soll, wie man es von den erfolgreichen Demokratien her kennt, dann muss es eine durchorganisierte Staatsmacht, um deren Ausübung die Konkurrenz sich dreht, und eine feststehende Staatsräson, um deren optimale Durchsetzung die politischen Kämpfer streiten, schon geben. Eine Methode, solche Verhältnisse einzuführen, sind freie Wahlen nicht, im Gegenteil: Ohne funktionierendes Gewaltmonopol und nationale Agenda gerät die Konkurrenz um Wahlerfolg zu einem Machtkampf mit Bürgerkriegsqualität; denn dann geht es pur um die Inbesitznahme von Machtmitteln durch die siegreiche „Partei“; und die macht mit den eroberten Mitteln ihren Herrschaftswillen zum Gesetz und gerade nicht ein feststehendes kapitalistisches und imperialistisches Gemeinwohl ihrer Nation zur Grundlage ihres regierungsamtlichen Ermessens. Genau das zeichnet sich auch in Afghanistan ab. Die Wahlveranstalter haben es nicht mit ordentlichen, demokratisch gleich gesinnten Parteien zu tun, sondern mit konkurrierenden Clans und Stämmen, die schon bei der Aufstellung der Wählerlisten ihre moralischen Autoritäten und ihre Gewaltmittel mobilisieren, weil damit bereits die Weichen für den Wahlausgang gestellt werden. Für diese „Parteien“ ist die Wahl selbst nicht mehr und nicht weniger als ein weiterer Schauplatz ihres ohnehin andauernden Ringens um die Reichweite ihrer Gewalt, die sie ausschließend gegen ihre Rivalen betätigen und behaupten und auszudehnen suchen und ganz bestimmt nicht als loyale Opposition der Mehrheit unterordnen. Ihr Wahlkampf hat daher auch nichts mit Schattenkabinetten und freiwilligen oder bezahlten Plakatklebern zu tun, sondern ist absehbarerweise ein Stück Bandenkrieg um Einflusszonen und exklusiv verfügbare Gefolgschaft.
Die demokratischen Paten des neuen Afghanistan sehen das freilich locker – oder tun wenigstens so. Von mehr als einem Bündel „organisatorischer Probleme“ wollen sie nichts wissen; und wenn der von ihnen inthronisierte Präsident Karsai die für den Herbst geplanten Wahlen verschiebt, dann halten sie gern an der Fiktion fest, das läge nur an den Wählerlisten, die bis dahin nicht zu vervollständigen wären. Dabei haben sie in Wirklichkeit einen Machtkampf in Gang gesetzt, der sich in gar keiner Hinsicht an ihr demokratisches Drehbuch hält. Der Präsident, den sie in sein Amt eingesetzt haben, den sie an der Macht halten, die sie ihm verschaffen, und auf dessen Erfolg sie setzen, nimmt Zug um Zug den Kampf auf um die Unterwerfung der regionalen und lokalen Gewalthaber; nicht unter eine afghanische Staatsräson, die es gar nicht gibt, sondern unter seine Autorität. Dafür kalkuliert er mit „freien Wahlen“; vor allem aber setzt er darauf, dass er seinen demokratischen Schutzmächten genügend Militär und genügend Milliarden wert ist, dass sie ihn nicht scheitern lassen. Die kalkulieren umgekehrt mit ihm. Und zwar keineswegs so, dass der Einsatz der Isaf-Soldaten Karsais Kampf um die Vormacht im Land entscheiden, geschweige denn überflüssig machen könnte oder sollte.
„Im Petersberg-Abkommen von 2001 war eine Ausdehnung der Isaf-Mission auf das ganze Land zwar ausdrücklich vorgesehen, aber der dafür veranschlagte Bedarf an Soldaten und Mitteln war so abschreckend hoch, dass niemand ernsthaft darüber nachzudenken wagte.“ (FAZ,1.4.)
Stattdessen richtet die Truppe sich ein zwischen städtischen Trümmerwüsten und punktuellem Aufbau, verbotenem Opiumanbau und gewaltsam ausgetragenen Rivalitäten aller ambitionierten Machthaber im Land – alles viel zu wenig für den Geschmack deutscher Schreibtisch-Imperialisten von der ‚Spiegel‘- bis zur ‚ARD-Weltspiegel‘-Redaktion. Doch um das, was die sich unter einem ‚Nation Building‘ durch die Nato vorstellen, geschweige denn um das, was der vom Westen inthronisierte Präsident in Kabul sich von seinen europäischen und amerikanischen Paten erhofft, geht es denen ganz einfach nicht.
Das Ringen verbündeter Imperialisten um wechselseitige Funktionalisierung
Die Großmächte, die ihre „Freiheit am Hindukusch verteidigen“, folgen mit ihrem Militäreinsatz einer imperialistischen Rechnung der höheren Art, in der Afghanistan nur als exemplarischer Schauplatz fungiert und der nominelle Staatschef als Schachfigur.
Die USA führen ihren Antiterrorkrieg gegen die zählebigen Überreste der Taliban-Herrschaft und des antiamerikanischen „Netzwerks“ im Land; was sich dort sonst noch abspielt, begutachten und behandeln sie als nützliche oder hinderliche Bedingung für ihre Kampfeinsätze und deren Erfolg. Von ihrem Geschöpf in Kabul erwarten sie Ordnungsdienste, von der Isaf, dass sie deren Effekt gewährleistet.
Den EU-Mächten, die die Isaf-Truppe im Wesentlichen stellen – schon wieder Deutschland in vorderster Front –, geht es im Grunde gar nicht darum, sich in die inner-afghanischen Machtkämpfe, als vielmehr darum, sich in Amerikas Antiterrorkrieg einzumischen. Sie wollen auf keinen Fall abseits stehen, wenn die USA in Zentralasien die erste Front in ihrem Jahrhundert-Feldzug eröffnen. Dabei wollen sie sich aber genauso wenig als „willige Helfer“ dem Kommando der Supermacht unterordnen und für deren Belange verschleißen lassen. Deswegen unterstützen sie die Kampfaktion „Enduring Freedom“ nur mit minimalen Kräften und konzentrieren sich darauf, daneben mit einer gleichfalls auf Dauer angelegten Staatsgründungs-Initiative, die viel diplomatischen Einsatz, einiges Geld und etliche Soldaten fordert, eine eigenständige europäische Zuständigkeit für die strategischen Verhältnisse in Zentralasien zu etablieren, mit einem eigenen, selbst definierten und von der Uno abgesegneten Auftrag. Aus ihrer relativen militärischen Schwäche machen sie dabei in mehrfacher Hinsicht eine politische Tugend. Sie versuchen gar nicht erst, sich in Sachen effektiver Kriegführung und „Befriedung“ des Landes mit den USA zu messen, überlassen denen in dieser Hinsicht das alleinige Kommando, aber auch die ganze Last – und profitieren zugleich vom Kampfeinsatz der Truppen des großen Verbündeten. Denn was sie sich an eigenständigen Ordnungsaufgaben zurechtlegen und mit ihren knapp 6000 Mann in Angriff nehmen, ist nur deswegen kein Witz, sondern ein respektabler Eingriff und lässt sich nur deswegen auf dem gewählten Niveau durchhalten, weil Amerika mit seiner Abschreckungsmacht präsent ist, mit seinem Kleinkrieg gegen die falschen Fundamentalisten einen offenen Aufruhr gegen das Regime in Kabul und dessen Schutztruppe unterbindet und mit einer Mischung aus Drohung und Kumpanei die Provinzfürsten und Milizführer im Land zumindest dazu bringt, einigermaßen stillzuhalten. Die ‚pax americana‘, die die USA über den ersten Schauplatz ihres Jahrhundert-Feldzugs gegen „den Terrorismus“ verhängt haben und mit ihrer kriegerischen Präsenz aufrechterhalten, fordert die Europäer zu militärischer Einmischung heraus und ermöglicht ihnen zugleich ein Mitmischen an Amerikas zentralasiatischer Front auf eigene Rechnung und trotzdem mit äußerst überschaubarem Kräfteeinsatz; eine Einmischung, mit der sie dem US-Krieg und -Kriegskommando nicht in die Quere kommen, sich aber auch nicht dienstbar machen; einen Einsatz, der den Amerikanern für ihren fortgesetzten Kleinkrieg wenig erspart und trotzdem einen Beitrag darstellt, den Washington nicht umhin kann zu würdigen – eine interessante Neuauflage des in 40 Jahren gemeinsamen „kalten Krieges“ praktizierten Dienstbarkeits- und Ausnutzungsverhältnisses zwischen der Nato-Führungsmacht und ihren europäischen Partnern…
Mit dieser deutsch-europäischen Politik des maximalen imperialistischen Ertrags bei minimalem Aufwand an militärischer Gewalt sind die Amerikaner wiederum durchaus nicht zufrieden. Sie machen ihren Verbündeten die umgekehrte Rechnung auf: Was die in Afghanistan leisten, hat zu wenig den Charakter eines abrufbaren Hilfsdienstes, ist dafür nämlich einerseits zu eigenmächtig definiert und andererseits vor allem viel zu gering dimensioniert, als dass die Nato-Führungsmacht sich dadurch wunschgemäß entlastet sehen könnte. Die drängt daher im Rahmen ihrer Allianz auf viel mehr frei abrufbare europäische Beiträge und möchte bei den Verbündeten durchsetzen, dass deren Afghanistan-Einsatz zum Vorbild, aber nicht zur Alternative für eine neue Strategie der Allianz wird – für einen Irak-Einsatz z.B., dem durchaus weitere folgen sollen; schließlich hat Washington einen Weltkrieg fürs gesamte 21. Jahrhundert angesagt und eingeleitet.
So gerät die neuartige Vorwärts-Verteidigung der westlichen Freiheit „am Hindukusch“ tatsächlich in einem doppelten Sinn zur Bewährungsprobe für die amerikanisch-europäische Bündnispartnerschaft. Es geht nicht bloß um den möglichst eindrucksvollen praktischen Nachweis, dass diese Allianz in der Lage ist, antiamerikanische Partisanen, Freischärler und Terroristen auszumerzen und gleichzeitig ein zerstörtes, in unkontrollierte Teilmächte zerlegtes Land unter die Kontrolle einer aus eigener Kraft einigermaßen haltbaren und dabei vollständig hörigen – eben: demokratischen – Zentralregierung zu bringen. Es geht dort auch schon wieder, und schon wieder exemplarisch, darum, ob und wie, von wem und für wen die Nato sich als Instrument für „Frieden schaffende“ Kriege in aller Welt einsetzen lässt. In genau gegensätzlichem Sinn geht es der Führungsmacht auf der einen, den Vertretern des „europäischen Pfeilers“ auf der anderen Seite um den Nutzen und mittlerweile auch schon um den Fortbestand, um „Sein oder Nicht-Sein“ der Allianz: Amerika will den Pakt als Instrument, um seinen ambitionierten Mit-Imperialisten Aufgaben zuzuweisen und Lasten aufzuerlegen; die Europäer wollen genau umgekehrt Amerikas Übermacht für sich ausnutzen, nämlich als Basis für eigene imperialistische Einmischungsmanöver, und in diesem Sinn Einfluss auf sie gewinnen; durchaus mit dem Endziel, sich von ihrer Abhängigkeit allmählich frei zu machen.
So kommt Afghanistan zu der Ehre, die Deutschlands rot-grüne Spitzenpolitiker dem smarten Präsidenten des Landes in Berlin erweisen: Das Land fungiert als ein Austragungsort, der Präsident und seine Bevölkerung als Material für die Konkurrenz der imperialistischen Nationen auf beiden Seiten des Atlantik, die in zunehmendem Maß das vom einstigen großen „Störenfried“ Sowjetunion befreite Weltgeschehen beherrscht.
Demokratie für alle:
Zynismus und Zielstrebigkeit des demokratischen Imperialismus heute
Die Führer mächtiger kapitalistischer Nationen, die sich berufen fühlen, die Staatenwelt zu ordnen, haben fremde Souveränität noch nie besonders respektiert. Was sie bzw. von ihnen ausgestattete und ermutigte regierende oder auch oppositionelle Parteien und Figuren in anderen Ländern angerichtet haben, belieben sie mittlerweile in etlichen Fällen als „staatlichen Fehlschlag“ – ‚failing states‘ – zu definieren. Mit dieser Kennzeichnung schreiben sie einen Haufen Mitglieder ihrer ehrenwerten „Völkerfamilie“ als ernst zu nehmende staatliche Gebilde und Teilhaber ihrer kapitalistischen Weltwirtschaft ausdrücklich ab; zugleich schieben sie die Schuld an der kompletten Untauglichkeit der betreffenden Länder für jeden nützlichen Gebrauch den ortsansässigen Potentaten mitsamt ihrem unbrauchbaren Fußvolk zu; sich selber erklären sie für berechtigt, die verheerenden Kollateralschäden ihrer Weltordnung und ihrer ordentlich geschützten globalen Wirtschaftsweise – das vielerorts flächendeckend grassierende Elend, die Verwahrlosung ganzer Völker und die Geschäftsunfähigkeit ganzer Staatsgebilde – gegebenenfalls den Fernsehkameras umtriebiger Reporter und der allgemeinen Mildtätigkeit zu überlassen. Dies erst einmal grundsätzlich vorausgesetzt, behalten die Herren der Länder, in denen man immer die ganze Welt als Einsatzfeld für eigenes Kapital und eigene Gewalt im Auge hat, es sich vor, bei Bedarf, nämlich wenn sie einen solchen verspüren, aktiv zu werden und einem derart desolaten Land eine nationale Neugründung – ein ‚Nation Building‘ – zu verordnen.
Wenn sie sich dazu entschließen, dann gehen sie nach einem Muster vor, das den entschiedensten Zugriff auf das betreffende Staatsgebilde mit der entschiedensten Ablehnung jeder Verantwortung für dessen Überlebensfähigkeit – von der seiner Bevölkerung ganz zu schweigen – verbindet: Sie installieren eine Obrigkeit, statten sie mit ein bisschen militärischem und finanziellem Startkapital aus, weil die Länder selbst eine in ihrem Sinn funktionierende Herrschaft gar nicht hergeben, und verlangen von ihrem Geschöpf gar nicht viel – nur das Unmögliche: Es hat dafür zu sorgen, und zwar im Prinzip aus eigener Kraft, dass der „fehlgeschlagene Staat“ trotzdem, auch ohne alle weiteren Mittel, funktioniert; zumindest insoweit, dass störende Umtriebe wirksam unterdrückt werden und das Elend daheim bleibt. Mit dem gebieterischen Wunsch nach Demokratie spitzen die Auftraggeber diese Forderung dahingehend zu, dass der verlangte Ordnungsdienst gefälligst reibungs- und kostenlos zu funktionieren hat; dadurch nämlich, dass das gottergeben vor sich hin vergammelnde Volk Gelegenheit erhält, seine Überwachungsmannschaft immer wieder in aller Freiheit zu bestätigen. Dieser Zynismus einer Fremdherrschaft, nämlich einer Herrschaft allein in fremdem Interesse, aber im Namen des ruhig gestellten Volkes genießt weltöffentlichen Beifall, weil der Ehrentitel „Demokratie“ sowieso jeden Gedanken an deren Realität erschlägt – auch und gerade da, wo er nichts anderes bezeichnet als Imperialismus zum Nulltarif.
Die „Verhältnisse“, in die sie auf diese anspruchsvolle Art eingreifen, enthalten für moderne Weltordner „fallspezifisch“ besondere Herausforderungen. Da wird in einem Fall der Auftrag an eigene Kreaturen, eine gewährte Autonomie im Sinne der gewährenden Instanz wahrzunehmen, eigenmächtig falsch verstanden, und die Europäer müssen dem „übertriebenen“ Nationalismus der Kosovo-Albaner eins aufs Dach geben. Anderswo löst die staatsähnliche Ordnung sich völlig in Bandenkriegen auf, und eine kleine Kolonialarmee muss hin, um auf Haiti den drohenden Flüchtlingsstrom an der Quelle zu stoppen. Afghanistan ist wieder ein anderer Fall; da ist ein erfolgreich geförderter antikommunistischer Gotteskrieg der Kontrolle seiner Auftraggeber entglitten; ein gewaltsamer Rückruf war nötig; nun müssen die Trümmer des zerstörten Gemeinwesens wieder so zusammengefügt werden, dass eine Wiederholungsgefahr ausgeschlossen ist; und das kann nur von außen geschehen. Mit welchem Aufwand die Hüter der Weltordnung da jeweils zu Werk gehen, bleibt allerdings ebenso Sache ihres freien Ermessens wie die Entscheidung, einen der sowieso dauernd anfallenden Katastrophenfälle ihrer schönen Weltordnung überhaupt als Herausforderung ihrer Weltordnungskompetenz zu definieren – Schwarzafrika z.B. ist ihnen nicht so arg viel Einsatz wert. Für ihre entsprechenden Beschlüsse nehmen sie aneinander Maß: Wie sie sich im Verhältnis zu ihresgleichen „positionieren“, wenn sie dieses tun und jenes lassen; ob und inwieweit sie den paar anderen staatlichen Aktivisten ihrer kapitalistischen Weltordnung Vorgaben machen können oder den von denen gesetzten Fakten hinterherlaufen müssen; wie viel Einfluss auf den Gewalthaushalt der Welt sie einander abzuringen vermögen – das sind so die Gesichtspunkte, an denen sich der Übergang von der Diagnose ‚failing state‘ zum ‚Nation Building‘ entscheidet. Wenn Amerika Eingriffstatbestände definiert und sich zu Interventionen herbeilässt, dann folgt es sowieso auch da in erster Linie den strategischen Erfordernissen seines neuen Feldzugs für eine von Antiamerikanismus gereinigte Welt; dabei hat es stets vor allem seine wichtigsten Geschäftspartner und rivalisierenden Verbündeten im Visier und legt es darauf an, die als Hilfskräfte einzubinden und von konkurrierender Einflussnahme fern zu halten. Umgekehrt tun die das Ihre, um sich mitentscheidend und zunehmend alternativ in die Weltordnungsmanöver ihrer verbündeten Supermacht einzuschalten und in deutlicher Differenz, auch schon in Gegensatz zu dieser Problemfälle selber zu definieren und Zuständigkeiten zu etablieren.
Ob also ein staatlicher „Fehlschlag“ überhaupt als Betreuungsfall gewürdigt, welches Gewicht ihm beigelegt und wie mit ihm umgesprungen wird, das richtet sich zuerst und zuletzt danach, wie sehr und inwiefern er von den USA und den ambitionierten Führungsmächten der EU als ein Fall für ihre Konkurrenz – auf der einen Seite um Beherrschung des Kräfteverhältnisses in der Staatenwelt, auf der andern Seite um mehr Einfluss darauf – wahrgenommen und benutzt wird: ein Zynismus, der nicht zufällig an die Art und Weise erinnert, auf die der seinerzeit geeinte „Westen“ an Nebenkriegsschauplätzen und mit „Stellvertreterkriegen“ seinen „kalten“ Weltkrieg gegen die Sowjetunion durchgefochten hat. Damals allerdings konnten aufstrebende „3. Welt“-Länder sich von ihrem Stellenwert innerhalb dieser großen Konfrontation wenigstens manchmal noch von der einen oder der anderen Seite eine Unterstützung erhoffen, die sie vor dem Schicksal eines ‚failing state‘ bewahrte. So freigebig sind die rivalisierenden Imperialisten des 21. Jahrhunderts beim Genuss der weltpolitischen „Friedensdividende“ ihres gemeinsamen Sieges über die Sowjetmacht nicht mehr.