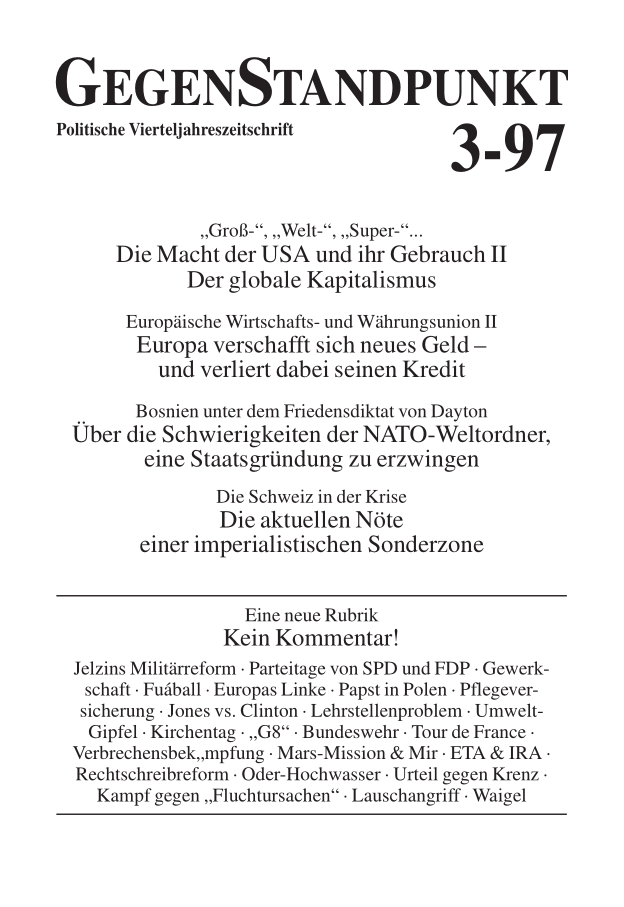Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (II)
Europa verschafft sich neues Geld – und verliert dabei seinen Kredit (Teil 2)
Seit Maastricht etablieren die europäischen Nationen unter deutscher Führung ein gegenseitiges Kontroll- und Einmischungsregime. Damit verbieten sie (sich) so manche gewohnte Kalkulation und Wirtschaftsweise im Vorgriff auf die neue Währung. Dass die Stabilität der beteiligten Währungen sich nicht als Voraussetzung herstellen ließ, darf kein Hindernis sein.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (II)
Europa verschafft sich neues Geld – und verliert dabei seinen Kredit (Teil 2)[1]
Das Unbehagen an der „Stabilitätskultur“
Mit ihren Kriterien will die EU aller Welt ihre Entschlossenheit vor Augen führen, ein stabiles Geld zu erzeugen. Zugleich relativiert sie mit den erst noch zu erfüllenden Bedingungen den Willen, den Schritt zum europäischen Geld zu vollziehen – kein Wunder also, daß die Zweifel an der Einführung der neuen Währung zum festen Bestandteil des täglichen Berichts zur Lage der Nation geworden sind.
Das Kunststück, das die europäischen Regierungen vollbracht haben, sucht in der Finanzgeschichte seinesgleichen. Als Gemeinschaft verordnen sie sich als Mitgliedern einen Test – auf ihre Fähigkeit, ihre nationalen Finanzen so zu ordnen, daß sie den Ansprüchen einer harten Währung genügen. Als souveräne Regierungen sind sie mit dem Beweis beschäftigt, daß sie „es schaffen“. Damit der Euro „kommt“.
Im Vorgriff auf die künftige Einheitswährung haben sie den Standpunkt der einen europäischen Wirtschaftsmacht eingenommen – und sich als gegenwärtig amtierenden Standortverwaltern das Mißtrauen ausgesprochen. Durch Korrekturen an ihrem finanzpolitischen Gebaren haben sie den Beweis zu liefern, daß sie aufgrund der Verfassung ihres Geldwesens einen Beitrag zur Tauglichkeit des Euro gewährleisten. An den aktuellen Abweichungen ihrer Statistiken von den geforderten Prozenten haben sie ein Maß für die Leistungen, die sie zur Herstellung von Vertrauen in ihr Geldwesen erbringen müssen.
Die Regierungen verfügen in ihren europäischen Partnern über tüchtige Kontrolleure, die im Namen des gemeinschaftlichen Ziels unablässig alle Staaten des Bündnisses nach dem Grad ihrer Euro-Tauglichkeit beurteilen. Auch an diese Veranstaltung hat sich die europäische Öffentlichkeit gewöhnt, obwohl sie geeignet ist, sowohl den am Projekt maßgeblich wie passiv beteiligten Nationalisten als auch den Idealisten der europäischen Sache jeglichen Geschmack an der Währungsunion auszutreiben.
a) Mit der Verabschiedung der Satzung von Maastricht ist keine europäische Nation aus der Konkurrenz entlassen. Nach wie vor muß sich jedes Land im innereuropäischen Außenhandel ebenso wie in seinen Beziehungen zu Partnern außerhalb der Gemeinschaft um vorteilhafte Bilanzen bemühen. Und wie bisher gibt der Verlauf der Konkurrenz den Standort-Inhabern Aufschluß darüber, ob und in welchem Maß sich das grenzüberschreitende Geschäft für sie gelohnt hat, ob es die nationale Geldmacht gestärkt oder im internationalen Vergleich gemindert hat.
Deswegen waren auch die Daten, aus denen in Maastricht Konvergenz-Kriterien verfertigt wurden, schon vorher von Bedeutung. An der relativen Höhe der Verschuldung, an Inflationsraten, an Defiziten des nationalen Haushalts, an Veränderungen des Wechselkurses lesen die Wirtschafts- und Finanzminister nämlich ab, wie groß der Anteil am weltweiten Reichtum ist, über den sie gebieten. Solche Rechnereien sind die unvermeidliche Konsequenz des national-ökonomischen Auftrags, den die politische Herrschaft der freien Wirtschaft ihres Standorts erteilt. Deren private Geschäftserfolge, die durch mehr oder minder rentable Anwendung des nationalen Kreditgeldes zustandekommen, entscheiden über den Inhalt der staatlichen Kassen. Sie zählen als Beitrag zur nationalen Finanzkraft, die sich in den einschlägigen Positionen der staatlichen Kontenführung ausweist. Umgekehrt treten die Daten, die den jeweiligen Zustand des Nationalkredits kennzeichnen, den mit ihrem Gelderwerb befaßten Wirtschaftssubjekten als handfeste Bedingungen ihrer Konkurrenz gegenüber. An Größen wie Inflation, Zinsen und Wechselkursen, die in die Rechnungen jeder Firma eingehen und manche Kalkulation korrigieren, bemerken Privateigentümer allemal, daß sie einem wirtschaftlichen Kollektiv, dem nationalen Kapital, angehören. Und die Ministerien für Wirtschaft und Finanzen addieren die Leistungen der Konkurrenz zu einem National-Produkt zusammen, welches als Quelle des staatlichen Haushalts in Anspruch genommen wird. Dieser ist keine bloße Bilanz des gelaufenen Geschäfts, sondern das Instrument der Politik, mit dem sie dem künftigen Wachstum auf die Sprünge hilft.
Daß der Staat die Gestaltung des Haushalts kraft hoheitlicher Gewalt vornimmt, ist eine Sache. Daß er mit der Festlegung von Land und Leuten auf „Marktwirtschaft“ auch sich selbst den Geboten des Geldes unterwirft, ist die andere. Seine „volkswirtschaftliche Gesamtrechnung“ zeugt deshalb keineswegs von Willkür; die Betreuung seines Standorts, auf dem die Konkurrenz um die Privatmacht des Geldes tobt, ist eine Frage der Geldmittel, über die er verfügt. Die politische Zurichtung der Gesellschaft zu einem Ensemble von Geschäftsbedingungen, zu jenem famosen „Rahmen“, der das Wachstum von Kapital ermöglicht, hat ökonomisch ein schlichtes Maß und Ziel: Es geht der Nation um die Verfügung über Geld. Erstens über viel, zweitens über gutes – welche Qualität einen Vergleich des nationalen Kreditgeldes mit dem konkurrierender Nationen ausdrückt.
Deswegen nimmt jede Entscheidung, durch die der Staat eine Maßnahme zur Wahrung, zur Verbesserung oder Herstellung von Geschäftsbedingungen ergreift, die Form einer Güterabwägung an. Aufgrund ihrer Kosten ist jede Staats„funktion“ eine Schmälerung der Mittel, steht zu anderen Notwendigkeiten im Gegensatz, so daß der Aufwand für anerkannte Staatsaufgaben mit ihrer Wirkung rechtfertigt werden muß. Im Streit um den richtigen Haushalt, um das angemessene Verhältnis von Kosten und Wirkung – um die Effizienz der Politik also – stellt sich regelmäßig heraus, wieviel „Staat“ die Marktwirtschaft nötig hat – so viel nämlich, daß die Einnahmen der Nation für die fälligen Aufgaben nie reichen. Mit Blick auf den Schaden, den Ordnung und Wachstum im Falle von Versäumnissen der Politik nehmen, erfolgt die Finanzierung – von Hochschulen und Autobahnen, Grenzschutz und Parlament… – per Kredit. Der wird nach den Regeln der Marktwirtschaft verzinst, gerät unversehens zum Sachzwang und läßt der Politik das Sparen angelegen sein. Denn die Bedienung der Staatsschuld nimmt die Einnahmen in Anspruch und macht für die Erledigung der Staatsfunktionen neue Schulden unausweichlich. Die Finanzpolitik ist damit befaßt, deren Effizienz zu gewährleisten, was gar nicht so einfach ist. Denn eine Wirkung zeitigt die Vermehrung der Staatsschuld allemal: Sie macht sich als Inflation bemerkbar, die den Benützern der nationalen Währung als Beschränkung ihres Besitzes, ihrer internationalen Kaufkraft zu schaffen macht – auch dem Staat selbst. Die andere Wirkung – auf ihre Finanzierung ist die Staatsschuld berechnet – heißt Konkurrenzfähigkeit des Standorts; sie stellt sich über die Rentabilitätsvergleiche der Kapitalisten auf dem Weltmarkt ein oder auch nicht. Im Falle erfolgreicher Förderung des nationalen Kapitals winkt dem Kredit der Nation der Zuspruch der Finanzmärkte, weil die auf der Suche nach Geld sind, das zu besitzen sich lohnt. Dieses Interesse für die Deckung des stets wachsenden Kreditbedarfs der Nation auszunutzen, ist umgekehrt für die Verwalter des Kapitalstandorts selbstverständlich. Eine Geldpolitik, die mit sicheren und zinsträchtigen Anlagen die Märkte bestückt, erzeugt Nachfrage nach dem eigenen Kreditgeld; und sie zeugt davon, daß der Staat in seiner Anstrengung, das nationale Kapital zu mobilisieren, nicht nachläßt. Allerdings steht er mit seinen Angeboten in Konkurrenz zu denen der anderen Nationen. Alle Offerten des nationalen Kreditgeschäfts unterliegen dem prüfenden Vergleich der internationalen Finanzwelt – daraufhin, ob die Währung ein verläßliches Geschäftsmittel ist. Die Spekulation sucht nach Beweisen für die dauerhafte Effizienz der Staatsschuld. Diese Beweise in ihren Haushalten zu erbringen, ist jede Nation bemüht: Der kapitalistische Staat, angewiesen auf die Erhaltung der Brauchbarkeit seines Kreditgeldes für Geschäfte mit und in aller Welt, schreibt – weil er sein Geld selbst unsicher macht – seiner Finanz- und Geldpolitik stets auch das schöne Ziel der Geldwert-Stabilität ins Programm.
Die Erinnerung an den Normalbetrieb kapitalistischer Volkswirtschaften macht deutlich, worin die Neuerung besteht, die mit den Maastricht-Beschlüssen in die Haushaltsrechnung der Euro-Nationen Einzug gehalten hat. Mit der Bezifferung von Stabilität
haben sich die Haushaltsvorstände auf ein Ziel festgelegt, das ihren gewohnten Berechnungen äußerlich ist und quer zu ihnen steht. Die Länder, die gleich nach der Festlegung der Kriterien zur Selbstdisziplin in Haushaltsdingen übergingen, hatten bis dato jedenfalls eines nicht im Sinn: die Verletzung irgendwie gültiger Grenzwerte, an denen die Gesundheit ihres Finanzwesens zuschanden wird. Einerseits war ihnen beim kontinuierlichen Schuldenmachen immer auch das Sparen und die Bekämpfung der Inflation geläufig; auch nach dem passenden Zinsniveau haben sie gesucht. Andererseits galten ihre diesbezüglichen Anstrengungen eben so anerkannten Zielen wie „Wachstum & Beschäftigung“, Exportquoten, „Modernisierung des Standorts“ etc. Ihre Finanzpolitik nahm dabei manche der Nachteile, der „negativen Effekte“ der Staatsverschuldung – so wie sie der geldpolitische Sachverstand auch kennt – in Kauf; weil sie schlicht die Bewirtschaftung der Finanzen als eine der Mobilisierung nationaler Kapitalkraft verpflichtete Aufgabe versah, wobei das höchste und letzte Ziel der Stabilität als Resultat zu erreichen war. Diese „Eigenschaft“ des nationalen Geldwesens ist in der kapitalistischen Geschäftsordnung der Lohn dafür, daß sich ein Standort auf dem Weltmarkt bewährt.
Die Maastricht-Kriterien greifen in die nationalen Programme, die dem jeweiligen Standort Erfolg auf den „Märkten“ und darüber dem jeweiligen Geld die Anerkennung „der Märkte“ verschaffen wollen, empfindlich ein. (Vgl. Teil 1) Quasi unter Berufung auf die recht unterschiedlichen Resultate der Konkurrenz geben sie sich nicht mit dem Urteil der Märkte
zufrieden, das mancher Nation Sorgen bereitet. Mit den Soll-Werten ergeht ein politisches Gebot an die europäischen Geldhüter, das die Kontrolle der Gemeinschaft
an die Stelle der Strafe bzw. des Lohnes der Märkte setzt. Dabei sind die in Prozenten formulierten Vorschriften, verbunden mit der Forderung nach fristgemäßer Erfüllung, eine einzige Absage an die Konkurrenzbedürfnisse der instabilen Nationen. Nichts ist verlogener als die wiederholte Beteuerung, daß die „(Wieder-)Herstellung von Stabilität“ ohnehin im Interesse der betroffenen Staaten läge, also so oder so die Konsequenzen von Maastricht fällig gewesen wären. Denn der Imperativ, der auf Reduktion von Schulden, Inflation, Zinsen dringt, gestattet den Einsatz dieser Größen als Hebel für die Aus- und Aufrüstung des Standorts nicht mehr. Da wird nicht gefragt, was eine Nation sich im Umgang mit ihrem Kredit leisten kann und will, sondern beschlossen, was sie sich nicht leisten darf. Mit dem Fahrplan von Maastricht wurde das innereuropäische Recht auf Einmischung in die Haushaltsführung der Partner etabliert. Wahrgenommen wird es erstens in der sorgfältigen Registrierung der Zahlen, die aus den europäischen Hauptstädten gemeldet werden; zweitens in der Prüfung der Zuverlässigkeit dieser Meldungen; drittens dadurch, daß man zu vorläufig endgültigen Urteilen darüber schreitet, wer sich die Teilnahme an der Währungsunion verdient hat bzw. es nicht schafft. In einer ersten Phase dieser Veranstaltung war diese Pflege des Gemeinschaftsgeistes unter Nationen in einer Hinsicht noch recht übersichtlich: Die Aufteilung zwischen denen, die sich der Rolle des Richters annahmen, und den anderen, die von der deutschen Stiftung Euro-Test untersucht wurden, war geregelt.
b) Mit ihrer Unterschrift unter den Maastricht-Vertrag hat eine Reihe von Nationen ein Geständnis abgelegt und Besserung versprochen. Zu bereinigen war die unsolide Haushaltsführung. Und obwohl zwei der Kriterien ein Verhältnis von Schulden und Wirtschaftswachstum geltend machen für die Definition von „Stabilität“, ist niemand auf die Idee verfallen, die Gemeinschaft hätte ihren Mitgliedern Wachstum verordnet und „Konvergenz“ bestünde darin, daß die zu kurz gekommenen Nationen ab sofort reicher zu werden hätten. Die Kriterien wurden auf Anhieb richtig verstanden; aus dem Befund, da hätten die meisten im Verhältnis zu dem, was sie verdient haben, zu viel Schulden gemacht und mit ihrem instabilen Geld die Quittung dafür gekriegt, haben die Regierungen ihre Konsequenzen gezogen. Seitdem wüten sie im nationalen Sozialbereich herum, präsentieren Erlöse aus Privatisierungen, die immer auch – wg. unrentabel – Reduktion von Geschäften einschließen; sie schichten Reserven im Staatsschatz um, verkaufen Staatsbesitz, erhöhen Steuern und führen – wg. Stabilität – neue ein usw. – und das alles, um eine Bilanz vorzuweisen, die den Prozenten der europäischen Satzung genügt. Mit ihrem Tatendrang strapazieren sie den Zuspruch ihres Wählervolks erheblich, so daß in dem überall ein Gemurmel anhebt: „Nur für und wegen Europa fordert die eigene Führung Opfer!“ Sie rechtfertigen ihre Maßnahmen mit den Vorzügen der Zugehörigkeit zum Euro-Club: „Das Geldverdienen der Nation und in ihr nimmt mit der Teilnahme an der Währungsunion seinen Aufschwung, draußen zu bleiben, wäre ein enormer Schaden!“ Schließlich landen sie in ihrer Buchführung ungefähr, fast schon oder echt bei den Beitrittskriterien. Zufriedenheit kommt auf über die vollbrachten Leistungen…
Nicht aber bei der Prüfungskommission. Die rechnet jede Stelle hinter jedem Komma nach, begrüßt die „Stabilitätsdisziplin“ grundsätzlich und meldet ihre Bedenken an. In den Fällen, wo es mit den Zahlen hapert, sowieso; merkwürdigerweise aber auch dann, wenn die Werte satzungsgemäß ausfallen. Die Argumente, mit denen Bonn vor allem die Mittelmeerpartner traktiert hat, haben zwar in deutschen Landen viel Beifall hervorgerufen; eine Öffentlichkeit, die stolz auf die deutsche Geldmacht ist und ihr Zustandekommen auf die Tüchtigkeit ihrer Kreditverwalter zurückführt, spricht diesen Stabilitätskünstlern eben auch das Recht zu, anderen Regierungen auf die Finger zu sehen. Dennoch hätten die Fanatiker europäischer Stabilität unter deutscher Anleitung bemerken können, daß die Vorbehalte der damaligen Periode gegen die sich abzeichnende Erfüllung der Kriterien bereits ein regelrechter Anschlag auf den Euro und das Vertrauen waren, das die Deutschen doch so streng und vorbildlich sicherstellen wollen.
Wer die Vollzugsmeldung einer Partnernation in Sachen „Kriterien“ mit der Forderung beantwortet, die löbliche Selbstbeschränkung hätte aber auch dauerhaft
zu sein; wer damit zu Protokoll gibt, daß die Maßnahmen des auf Beitritt abonnierten Landes eigentlich gar nicht die geforderte Stabilität herbeigeführt haben; wer seine Nachbarn auch noch ausdrücklich bezichtigt, die verlangten Ziffern durch bloße Manipulation, durch kreative Buchführung
hingekriegt zu haben – der verschlechtert nicht nur das „Klima“ zwischen den einheitswilligen Europäern, die in solchen Sprüchen allemal die Unterordnungsbemühungen entdecken, die sie am Projekt selbst übersehen. Wer schließlich satte zwei Jahre vor dem Stichtag mit der kategorischen Botschaft aufwartet: „Italien kommt nicht rein“, demonstriert seinen „stabilitätsorientierten“ Auslesewillen, der von den Maastrichter Prozentzahlen auf seine Weise nichts hält. Die Gefechte jener glanzvollen Jahre des stabilen deutschen Trios, bestehend aus Kanzler, Finanzminister und Bundesbank, erfüllten den Tatbestand eines frühen Dementis: In ihrem Eifer haben die Herren des deutschen Geldes eingestanden, daß die Prozente samt ihrer Erfüllung gar keine verläßlichen Gradmesser für ökonomische Stabilität sind; in ihrem offensiven Führungsgeist haben sie die Unzuverlässigkeit der ökonomischen Definition ausgeplaudert, die sie selbst konstruiert haben. Diese Manier, von den Kriterien „abzugehen“, hat freilich niemanden interessiert.
c) Dafür waren andere Fragen auf dem Tisch. Wenn einerseits eine Reihe von Ländern die Erfüllung der Kriterien gar nicht hinkriegt; wenn andererseits die höchstförmliche Präsentation satzungskonformer Haushaltsabrechnungen keinen Beitrag zur Euro-Stabilität verbürgt – wer kommt dann noch für die Währungsunion in Frage? Lohnt sich die Schaffung eines europäischen Geldes, das nur von einer Minderheit von Nationen getragen und als das ihre benützt wird? Hat ein solcher Kredit den Kredit, den ein Weltgeld braucht, das in seiner Attraktivität die internationale Geschäftswelt vom ersten Tag an betören soll? Sollte man die Sache nicht lieber noch einmal überdenken?
Die Antwort auf die wachsende Euroskepsis ist von denen gekommen, auf deren Strenge in Stabilitätsdingen solche Fragen gemünzt sind. Deutschland hat „in aller Deutlichkeit“ das Projekt verteidigt und dabei zugleich die Alternative ausgeschlagen, die sich Freunden eines europäischen Einheitsgeldes so langsam aufdrängte. Die Rede ist von wohlmeinenden Zeitgenossen, die ihren ökonomischen Sachverstand zu der Erkenntnis bemühten, daß „Stabilität“ doch unmöglich mit einer Stelle hinter dem Komma stehe und falle. Solche Überlegungen verstehen deutsche Geldhüter, auch wenn sie vom wichtigsten Partner Frankreich kommen, sofort als Antrag auf einen weichen Euro
; und solches „Abgehen“ von den Kriterien verbieten sie sich energisch.
Die Zurechtweisung der beiden Lager, die sich in einem halben Jahrzehnt europäischer „Stabilitätskultur“ herausgebildet haben, geht souverän über die Bedenken hinweg, die den Hauptmachern des Projekts unter Berufung auf die Maastrichter Konstruktion entgegenschlagen. Dabei fällt auf, daß die Vertreter des entweder kein Euro oder kein stabiler
keinen Gedanken auf das Wunder verschwenden, das da mitten im Kapitalismus durch staatliche Einteilungskünste vollbracht werden soll. Immerhin wird im Konzept der Währungsunion dem Haushalten ganz ohne kapitalistisches Wachstum – was unter anderen Umständen jeder Wirtschaftsjournalist als Zeichen von Not erkennt – die Leistung zugeschrieben, zuerst in mehreren Nationen das Geld zu sanieren und dann auch noch eine gemeinsame Währung, die es noch gar nicht gibt, „stabil“ zu machen. So interessiert es auch weder die Anwälte des „entweder“ noch die des „oder“, daß die Verpflichtung auf Haushaltsdisziplin gar nicht anders befolgt werden kann als durch die „Schönrechnung“ der Schulden, die schon unterwegs sind. Spiegelbildlich dazu bemühen sich die deutschen Vorkämpfer des Euro, den Rest der Welt daran glauben zu lassen, daß das europäische Geld durch die Erfüllung der „Stabilitätskriterien“ bedingt sei. Allerdings bezieht sich ihr eigener Glaube weniger auf den Wahrheitsgehalt des ökonomischen Gesetzes „wenn 3%, dann Geld stabil“; er gilt der Funktion, die die „Stabilitätskultur“ erfüllt. Sie ist weiterhin, nach ihren Erfolgen gewogen, ein feines Beitrittskriterium; als Eingeständnis der Partner, statt über gutes Geld nur über schlechte Schulden zu verfügen, bewirkt sie immerhin, daß sich die wackligen Kreditgelder nicht auch noch vermehren und in der großen Umtauschaktion zu zusätzlichen Euros werden. So ist sie letztlich doch eine vertrauensbildende Maßnahme für die Einheitswährung.
Was die Souveränität in der Zurückweisung von Bedenkenträgern angeht, die den Konstrukteuren und Vollstreckern von Maastricht ein Dilemma anhängen möchten, so besteht sie vor allem in der Kunst, den Leuten rechtzugeben. Wer fragt: „Wollt ihr denn den Euro immer noch?“ – der kriegt die Auskunft: „Natürlich, und jetzt erst recht, wo wir in ganz Europa schon so viel für ihn getan haben!“ Für Zweifler, die zum Beweis der Ernsthaftigkeit ihres Anliegens das Risiko für Deutschland und sein Geld ins Feld führen, steht der Zusatz bereit, daß es – nicht etwa „um Europa geht“, sondern – gerade Deutschland zugute komme, wenn die Währungsunion kommt. Wer fragt: „Weicht ihr etwa von den Stabilitätskriterien ab, bloß weil ihr einen Euro wollt?“ – dem wird beschieden: „Auf keinen Fall!“ Kohl und seine Parteigänger lassen keinen Zweifel daran, daß sie längst über die kleinliche, am vermeintlichen oder wirklichen Wortlaut des Maastricht-Vertrags klebende Prüfung hinaus sind, ob genug Nationen ihre Kommastellen fristgemäß in Ordnung gebracht haben. Zum Beweis können sie Gewichtiges vorweisen: Die Widerlegung des Verdachts, sie würden Land und Leute mit einer Währung ins Unglück stürzen, die nichts, jedenfalls nicht so viel wie die Mark, taugt, haben sie in einem
Stabilitätspakt
gründlich vorgenommen. Mit diesem schon wieder auf deutsche Initiative zustandegekommenen Vertrag hat es die Gemeinschaft erst einmal abgelehnt, das öffentlich beschworene Szenario – ihr Projekt fällt den in Maastricht beschlossenen Bedingungen zum Opfer – als ihr akutes Problem zu akzeptieren. Leute, die schon Jahre zuvor gewußt hatten, wer keine Chancen auf Mitgliedschaft besitzt, lobten die Stabilitätsbeflissenheit aller Europäer und betonten, daß erst 1998 nachgezählt und entschieden werde. In dieser Phase der Euro-Politik hatten plötzlich wieder alle ihre Chance, und das Problem bestand darin, dem Euro – der kommt! – seine Stabilität „dauerhaft“ zu sichern. Ganz nebenbei wurde da von den Urhebern der WWU klargestellt, daß auch sie nicht glauben, was sie immerzu – ganz ökonomisch-fachmännisch – behauptet hatten: daß die neue Währung dadurch gutes Geld wird, daß die beteiligten Nationen ihre Haushalte an den Maastrichter Prozenten ausrichten. Auf die schlichte Feststellung, daß das Euro-Geld um so prächtiger gerät, je mehr Geschäfte mit ihm in Europa und von Europa aus gemacht werden, sind sie aber auch nicht verfallen – im Gegenteil.
Der „Stabilitätspakt“ verordnet den Mitgliedern der WWU schon wieder ein Haushaltsregime, das als „Fortschreibung“ der Maastricht-Kriterien den sparsamen Umgang mit dem gemeinsamen Nationalkredit gebietet. Er geht davon aus, daß die nationale Anwendung des neuen Geldes seine Gefährdung darstellt, und schreibt den Mitgliedern eine Bewirtschaftung ihrer Länder vor, die sich in einer Stärkung des Gemeinschaftsgeldes niederschlägt. Dies auf eine Weise, daß der Fortschritt in Sachen Entzug der Geldhoheit – der diesbezügliche Einstieg erfolgte in Form der Selbstbeschränkung wg. Maastricht – für die nach wie vor konkurrierenden Nationalökonomien gar nicht zu übersehen ist. Unter dem Gesichtspunkt der Geldstabilität werden vorübergehende oder von ökonomischen Fehlschlägen zeugende Bilanzdefizite erneut an einer – diesmal in Dublin ausgeheckten – Kriterienskala gemessen, die solides Wirtschaften definiert. Und zwar zu dem Zweck, Verstöße zu ahnden; denn als solche, als Belastung des Gemeinschaftsgeldes werden negative Ergebnisse in den nationalen Rechnungen behandelt. Nationen, die als Verlierer aus der Konkurrenz hervorgehen, kommen zusätzlich zu ihren Verlusten auch noch in den Genuß, eine Strafe an die Gemeinschaftskasse zu zahlen.
Dem Modell des deutschen Länderfinanzausgleichs ist diese Organisation von Solidarität offenbar nicht nachempfunden. Das Diktat zum pfleglichen Umgang mit dem Kreditgeld Europas macht einerseits deutlich, wie beschränkt der Standpunkt Europas in der Währungsunion verwirklicht ist – in einem gemeinsamen Geld eben, das die Mitglieder als Instrument ihrer nationalen Rechnungen nützen und mit dem sie in Konkurrenz zueinander, also ausschließend, das Beste aus ihren Standorten zu machen versuchen. Sie sind eben immer noch selbständige Nationalökonomien, also nicht einmal eine „Wirtschaftsunion“, und schon gleich gar nicht Teile einer politischen Union, die – angewiesen auf ihren Beitrag zum Erfolg einer Gesamtbilanz – diesen Teilen auch aus den Mitteln, die der souveränen Führung des Ganzen zu Gebote stehen, Unterstützung sichert.
Andererseits geht aus dem Schutz vor Mißbrauch des Euro, den der Stabilitätspakt gegen die Mitglieder der Währungsunion verhängt, hervor, wie nachdrücklich der Standpunkt des einen Europa mit Hilfe des gemeinsamen Geldes verfolgt wird. Die im Namen der „Stabilität“ des Euro, die ja alle wollen und brauchen, bemühte Begründung – es müsse verhindert werden, daß Mitgliedsstaaten zu jener fatalen Finanzpolitik zurückkehren, durch die sie bis Maastricht ihren eigenen Nationalkredit ruiniert haben, damit sie jetzt nicht den gemeinsamen schädigen – ist eine Sache. Angesichts dessen, was der Verdacht, gewisse Nationen fänden an verkorksten Haushalten und instabiler Währung notorisch Gefallen, begründet, nehmen sich solche Argumente eher wie ein Vorwand aus. Sie stehen für die Einführung eines Regimes der Gewährung und des Verweigerns von Geldmitteln; eines Regimes, das zentral und unter Berufung auf den „Pakt“ über die Berechtigung des nationalen Bedarfs entscheidet, das die haushaltspolitischen Berechnungen der Mitgliedsstaaten relativiert und über die Zulässigkeit der Maßnahmen richtet, die ihr Standort für seine Bewährung in der Konkurrenz nötig hat. Dies ist im übrigen die Bedeutung der immer wiederkehrenden Rede, mit der gewisse Europakenner – Helmut Schmidt hat sich da hervorgetan – aufwarten, weil sie die „ökonomischen“ Argumente für falsch, kleinlich und wenig überzeugend finden: Der Sinn des Euro bestehe weniger in der Befolgung eines ökonomischen „Sachzwangs“ als in einem politischen Ziel, für das er als Instrument taugt. Eine gewisse Bestätigung erfährt dieser Befund in der Person von Helmut Kohl. Der hat sicher – genau wie seine beredten Mitstreiter – keine blasse Ahnung davon, was eine Währung ist; aber die Chance, über den Zirkus, für den ganze Kommissionen von Sachverständigen unsachliche Vorteilsrechnungen erfinden, den Zugriff auf ganze europäische Volkswirtschaften zu kriegen, dürfte er kapiert haben. Daß als nächstes dann eine wirkliche Wirtschaftsunion und die politische dazu ins Haus steht, ist ihm nämlich auch schon geläufig. Dazu ist ja – wenn das Regime des Euro erst einmal in Kraft ist – „nur“ noch die Einsicht der beteiligten Nationen vonnöten, daß sie mit solcher auf Euro-Lizenzierung beruhender Konkurrenz nicht gut, mit vollstreckter Einheit dagegen viel besser fahren. Da die Beherzigung dieser Einsicht aber mit dem für Nationen traurigen Beschluß verbunden ist, sich selbst aufzugeben, wissen Europa-Einiger genau, daß sie unter Indienstnahme der mit dem Euro eingerichteten Zwänge ganz viel politische Überzeugungsarbeit leisten müssen. Auch die Einheit will erstritten sein. Aber ohne Streit war ja in der Gemeinschaft nie etwas hinzukriegen.
Bei der Aushandlung des „Stabilitätspakts“ z.B. hat die Betrachtung von Haushaltslöchern, die die neuen Prozentzahlen übersteigen, als – womöglich vorsätzliche – Mißwirtschaft nicht ganz überzeugt. Deswegen mußten die Vertreter des leicht idealistischen Gebots, mit dem gemeinsamen Geld nur gelingende Geschäfte auf den diversen Standorten in die Wege zu leiten – dieses Gebot steckt ja in der Bestrafung von mißratenen Bilanzen! –, die Satzung leicht ändern. Die gestrengen Anwälte des Bußgeldes für selbstverschuldeten Geldmangel haben zugestanden, daß manchmal volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen nicht wegen Versagen der Regierungen mißraten, sondern die Not eine Folge der Umstände sein kann. Daher gibt es jetzt in der Satzung einen Fall, in dem die Staaten als Opfer einer Rezession gewürdigt werden, wenn bei ihnen Wachstum und Schulden nicht zusammenpassen. Dieses ökonomische Phänomen ist in Prozenten des Schwundes definiert, den das Bruttosozialprodukt in einem bestimmten Zeitraum erleidet – so daß dann künftige Kommissionen die allen Sachverstand fordernde Aufgabe haben, bei Pleitewellen zwischen „Schuld der Regierung“ und Konjunkturschicksal zu unterscheiden.
Weniger Fortune dagegen hatte eine vom großen Partner Frankreich vorgebrachte Überlegung. Verlangt war von der Gemeinschaft, die gerade im Begriff war, ihr gemeinsames Geld zu planen, eine Berücksichtigung der Rezession, deren Opfer zur Zeit alle sind. Der Antrag ging auf die Verwendung der gemeinsamen Kassen, die es schon gibt, zugunsten einer Überwindung des kritischen Zustands der nationalen Kapitalismen, den Regierungen seit längerem mit Mangel an Beschäftigung gleichsetzen. Er wurde abgelehnt, und zwar ganz im Geiste des gerade ausgehandelten Stabilitätspakts. Mit der klaren Unterscheidung zwischen Gemeinschaftsaufgaben – die bestehen eben in der Kontrolle der Haushaltsdisziplin für das neue Geld und unter ihm – und „Hausaufgaben“ – darunter fallen die Bemühungen, den eigenen Standort in Schuß zu halten – machten Kohl und Waigel alles klar. Um ihren Gemeinschaftsgeist zu unterstreichen, wiesen sie darauf hin, daß ein gesamteuropäisches Beschäftigungsprogramm schon wieder Beiträge in gemeinsame Fonds erforderlich mache; das sei von Deutschland nicht zu erwarten, zumal es mit dem überkommenen Fondswesen demnächst ohnehin sein Ende haben müsse. Ganz nebenbei wurde eine Beschwerde über überdimensionierte deutsche Nettozahlungen laut, die sich nicht etwa den Proportionen deutscher Geldmacht verdanken, sondern einem ungerechten Schlüssel. So waren für alle, die es wissen wollten, die Weichen gestellt für die Veränderungen, die mit dem Übergang von der alten zur neuen Euro-Geschäftsordnung angesagt sind. Mit ihrem Standort und seinem Inventar konkurrieren müssen alle schon selbst; die „Gemeinschaft“ regelt dafür das Geldwesen und seine Verfügbarkeit für die Mitglieder, nach Stabilitätsgesichtspunkten.
Damit die „Gemeinschaft“ das kann, bekam sie eine europäische Zentralbank (EZB), die einerseits für alle zuständig ist, aber für keinen da. Mit der politischen Unabhängigkeit
dieses Instituts hat es nämlich nicht die ideologische Bewandtnis, die für die Nationalbanken charakteristisch ist. Diese staatlichen Behörden sind mit allerlei Aufgaben beauftragt, die Geldpolitik heißen. Gegen Ansprüche – sei es aus der eigenen Gesellschaft oder aus dem Ausland – an die Regierung, per Geldpolitik etwas zu ändern, die diese zurückweisen will, beruft sie sich auf die Eigenständigkeit der Nationalbank, die per Gesetz ihren eigenen Codex und unantastbare Befugnisse hat. Für Ansprüche der Regierung hält dieser Codex aber durchaus manch nützliche geldpolitische Unterstützung offen; die Nationalbank ist gut für internationale Zinsschlachten sowie Auf-/Abwertungen, sie greift den Konjunkturpolitikern unter die Arme und steuert Gewinne zur Deckung des Haushalts bei. Diese Rolle für die monetären Belange des Staates und als Instrument der Regierung erfüllt die EZB zunächst einmal für kein Mitglied der Währungsunion; so daß auch die Geldpolitik – was immer sie den Nationen an vermeintlichen, vorübergehenden oder echten Diensten für die Standortkonkurrenz geleistet hat – den am Euro beteiligten Staaten entzogen ist. Um sich das supranationale Amt nutzbar zu machen, müssen sich die Regierungen schon die Entscheidungsbefugnis, ein kleineres oder größeres Stück Zuständigkeit für diese Behörde und in ihr erwerben. Was schon immer und jetzt erst recht für alle europäischen Institutionen gilt.
Der doppelte Schutz vor schädlichem Gebrauch des Euro ist dasselbe wie eine Entmachtung der Einzelstaaten zugunsten der Bewirtschaftung Europas als Domäne eines politischen Standortbetreuers und Währungshüters, den es aber immer noch nicht gibt. Die Ausschaltung des innereuropäischen Nationalismus, der in Gestalt der verschiedenen Souveräne nach wie vor sein Recht besitzt, gebietet die höchstförmliche Regelung der Kompetenzen. Also die Organisation einer „Entscheidungsstruktur“, die verhindert, daß der Standpunkt der Einheit am Partikularismus zuschanden wird. Die Gemeindeordnung, die das leistet, will erstritten sein – den Partnern ist schließlich die Zustimmung zu manchem Souveränitätsverzicht abzuringen. Wem die Kompetenzen auch zufallen, wem sie entzogen werden – eins steht fest: Die politische Verteilung der Macht in Europa leitet sich – so ist das in Wirtschaftsfragen – aus den ökonomischen Potenzen ab, die die einen „einbringen“ und die anderen brauchen. Und in dieser Hinsicht waren die schwarz-rot-goldenen Mustereuropäer stets zuversichtlich. Bis sie neulich von „Maastricht“, über das sie sich längst hinaus wähnten, wieder eingeholt wurden.
3. Die Tücken des Projekts
Das war geplant: Eine multinationale Währungsreform zur Einschränkung und schließlich zur Beendigung der innereuropäischen Konkurrenz. Diese Veranstaltung sollte so durchgezogen werden, daß die Teilnehmerstaaten durch ihre Haushaltsdisziplin zunächst ihre Kreditgelder in den Zustand der „Stabilität“ versetzen, um dem Einheitsgeld, in das die Gelder ein- und übergehen, die fraglose Anerkennung und Brauchbarkeit zu verleihen, die eine Währung zum gefragten Geschäftsmittel in aller Welt macht.
Das kam heraus: Der ausgeprägte Beitrittswille hat sich in vielen Nationalfarben betätigt, aber sein Ziel nicht erreicht. Die Werte, die sich die Gemeinschaft selbst als Gradmesser für die Verläßlichkeit ihres als Kredit umlaufenden Reichtums verordnet hatte, sind nicht erreicht worden. Das mag seinen Grund darin haben, daß der Fiskus eine schlechte Adresse ist, wenn Nationen nach einem Garanten für Stabilität suchen – die auf einen soliden Euro erpichten Regierungen haben darauf bestanden, die von ihnen für unabdingbar gehaltenen nationalen Vorleistungen zu bringen. Sie haben sich wechselseitig damit beauftragt, das Programm zur Herstellung stabiler Gelder fortzusetzen, und damit die Unterordnung ihrer Haushaltsführung unter die Anforderungen des künftigen Gemeinschaftsgeldes bekräftigt. Dem Umgang mit den leidigen Kriterien haben sie auf das Entscheidungsjahr 1998 vertagt und sich gewisse Relativierungen vorbehalten – dafür wurde gleich ein ganz gewissenhaftes Hantieren mit der Gemeinschaftswährung vereinbart.
Und dann ist es passiert, noch im Jahr des Stabilitätspakts, der die Disziplin in Sachen Kreditbewirtschaftung als bleibendes Gebot in die Zukunft fortgeschrieben hat: Die Nation, deren Geld sich in Jahrzehnten europäischer Gemeinschaft jenes Gütesiegel stabil
erworben hat, von dem es deswegen – obwohl viel – nicht zuviel gibt, wird geständig. Ihre Haushaltsführung, die ausweichlich des guten Geldes solide gewesen sein muß, blamiert sich. Erstens dadurch, daß sie sich in bezug auf die Erfüllung der offiziellen Beitrittskriterien mit denselben Problemen konfrontiert sieht wie zuvor nur zweitklassige Partner der Union. Zweitens dadurch, daß sie diese Probleme auf eine Art zu bewältigen sucht, die zuvor von ihr selbst als „kreative Buchführung“ gegeißelt worden ist. Damit ist plötzlich klar, daß die „Instabilität“ im europäischen Geld- und Haushaltswesen nicht nur in den berüchtigten Schuldenstandorten zu lokalisieren ist; sie ist auch in dem Land zu Hause, für das der „Beitritt“ nie eine Frage gewesen ist.
Das hat die Zweifel daran, ob „der Euro kommt“, auf ein neues Niveau gehoben. Denn in diesem Fall geht es nicht um die bange Frage einer Nationalmannschaft, die sich sorgt, ob sie es schafft. Deutschland hat schließlich in dem ganzen Projekt eine Sonderstellung gehabt:
- An seiner starken D-Mark bestand kein Zweifel, der deutsche Kredit bildete eine sichere Bank in der Herstellung des neuen Geldes;
- am deutschen Vorbild der Haushaltsbilanz nahm die EU deshalb auch ein bißchen Maß, als es um die „Definition von Stabilität“ ging;
- mit dem gesicherten Stabilitätsbeweis im Rücken ist Deutschland in der Gemeinschaft als Kontrollmacht über die Partner aufgetreten; es hat immerzu ihre Leistungen auf Euro-Tauglichkeit geprüft – und war damit nach außen der respektable Bürge für das Gelingen des Unternehmens.
Kurz: An der Untadeligkeit des deutschen Haushaltens, an der Makellosigkeit deutscher Bilanzen hängt das ganze Vertrauen, das dem Euro im Verfahren seiner Herstellung verschafft werden muß, da er schließlich zum Beweis seiner Qualitäten kaum in der Lage ist, solange es ihn noch nicht gibt. Nun ist zu den nur bedingt wirksamen Anstrengungen der wackligen Kandidaten, das in sie gesetzte Mißtrauen zu beheben, am deutschen Geld und durch die Politik des deutschen Finanzministeriums Vertrauen kaputt gegangen.
Interessant an der Affäre, aber auch folgerichtig, ist die Reaktion, die sie bei Beteiligten und Betroffenen hervorruft. Während bei den europäischen Regierungen, die bislang von Bonn Zensuren erhielten für ihre dem Euro verpflichtete Sparpolitik, verhaltene Erleichterung aufkommt – man rechnet damit, daß der Beitritt nun wohl nicht so streng gehandhabt wird; während die Zeitungen des europäischen Auslands leichte Häme andeuten in bezug auf die deutschen Schwierigkeiten, zugleich aber Sorge bekunden über die Schwäche der „Lokomotive“ Europas, ist im DM-Land einiges los. Allerdings hütet man sich da eingedenk der Führungsrolle, die Deutschland nun einmal einnimmt in Europa, der Frage „Schaffen wir es?“ größere Bedeutung beizumessen. Die Regierung steht auf dem Standpunkt, daß widrige Daten kein Grund dafür sind, sich nach ihnen zu richten, weil sie die passenden Zahlen nicht „zur Kenntnis“ zu nehmen hat, sondern herbeiregieren muß. Der demonstrativen Zuversicht, alles in den Griff zu bekommen, steht jedoch der tägliche Bericht über die Lage der Nation gegenüber, der von Pleitewellen und mehr Arbeitslosen, wachsenden Steuerausfällen etc., schließlich von immer neuen „Haushaltslöchern“ kündet. Der kritische Zustand des Standorts wird einerseits wie immer zum Material demokratischen Opponierens, das der Regierung glaubwürdig Versagen vorwirft und seinen Beitrag dazu leistet, das so dringend benötigte Vertrauen in die Herren der deutschen Geldmacht zu untergraben. Andererseits mehren sich die Stimmen – und zwar gewichtige: sie kommen selbst aus der Abteilung „Führung und Leitung“ –, die angesichts der herrschenden Instabilität die „fahrplangemäße“ Fortsetzung des Euro-Projekts für unmöglich, für gefährlich, also für nicht wünschenswert halten.
Mit mehr oder minder stichhaltigen Argumenten weisen da Amtsträger und Professoren, die sich keinesfalls als „Euro-Gegner“ abstempeln lassen wollen, nach, daß der Euro weich wird, falls man ihn in der geplanten Manier und zum vorgesehenen Zeitpunkt einführt. Manche betonen mehr, daß er für Deutschland unzuträglich ausfällt. Und vereinzelt finden sich auch Leute, die das ganze Unterfangen ablehnen und eine währungspolitische Katastrophe an die Wand malen.
An der Replik der Regierung und ihrer Parteigänger fällt erst einmal auf, daß sie den Plädoyers, die auf „lassen“ oder „aufschieben“ lauten, vor allem ihren Willen zum Euro und seiner fristgemäßen Einführung entgegensetzen. In öffentlichen Auseinandersetzungen findet immer häufiger der groteske Schlagabtausch zwischen zwei Parteien statt, von denen die eine die Fähigkeit (Deutschlands, der EU) bezweifelt, angesichts der Lage einen stabilen Euro hinzukriegen. Worauf die andere ihre Entschlossenheit zur Schau stellt und die Zweifler mit dem Argument zurückweist, sie würden die Stabilität der Gemeinschaftswährung zerreden
. Daß sie damit bezeugen, wie grundsätzlich ihr künftiger Nationalkredit zu einer Frage des Vertrauens geworden ist, das sie der Welt abverlangen, macht ihnen offenbar keine Sorgen. Verräterisch auch das einzige Argument, das ihnen zu stechen scheint, um die Beweise der Bedenkenträger zu entwerten. Wenn diese mit Hinweisen auf Kosten, fällige Transferzahlungen Deutschlands, sichere Währungsturbulenzen etc. kommen, widerlegt das Regierungslager nicht etwa diese finstere Sicht der Dinge; die Anwälte des „Durchziehens“ kontern mit der Beschwörung eines Szenarios, das eintritt, wenn sie den Euro absagen bzw. aufschieben. Und was da passiert, ist so ziemlich dasselbe wie das, was die Kritiker mit der Einführung der Währung befürchten: Lauter Kosten und sichere Verwerfungen im europäischen Geldwesen stehen ins Haus. Und mit der Andeutung, daß dann in der EU wieder jeder macht, was er will, wird die Preisgabe jener hochzuschätzenden Errungenschaft von einem halben Jahrzehnt „Stabilitätskultur“ zum größten Verlust erklärt: Das über die Währungsreform – nämlich durch die sie herbeiführende Satzung – institutionalisierte Aufsichtswesen geht flöten.
So ist es auch gar nicht erstaunlich, daß die „Märkte“ so langsam anfangen, den Verlust europäischen Kredits zu befürchten, zu registrieren und zu bestätigen. Mehr als gleichermaßen vertrauensschädigende Alternativen haben die Organisatoren der Währungsunion bis auf weiteres nämlich nicht zu bieten.
[1] Teil 1 ist in GegenStandpunkt 2-97, S.137 erschienen. 1. Der Aufbruch / Die Weiterentwicklung des Binnenmarktes
/ Die Selbstkritik am Binnenmarkt: ebenso radikal wie inkonsequent / 2. „Stabilität“: Die Verpflichtung der Nationen auf die Macht des Euro-Geldes / Vom Herstellen einer stabilen Währung für Europa / …