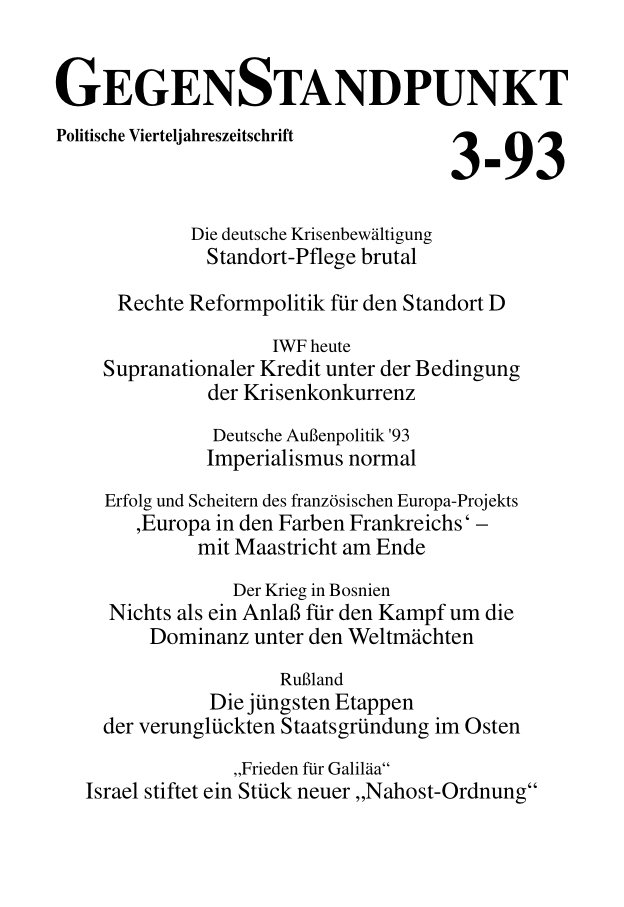Deutsche Außenpolitik ’93
Imperialismus normal
Deutschland verfolgt das Ziel, seine weltweiten Interessen eigenständig durchzusetzen und abzusichern, was ein ganzes Programm umfasst: den zweckmäßigen Zugriff auf den Weltmarkt mit einer flexiblen Eingreiftruppe gewaltsam garantieren zu können; dafür die Nato zu instrumentalisieren; daneben eine eigenständige EU-Militärmacht ohne die USA auf den Weg zu bringen; den beanspruchten Status als Ordnungsmacht durch einen ständigen Sitz mit Vetorecht im UN-Weltsicherheitsrat anerkannt zu bekommen; mit der Menschenrechtswaffe den Anspruch auf Kontrolle anstelle von Benutzung geltend zu machen; mit dem Eintreten für ruinöse Reformen in Russland für das Ende von dessen Macht einzutreten; per Osterweiterung deutsche Kontrolle über Osteuropa zu erlangen; damit und im Zuge der fortgesetzten Einigung Europas die eigene Führungsrolle in Europa zu stärken; und weltweit fremden Protektionismus abzuwehren und ihn aus Eigennutz selbst zu betreiben.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Sicherheit für einen freien Weltmarkt
- Kleiner Exkurs zum ganz normalen Militarismus[2]
- Die Reform der NATO
- Eine europäische Sicherheitsidentität
- Einen ständigen Sitz mit Vetorecht im Weltsicherheitsrat der UNO
- Respekt vor den Menschenrechten in der 3. (4., 5., …) Welt
- Den Erfolg der Reformen in Rußland
- Freien Welthandel
- Die Einigung Europas
- Die Erweiterung der EG nach Osten
- Fazit
Deutsche Außenpolitik ’93
Imperialismus normal
Was will Deutschland in der Welt?
Diese Frage wird derzeit häufiger gestellt. Meist leitet sie Klagen über eine angebliche Konzeptionslosigkeit der Bonner Außenpolitik ein. Nicht bloß Sozialdemokraten lassen sich mit diesem Vorwurf vernehmen; auch Sympathisanten der regierenden Koalition und sogar vor allem deren eigener rechter Flügel hätten es gern ein bißchen deutlicher.
Dieser Unzufriedenheit setzen der Außenminister und sein Kanzler eine Konzeption entgegen, die denkbar konservativ anmutet: Deutschland will das führende Weltwirtschaftsland bleiben, das es ist, und dafür den Weltmarkt intakt halten; es will den Weg der europäischen Einigung weitergehen; es will den Freundschaftspakt mit den USA wahren und die Nato weiterentwickeln; es will den östlichen Nachbarn und den Russen beim Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft helfen; darüber will es die Entwicklungsländer nicht vergessen; es will in der UNO mitmachen, was die Völkerfamilie beschließt; kurzum: Das neue Deutschland will nach allen Seiten Wohlwollen verströmen. Das alles ist erstens dermaßen nett und zweitens dermaßen unglaubwürdig, daß sich die Nachfrage nach einer ernsthaften weltpolitischen Konzeption zu Recht nicht bedient sieht. Schließlich beschwört die Regierung selbst fortwährend eine derart neue „Lage“, daß im Grunde nichts mehr weitergeht wie bisher; sie selbst verwirft Techniken wie Ergebnisse der verflossenen 40 Jahre Außenpolitik, wenn sie von einer unabweisbaren Notwendigkeit spricht, „endlich normal“ zu werden. Also wird sie von ihren kritischen Freunden ein wenig befragt, wie sie das denn alles meint; wie sie z.B. den Weltmarkt und Deutschlands Exportweltmeisterschaft sichern will und gegen wen; was für eine europäische Einigung sie anstrebt; welchen Auftrag die Nato kriegen und die Nation von der UNO übernehmen soll; wie man sich die Sanierung Osteuropas denkt; usw.
Das sind alles, man merkt es gleich, sehr wohlwollende Nachfragen, die die bedingungslose Gutartigkeit der deutschen Einmischung ins Weltgeschehen nicht in Zweifel ziehen, die Lüge von der moralisch einwandfreien Absicht als der Substanz deutscher „Verantwortung in der Welt“ teilen, dabei aber eine Verlegenheit verraten: Die schönfärberischen Phrasen, die die regierenden Politiker in ihren „Prioritätenkatalogen“ aufsagen, gestatten keinen eindeutigen Durchblick mehr auf die gemeinte Sache; in dem Sinn stimmen sie nicht mehr. Bis vor 2, 3 Jahren war klar, daß „Europa“ für Freizügigkeit des Kapitals und Durchsetzung der D-Mark als maßgebliche Europa-Währung stand und was dafür zu tun war; daß „Friedenssicherung im Bündnis“ Frontstaataufgaben für die BRD und deutsche Anrechte auf amerikanischen Schutz bedeutete; daß mit dem Eid auf weltweiten Freihandel die Bereitschaft erklärt wurde, im Einvernehmen mit den USA und zu den gegebenen Bedingungen mitzukonkurrieren; daß der Ruf nach „Demokratie und Menschenrechten für Osteuropa“ die Ausnutzung und gleichzeitige Zersetzung des Sozialistischen Lagers meinte; usw. Diese Eindeutigkeit ist weg. Und wenn die Regierung dennoch an den alten Sprachregelungen festhält und auf kritische Fragen, was sie denn „eigentlich“ will, so auserlesene Erläuterungen gibt wie die, Deutschland werde auf alle Fälle „berechenbar“ bleiben, dann ist schon mal soviel sicher: Verlogen bleibt die deutsche Weltpolitik wie zu Genschers Zeiten; aber sonst geht nichts so berechenbar weiter wie in den vergangenen Jahrzehnten.
Offen bleibt die Frage aber keineswegs, was Deutschland „eigentlich“ will. Was die Führung im Auge hat, wenn sie die alten Aufgabenkataloge hersagt, wird allmählich schon klar – übrigens auch für die kritische Öffentlichkeit, die sich gleichzeitig über mangelnden Klartext beschwert und ersatzweise lauter gute Taten vorschlägt, die das neue Deutschland in der Welt verrichten sollte. Was da angeregt wird – die EG auf die Disziplin der D-Mark festlegen und zum gesamteuropäischen „Ordnungsfaktor“ machen; den Mißbrauch militärischer Gewalt weltweit bekämpfen; den Partnern ihren Protektionismus im Welthandel abgewöhnen; in die Dritte Welt mehr Menschenrechte als Entwicklungshilfe exportieren; Jelzin stützen und auf sein Land aufpassen… –, das entspricht nämlich durchwegs genau der weltpolitischen Linie, der die Bonner Politik tatsächlich folgt, ohne daß vorab eine ausgefeilte „Konzeption“ zur Diskussion, geschweige denn zur Volksabstimmung gestellt worden wäre. Ein gar nicht überraschender Konsens; denn offenbar handelt es sich um Vorhaben, die für eine Nation wie die deutsche in ihrer gegebenen Lage tatsächlich einfach fällig sind – normal eben, oder wie es der Außenminister so nett formuliert:
„…nach außen gilt es etwas zu vollbringen, woran wir zweimal zuvor gescheitert sind: im Einklang mit unseren Nachbarn zu einer Rolle zu finden, die unseren Wünschen und unserem Potential entspricht“ – das hätten Wilhelm und Adolf also auch schon probiert?! (Kinkel, FAZ 19.3.93)
In diesem Sinne will Deutschland also in aller Bescheidenheit: – Sicherheit für einen freien Weltmarkt – eine Reform der Nato – eine europäische „Sicherheitsidentität“ – einen Sitz im Weltsicherheitsrat der UNO – mehr Respekt vor den Menschenrechten in der 3. (4., 5., …) Welt – „erfolgreiche Reformen“ in Rußland – einen freien Welthandel – die Einigung Europas – die Erweiterung der EG nach Osten
Sicherheit für einen freien Weltmarkt
Dieses Ziel steht im Prioritätenkatalog der deutschen Außenpolitik ganz obenan. Und zwar erklärtermaßen schlicht deshalb, weil die Nation dieses Ding braucht, um zu bleiben, was sie ist: eine der drei ganz großen Weltwirtschaftsmächte. Die tiefere Bedeutung des Attributs „frei“ in Verbindung mit einer Veranstaltung so voller Sachzwänge wie dem Weltmarkt wird darüber auch gleich klar: Es steht für die Erfolgsbedingungen, die die politischen Chefs der DM-Wirtschaft in der ganzen Welt für sich in Anspruch nehmen.
Was zu deren Sicherung zu unternehmen ist: Darüber denken im neuen Deutschland nicht bloß Finanzexperten und Außenhandelspolitiker nach, sondern auf ihre Art ganz intensiv Militärs, deren Bundeswehr dreieinhalb Jahrzehnte lang nichts als den Sieg über die Rote Armee zu proben hatte. Denen ist nach dem Golfkrieg der Amerikaner eingefallen, auch auf sie könnte der Befehl zukommen,
„die Vorbeugung, Eindämmung und Beendigung von Konflikten jeglicher Art, die Förderung und Absicherung weltweiter politischer, wirtschaftlicher, militärischer und ökologischer (!) Stabilität, die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des Zugangs zu strategischen Rohstoffen“ (so oder so ähnlich in zahlreichen Dokumenten; hier aus einer Expertise des Verteidigungsministeriums über „Militärpolitische und militärstrategische Grundlagen und konzeptionelle Grundrichtung der Neugestaltung der Bundeswehr“, Januar 92)
in die Hände zu nehmen. Ihre Vorschläge, wie das deutsche Militär entsprechend umzubauen und vorzubereiten wäre, werden beherzigt,[1] haben vereinzelt aber auch den Verdacht der Kompetenzüberschreitung und der Abweichung von den ausgemachten Aufgaben der Bundeswehr auf sich gezogen. Ungerechterweise; denn mit solchen Vorschlägen und Vorbereitungen ziehen sie bloß ihre standes- und auftragsgemäßen Schlußfolgerungen aus dem, was die zivilen Außenpolitiker bei jeder Gelegenheit als weltpolitische Staatsräson Deutschlands vorbuchstabieren. Das fängt regelmäßig an mit dem Verweis auf die weitverzweigten „Lebensadern unserer Wirtschaft“: Was Deutschland darstellt, das beruht auf dem andauernden Erfolg eines Geschäftslebens, das mehr oder weniger alle Länder auf dem Globus in sein Instrumentarium einbezieht. Die Nation hängt also davon ab, daß den Machern ihrer Wirtschaft der kapitalistisch zweckmäßige Zugriff auf aller Herren Länder gesichert ist und bleibt. Sie ist daher auf systemkonformes Wohlverhalten der Herren aller dieser Länder angewiesen; insbesondere wenn deren eigene nationale Bilanzen unter dem Geschäftsverkehr mit Deutschland leiden, muß darauf Verlaß sein. Abhängigkeit wiederum ist gleichbedeutend mit einem berechtigten Anspruch auf Kontrolle über die Politik der anderen Staaten: Im Maße ihrer Interessen muß die Nation die Bedingungen in den Griff kriegen, von denen sie abhängt; und was sie so existentiell braucht, das definiert sie als ihr Recht. Die ansonsten anerkannte Souveränität ihrer Partner kann sie daher nur bedingt gelten lassen.
Damit ist ein Gewaltapparat gefordert, der Durchsetzungsfähigkeit nach außen gewährleistet. Freie Verfügung über Waffengewalt ist kein abweichendes Verhalten in der zivilen und demokratischen Staatenwelt – die deutschen Politiker, die darauf pochen, bezeichnen ihr Bedürfnis danach mit allem Nachdruck als normal, ganz ohne jedes Erschrecken darüber, was sie damit dem Normalfall demokratischer Weltpolitik attestieren, und haben Recht. Anormal ist es höchstens, wenn sie in ihrer Agitation für den ganz normalen Militarismus jeden Skeptiker bezichtigen, er wolle „schon wieder“ einen „deutschen Sonderweg“, wie er „uns schon einmal ins Unglück gestürzt“ habe, also in ihrem Übereifer so tun, als könnten sie glatt Hitlers aufbegehrenden Imperialismus nicht mehr von einer Fehldeutung der deutschen Politik unterscheiden, wonach diese doch auch ohne Kriegsfähigkeit und -bereitschaft zu machen sein müßte. Tatsächlich ist eine Staatenwelt ohne Krieg eine Contradictio in adjecto: Wer Staatsgewalt normal findet, kann nicht gut Kriege anormal finden. Und wer Deutschland als zivile Weltwirtschaftsmacht haben und erhalten will, der macht sich lächerlich, wenn er ehrlich, und unglaubwürdig, wenn er – wie Teile der SPD – heuchlerisch gegen den Aufbau einer weltweit schlagkräftig einsetzbaren Militärmacht eintritt.
Kleiner Exkurs zum ganz normalen Militarismus[2]
Linke Kritik am neu erwachten deutschen Militarismus – soweit es sie noch gibt und sie noch nicht vor den dummdreisten moralischen Überhöhungen des nationalen Grundrechts auf weltweites humanitäres Zuschlagen auf die Knie gefallen ist – operiert mit der Vorstellung, da würden Aggressionen und Eroberungen geplant, weil darum ginge es bei Kriegen allemal. So fühlen sie sich moralisch auf der sicheren Seite; denn das Grenzenverschieben und Beutemachen findet noch jeder bürgerliche Kopf unanständig. Weil deswegen auch kein Staat für seine kriegerischen Einsätze einen solchen Zweck zugibt – selbst Saddam Hussein hatte seine Rechtfertigungen! –, befaßt sich die Kritik mit der Fahndung nach Indizien dafür, daß solche niederen materiellen Beweggründe insgeheim doch vorlägen. Zusätzlich oder – wenn lohnende Beute als Kriegsziel nicht recht auszumachen ist – ersatzweise wird gegen militärisch ambitionierte Diktatoren auf Wahnsinn plädiert; demokratische Staatsmänner müssen sich den Verdacht gefallen lassen, sie wollten „bloß“ ihr Volk von inneren sozialen Problemen ablenken, um wiedergewählt zu werden.
Weltanschaulich gesehen handelt es sich hier um eine Kritik aus dem Geist des zivilen Anstands, der sich aus lauter vorauseilender Wertschätzung für die Demokratie den Glaubenssatz zurechtlegt, diese Sorte Staat mit ihrem stinkbürgerlichen nutzenorientierten Alltagsleben wäre im Grunde das Gegenteil von und unvereinbar mit Imperialismus, Waffengewalt und kriegerischer Zerstörung; passend wären solche Unternehmungen im Grunde bloß für „Unrechtsregime“, die das Erobern und/oder Wahnwitz zu ihrem Programm gemacht hätten. Theoretisch gesehen verkennt dieses wohlmeinende Dogma den eigentümlichen Materialismus, den gerade die zivilen, demokratisch verfaßten, um nichts so sehr wie um ihr Bruttosozialprodukt besorgten Staaten mit ihrem fest institutionalisierten, jederzeit abrufbereiten Militarismus verfolgen.
Alle diese Staaten machen – je nach ihrer Größe – nach außen, gegenüber dem gesamten Rest der Welt, ein widersprüchliches Bedürfnis geltend: Überall soll ordnende Gewalt herrschen und gesittete, zivil brauchbare Verhältnisse garantieren; und überall soll diese nach innen souveräne fremde Gewalt unter Kontrolle bleiben. Diese schlichte Formel umfaßt die Gesamtheit dessen, was man ‚Außenpolitik‘ und ‚internationale Beziehungen‘ nennt – und Krieg als die äußerste Form, den prinzipiellen und latent allgegenwärtigen Widerspruch zwischen fremder Souveränität und eigener Kontrolle auszutragen. Neben den bürgerlichen Materialismus der kapitalistischen Gesellschaft gestellt, von dem der Staat doch lebt und den er als seine Existenzgrundlage schützen und nicht verheizen will, mag sich diese Staatsaufgabe der Kontrolle über andere Souveräne mit ihrem enormen Aufwand an Diplomaten und Soldaten wie eine fremde Welt ausnehmen – gar nicht zivil eben –; tatsächlich folgt sie daraus notwendig. Denn staatliche Kontrollmacht nach außen, im Prinzip über die gesamte Staatenwelt, ist zugleich auch die Existenzgrundlage des zivilen kapitalistischen Lebens einer modernen Nation.
Das wäre anders, wenn der Materialismus der bürgerlichen Gesellschaft wirklich und nicht bloß ideologisch mit dem Wohlergehen der Leute zusammenfiele; dann wäre es in der Tat ein Widerspruch, die auf Wohlstand bedachten Massen und den gesellschaftlichen Reichtum auf Gewaltaktionen zu ver(sch)wenden, um die Gewalthaber über andere Teile der Welt im Griff zu halten oder unter Kontrolle zu bringen. So funktioniert der Materialismus unter den Bedingungen des kapitalistischen Eigentums aber nicht – was freilich keine moralische, sondern eine politökonomische Wahrheit und deswegen auch unter Linken so wenig geläufig ist. Der Materialismus des produktiven Eigentums ist per se eine Gewaltsache; denn er lebt vom und fürs Geschäft, und das Geschäft lebt vom erfolgreichen Kommando des Privateigentums über die Arbeit, die in der Gesellschaft verrichtet wird. Der Erfolg liegt nicht in nützlichen Dingen und Wohlstand für alle, sondern im verdienten und akkumulierten Geld; das sichert das Kommando über Güter und Dienstleistungen der gesamten Gesellschaft, weil es sich in den Händen der Eigentümer sammelt und der Masse der entlohnten Dienstleister fehlt. So schließt der in der „Marktwirtschaft“ herrschende Materialismus die meisten Zeitgenossen vom wachsenden Reichtum aus und ihre Schädigung durch ihren Gebrauch – oder sogar durch ihre Nicht-Verwendung – als „Produktionsfaktor Arbeit“ ein. Und deswegen ist er auf eine Gewalt angewiesen, die das Eigentum auf der einen Seite, die Verfügbarkeit der „Produktionsfaktoren“ auf der anderen Seite erstens herstellt und zweitens absichert.
Die Gewalt, die da gebraucht wird und die, monopolisiert und durchorganisiert, als Staatsgewalt bekannt ist, ist ihrerseits logischerweise von anderer Art als das Geschäftsleben, das sie in Gang setzt und hält; der Nutzen, den sie fürs Geschäft stiftet, ist selber kein Geschäft. Er liegt in der Kontrolle über das gesellschaftliche Geschehen. Um diese zu gewährleisten und den bürgerlichen Materialismus gültig zu machen, muß die Staatsgewalt über diesem stehen. Ihr Erfolgskriterium ist der bedingungslose Zugriff auf ihre Bürger und die Voraussetzungen, nach denen diese ihr Dasein einrichten. Das Paradox, daß Nutzen und Gewalt im Kapitalismus zusammenfallen, findet also in der Weise statt, daß beide Seiten sich als Geschäftswelt und Politik voneinander scheiden.
So auch und erst recht, wenn die Staatsgewalt nach außen die Erfolgsbedingungen ihrer Nationalökonomie umsorgt. Es gehört zum Materialismus des kapitalistischen Geschäfts, daß dieses an den zufälligen Grenzen seines zuständigen Gewaltmonopolisten nicht aufhören, sondern überall brauchbare Verhältnisse vorfinden will. Also geht die Staatsgewalt über ihre Grenzen hinaus und konfrontiert die übrige Staatenwelt mit dem Anspruch auf Dienste; nicht einfach am kapitalistischen Eigentum im allgemeinen, sondern am Erfolg der Wirtschaft, die von ihrem Boden ausgeht, sich ihrer Mittel bedient, sie dadurch mehrt und insofern eben eine nationale Angelegenheit ist. Sie erhebt den geschäftlichen Nutzen ihrer einheimischen Mannschaft zur nationalen Sache, für die sie von den Vertretern anderer Nationen nicht bloß das eine oder andere Entgegenkommen, sondern prinzipiellen Respekt verlangt. Sie vertritt nichts geringeres als ein Recht, dem die rechtsetzenden Instanzen anderswo sich auch dann zu beugen haben, wenn sie gerade ganz anders kalkulieren, setzt also ihr Recht gegen das fremde – und eröffnet damit das weite Feld der Durchsetzungsfragen, des internationalen Kräftemessens; denn die anderen Staaten probieren ja ihrerseits – teils recht, teils schlecht – dasselbe.
Was ein moderner Staat auf diesem Feld zu unternehmen hat, das hat mit Beutezügen nichts zu tun; und auch das Erobern von Land samt Leuten ist nur unter besonders schlechten Bedingungen das Mittel der Wahl. Die Aufgabe heißt, den andern Staat dauerhaft und zuverlässig zum Garanten von Geschäften machen, die den in der eigenen Gesellschaft, aus ihr heraus und in sie hinein zirkulierenden, auf die eigene Sorte Geld lautenden kapitalistischen Reichtum mehren; und das hat eben seine paradoxe Seite und ist deshalb nicht leicht. Denn auf der einen Seite ist verlangt, daß auch anderswo ein nationaler Gewaltmonopolist sich für einen gelungenen Kapitalismus unter seiner Regie und zu seinem Vorteil engagiert; auf der anderen Seite sollen dessen Sachwalter, die regierenden Nationalisten des anderen Staates, das von ihnen behütete und zum nationalen Recht erhobene Geschäftsleben nur bedingt an ihren Vorhaben und Bedürfnissen ausrichten und unbedingt Bedingungen unterwerfen, die – von ihrem Standpunkt aus – auswärtigen Nutzen mehren und fremdem Recht Genüge tun.
Zwischen bürgerlichen Staaten findet also ein permanenter Rechtsstreit um Interessen statt; und weil das der Normalzustand zwischen ihnen ist, haben sie sich mittlerweile ein weitgefächertes Repertoire an Erpressungsmitteln und -methoden zurechtgelegt, das sich im Vergleich mit dem gewaltsamen Griff der Spanier nach dem indianischen Gold oder der deutschen Wehrmacht nach den Kornkammern der Ukraine so herrlich gewaltfrei ausnimmt. Dieser Eindruck ist freilich trügerisch. Denn erstens wird auch mit der Zufügung wirtschaftlicher Schäden von Staats wegen Gewalt geübt. Und zweitens gehört zu dieser zivilen Sorte Gewalttätigkeit eine kleine Fußnote des Inhalts, daß sie nur klappt, wenn und solange die Betroffenen die Erpressung mitmachen. Daß sie das tun, auch wenn ihnen lauter Niederlagen zugemutet werden, ist mit den Mitteln und nach der Logik des Do ut des gar nicht zu gewährleisten. Der Respekt souveräner Machthaber vor fremden Rechtsansprüchen ist nur dann hinreichend zuverlässig, wenn man ihm keine Alternative läßt.
Dieses Verhältnis hat sich auch dadurch nicht grundsätzlich geändert, daß seit dem verflossenen Weltkrieg ein supranationales Regelwerk etabliert worden ist, das die Respektierung auswärtiger Ansprüche quasi zur allgemeinen Geschäftsbedingung für jede souveräne Gewalt erhebt, die sich außenpolitisch zu Wort melden will. Denn auch diese „Welt-Ordnung“ hat nur dadurch Bestand, daß alle Beteiligten sich daran halten müssen, gerade dann, wenn das mit ihrer nationalen Rechtsauffassung kollidiert. Und dafür genügt kein Verbot, sondern bloß die unbezweifelbare Drohung, es auch zu vollstrecken. Denn auch wenn die allgemeinen internationalen Rechtsregeln noch so sehr wie eine allgemeine Rahmenbedingung daherkommen: Kein Beteiligter täuscht sich wirklich darüber, daß da die Methoden kodifiziert sind, nach denen die mächtigsten nationalen Interessen sich durchsetzen. Der Zustand des Rechtsstreits zwischen den Nationen hört mit der Gültigkeit allgemeiner Rechtsregeln nicht auf; er bekommt damit nur einen allgemeinen Bezugspunkt. Einen Bezug nämlich auf eine Weltmacht, die sich um den Respekt aller Beteiligten vor den Bedingungen kümmert, mit denen sie sich als diese Weltmacht etabliert hat.
Der Krieg kürzt sich also aus der zivilen Weltordnung des globalen Geldmachens und nationalen Konkurrierens keineswegs heraus. Als einzig haltbare Garantie für das Wohlverhalten anderer ist er unerläßlich und in Form der Drohung in sämtlichen Beziehungen zwischen Staaten gegenwärtig. Und mit der Etablierung internationaler Verfahrensregeln steigen noch die Ansprüche, was militärische Gewalt leisten soll: Statt bloß punktuell einen Rechtsstreit zu entscheiden, den die Kontrahenten zum Äußersten treiben, muß sie immer und überall von vornherein mit dem Äußersten drohen und so verhindern, daß irgendein Staat sein Anliegen auf die Spitze treibt. Gesichtspunkte der vorsorglichen Abschreckung und der nachträglichen Bestrafung werden entscheidend. Wer für eine ordentliche Welt einstehen will, muß daher die Freiheit beanspruchen, ganz losgelöst von einzelnen Schadensfällen und deren materiellem Gewicht zuzuschlagen, zur Erledigung gegensätzlicher nationaler Ambitionen, aber auch aus Gründen abschreckender Selbstdarstellung, zur Demonstration allgegenwärtiger und jederzeitiger Kriegsbereitschaft. Instrument von Weltordnungspolitik sind Militäraktionen geradezu dann am allermeisten, wenn sie nicht aus einer Defensive heraus erfolgen, sondern wenn an einem frei gewählten Anlaß eine internationale Schlägerei angezettelt und mit einer demonstrativen Niederlage des ausgemachten Störenfrieds beendet wird.
Von Gesichtspunkten des geschäftlichen Erfolgs, den einheimische Kaufleute anderswo erzielen oder nicht, hat diese Fürsorge des bürgerlichen Staates für das nationale Recht seiner Kapitalisten auf ihr Interesse sich da längst emanzipiert. Aber aus gutem Grund: Anders kann ein Staat für seinen nationalen Materialismus gegen andere souveräne Gewalten gar nicht eintreten als so grundsätzlich. Für ihn stellt sich eben jedes widerstreitende Interesse als Unbotmäßigkeit anderer Staaten gegenüber seinen berechtigten Geltungsansprüchen dar, also als Angriff auf seine Souveränität. Und wo ein Staat sich so bedroht sieht, ist alles nur noch eine Frage der Gewalt. Von da her versteht es sich von selbst, daß der bürgerliche Staat die Belange seiner nationalen Geschäftswelt für die Gewaltfragen funktionalisiert, die sein Rechtsanspruch auf eine prinzipielle Dienstbarkeit anderer Staaten für seine nationalen Anliegen aufwirft: Er muß den Geschäftsgang unterbrechen und nach seinen strategischen Gesichtspunkten entschlossen schädigen, wenn sein Kontrollanspruch gegen andere Machthaber anders nicht zu vollstrecken ist.
Die Maßstäbe, die da sachgerechterweise gelten, sind dem zivilen Publikum im Übrigen gar nicht fremd; sie sind ihm, weil so nahe verwandt mit den Kategorien des bürgerlichen Rechtsempfindens und der beleidigten Ehre, sogar viel eher geläufig als die spezielleren Erfolgsbedingungen des internationalen Geschäfts und unter Patrioten sogar so populär, daß nationale Führer für deren Erfüllung mehr als für irgendwelche anderen Erfolge geschätzt werden. Nur deshalb sind ja bürgerliche Moralisten, die auf der einen Seite von der Kriegsträchtigkeit kapitalistischer Nationalinteressen nichts wissen wollen, auf der anderen Seite auf die Idee verfallen, die allgemeine Wertschätzung erfolgreicher Kriegsherren möchte der Grund sein, aus dem demokratische, um ihre Wiederwahl besorgte Staatsmänner und -frauen bisweilen Kriegsaktionen vom Zaun brechen: eine Theorie, die ignoriert, was sie unterstellt, nämlich daß den mitdenkenden Wahlbürgern erst einmal geläufig sein muß, daß ihr Staat sich für seine Selbstbehauptung als respektierter Gewaltapparat in der Welt tatsächlich einiges schuldig ist. Soweit es also stimmt, daß ein mündiges Volk sich durch kriegerische Machterweise seiner Regierung beeindrucken läßt – „ablenken“ übrigens nicht; wovon denn auch? Parteilichkeit für die Nation muß schon vorliegen, wenn deren erfolgreiche Gewaltakte Beifall finden! –, dann ist das bloß ein Zeugnis mehr gegen das Zivile. Nämlich dafür, daß zum friedlichen Alltag der staatlich geschützten Weltwirtschaft Krieg so fest dazugehört wie das Gewaltmonopol zum Eigentum, die Polizei zur Lohnarbeit und staatliche Irrenhäuser zur privaten Konkurrenz.
*
Zurück zu Deutschlands Beschluß, nach außen hin auch in der Gewaltfrage „endlich normal“ zu werden. Die Klarstellung, daß zum deutschen Erfolg auf dem kapitalistischen Weltmarkt ein einsatzbereites Militär dazugehört, ist mittlerweile nicht mehr bloß von Kritikern dieses Verhältnisses zu haben; seine Anwälte, die Führer der Nation vom Außenminister bis zum Generalinspekteur der Bundeswehr, machen sich dafür stark, daß niemand an der notwendigen Einheit von Geschäft und Gewalt zweifelt. Gewiß, sie tun das auf ihre mehr praktisch orientierte Weise: Sie benutzen Deutschlands Rang als Weltwirtschaftsmacht für die Inanspruchnahme eines unzweifelhaften Rechts, sich als friedenschaffende Kriegsmacht zurückzumelden. Daß sie diesen nationalen Rechtsanspruch zugleich penetrant als Pflicht ausgeben, zu der alle anderen Deutschland rufen würden, ist erst einmal die – auch ganz normale – dazugehörige Heuchelei. Mit der wirklichen Sachlage hat es aber auch etwas zu tun: Die Nation muß ja wirklich ihren Imperialismus nicht erst neu eröffnen; sie war schon längst in einer Weltordnung eingehaust, in der es um ihre nationalen Rechte gegen andere nicht schlecht bestellt war; die Gültigkeit eines allgemeinen Regelwerks, das die nationalen Rechtsansprüche unter das Kriterium einer oberhoheitlichen Zuweisung von Recht und Unrecht rückt, war anerkannte und ausgenutzte Geschäftsbedingung deutscher Außenpolitik; davor verbeugen sich deren Macher, wenn sie von einer nationalen Verpflichtung zum Normal-Werden reden. Sie verbeugen sich davor, indem sie ihre bisherige Einordnung in die geregelten Weltverhältnisse aufkündigen; denn das ist ja mit dem Programm der Normalisierung vor allem angesagt, daß die Deutschen vieles in Frage stellen, was bis gestern mit den Verbündeten und den anderen Nationen noch ganz anders ausgemacht war.
So, wie sie bislang in die Weltordnung einsortiert war, will die BRD nicht mehr weitermachen – das ist ihre Pflicht. Und sie hat auch klare Vorstellungen darüber, wo sich etwas gründlich ändern muß. So will und betreibt sie mit Nachdruck:
Die Reform der NATO
In der Allianz, so wie sie sich bisher aufgebaut hatte, war die Aufgabe des deutschen Militärs bis in die Details der Einsatzplanung hinein eindeutig festgelegt, und zwar deutlich anders als im Sinne einer Eingreiftruppe, die das nationale Recht sichern muß, das aus den Weltmarktanteilen der deutschen Industrie und den Geldmarktanteilen der deutschen Mark entspringt: Sie war Teilstreitmacht gegen das Sozialistische Lager.
Auch diese Aufgabe hatte ihren klaren Bezug auf den freien Weltmarkt und die Weltordnung zwischen dessen staatlichen Subjekten: In der Sowjetmacht hatte die ordentliche Freie Welt ihren erklärten Gegenspieler, der sich prinzipiell vom Regelwerk des Welt-Kapitalismus ausnahm; die Hüter der Freiheit erkannten sie daher als Gefahr Nr. 1 für den Bestand ihrer Ordnung und bedrohten sie mit einem Welt- und Atomkrieg, um sie als Gefahr zu neutralisieren und womöglich als Ausnahme zu eliminieren. Maßgebliches Subjekt dieser totalen Bedrohungsstrategie waren die USA; die Bundesdeutschen haben dazu ihren wohldefinierten Beitrag geleistet, der nicht zuletzt in der Bereitschaft bestand, einen Krieg mit taktischen Atomwaffen auf dem eigenen Staatsgebiet auszuhalten. Nach dem Beitrag bemaß sich ihr Rang in der Konkurrenz der Bündnispartner unterhalb der Führungsmacht; Teilhabe an der imperialistischen Ordnung im Rest der Welt mit ihren Benutzungsverhältnissen war darin eingeschlossen.
Dieser Beitrag wird im Rückblick mittlerweile denkbar ungerecht geringgeschätzt – von Politikern, die selber noch die alte BRD befehligt und stolz auf ihren unentbehrlichen Bündnisbeitrag gepocht haben. Deutschland hätte „im Abseits gestanden“, sich in einer „Nische der Geschichte“ versteckt, unter einem fremden Atomschirm vor den „Unwettern der Geschichte“ untergestellt und bloße „Scheckbuchdiplomatie“ betrieben: eine klare Selbstbezichtigung, nur erpresserisch mit Geld statt gewalttätig mit Waffen unterwegs gewesen zu sein. Bemerkenswert an dieser Selbstkritik ist der Standpunkt, der darin eingenommen wird. Die bundesdeutsche Sicherheitspolitik wird nicht mehr durch den Beitrag definiert, den sie zur Nato geleistet hat und der ein ziemlich extremes Maß an Risikobereitschaft und allzeit abrufbarer Gewalttätigkeit verrät; es wird überhaupt nicht mehr, wie in Sicherheitsfragen bislang selbstverständlich, vom Bündnis her gedacht. Vielmehr wird Deutschlands Militarismus national gewichtet, nach dem, was das Land allein, von sich aus und auf eigene Rechnung, militärisch unternommen hat, und für zu zwergenhaft befunden. Im Hinblick auf Amerikas Golfkrieg wirft sich die Nation geradezu Feigheit vor; daß Deutschlands Militär bis dahin noch vollständig in die Nato einsortiert war und über diese gar nicht angefordert wurde – übrigens, soweit doch, seine Etappendienste geleistet hat –, stört diese Optik nicht. Offensichtlich begreift sich das neue Deutschland ganz losgelöst vom Bündnis als eigenständige Militärmacht; als solche wirft es sich vor, zu wenig bzw. aus falschen Gründen nicht mitgemacht zu haben. Mit diesem Standpunkt ist die Definition der nationalen Kriegsbereitschaft als Beitrag abgetan, also der Standpunkt des Bündnisses verlassen.
Dabei sind sich die Deutschen sicher und können auch gewiß sein, daß sie diesen Standpunktwechsel nicht allein vollziehen. Der mag zwar bei den anderen großen Verbündeten nicht weiter auffallen, weil Frankreich und Großbritannien schon immer so getan haben, als hätten sie unter Nato-Regie ihren Status als autonome Kriegsmächte voll gewahrt, und die USA nicht bloß so getan haben. Für die BRD war es aber wirklich so, daß sie ihre Militärmacht vom Bündnis her definiert hat; und auch die westeuropäischen Partner waren als Nato-Mitglieder in eine Atomkriegsstrategie vereinnahmt, die nicht von ihren Kalkulationen ausging, sondern von den USA, und der sie ohne die Allianz auch gar nicht gewachsen waren – eben das hat ja die auf unbedingte Gleichberechtigung dringende französische Republik nicht ausgehalten und hat doch keine Alternative zustandegebracht. Jetzt ist das einigende Band der Atomkriegsvorbereitung gegen den gemeinsamen Feind aber hinfällig, und alle Verbündeten können getrost davon ausgehen, daß keiner von ihnen mehr einen zwingenden Grund hat, für die Sicherheitsbedürfnisse der anderen einzustehen – für welche: das wäre ja erst die zu klärende Frage.
Dennoch: Aufgeben will Deutschland die Nato nicht, allein will es nicht stehen, genausowenig wie seine alten Verbündeten. Auf das Bündnis Westeuropas mit Nordamerika halten sie alle die größten Stücke; denn schließlich hat es das Ideal der Weltaufsicht verwirklicht; nach dem Ende der Sowjetunion ist ihm endgültig keine Militärmacht auf dem Globus auch nur im entferntesten gewachsen; gerade so und jetzt mehr denn je könnte es seine Kompetenz zur Weltordnung entfalten. In diesem Sinne wünscht sich der Bundesverteidigungsminister:
„Das Potential der Nato muß auf die Fähigkeit zugeschnitten sein, örtlich, zeitlich und nach Intensität ganz unterschiedliche Krisen und Konflikte zu bewältigen.“ (Rühe, Bulletin der Bundesregierung Nr. 27, 1.4.93)
Das können sich halt alle Beteiligten sehr gut vorstellen, daß die traditionsreichen „Bündnisstrukturen“ und das Bündnispotential ihnen gute Dienste leisten könnten für all die Kontroll- und Abschreckungsaufgaben, die jeder von ihnen aus seiner weitgespannten Interessenslage ableitet. Genau darin liegt allerdings der Haken, daß jeder dasselbe plant: die Funktionalisierung der Allianz für seine Versicherungsbedürfnisse. Dem Vorteil des beinahe verwirklichten Gewaltmonopols in der Welt steht deswegen der Nachteil gegenüber, daß erst noch zu entscheiden ist, wessen Monopol es eigentlich ist, dem Vorteil der Unanfechtbarkeit der Nato-Macht der Nachteil der nicht mehr feststehenden Zweckbindung. Gerade die Kritik der BRD an ihrer alten Rolle als Militärmacht im Bündnis, der voreingenommene Rückblick auf die goldenen Zeiten der Allianz als eine einzige Verhinderung nationaler Machtentfaltung, macht ja deutlich, wie sehr man heute gegen das Bündnis national kalkuliert – und so mit dem Bündnis kalkulieren will. So wollen etwa die Deutschen einen weiterhin gesicherten Rückgriff auf den amerikanischen Atomschirm und andere militärische Ressourcen der USA – so als müßte den Amerikanern ein von ihnen emanzipiertes, nicht mehr für den großen Schlagabtausch verplantes und überhaupt nicht mehr richtig verplanbares Deutschland immer noch einen Atomkrieg wert sein; umgekehrt möchten sich die USA Deutschland als verfügbaren Vorposten erhalten – so als wäre dessen nationales Wiederauferstehungsinteresse immer noch untergeordnet deckungsgleich mit einer übergeordneten amerikanischen Weltkriegsstrategie. Jeder weiß etwas Gutes am Alten, das er für sich erhalten will – nämlich Dienste der anderen, für die mit dem Wegfall der sowjetischen Bedrohung ein für allemal der einzig haltbare Grund entfallen ist; jeder wirbt für sein Konzept einer nützlichen Gemeinsamkeit der alten Partner und hat dafür umgekehrt nur bedingt Überzeugendes zu bieten; alle entwickeln teils gleichgerichtete, teils divergierende, in jedem Fall konkurrierende Bedürfnisse und Gesichtspunkte für militärischen Kontrollbedarf und suchen einander dafür zu funktionalisieren. Und dabei geht es jedem der großen Verbündeten entscheidend noch nicht einmal um irgendein Eingriffskonzept, auf das man sich ja allenfalls noch einigen könnte, sondern gerade im Blick auf den schönen alten Supranationalismus um die übergeordnete Grundsatzfrage, wer im Bündnis und das Bündnis bestimmt, was zwischen den Partnern nun gar keine kompromißfähige Angelegenheit ist.
Inzwischen und fürs Erste haben sich die Verbündeten darauf geeinigt, von ihrem Pakt nichts einfach wegzuwerfen, sondern ihn zu „reformieren“. Das ist nun allerdings ein Treppenwitz. Denn in Wahrheit soll da gar nicht einem fortbestehenden gemeinsamen Zweck und einheitlichen Willen ein besseres, zeitgemäßes Instrumentarium verpaßt, sondern umgekehrt mit Hilfe der überkommenen Instrumentarien ein Pakt quasi erschlichen werden, auf dessen Inhalt und Zweck man sich gar nicht geeinigt hat. Ausgerechnet die Nato, die das nie war und nur deshalb so zuverlässig funktioniert hat, soll sich ganz einfach umdefinieren lassen in ein Bündnis gleichberechtigter Nationen, die von ihrem jeweiligen nationalen Bedarf als im Prinzip auf sich gestellte Militärmächte her zur Gemeinsamkeit finden; und das wird so betrieben, als bräuchte man dafür nur ein paar alte Zöpfe abzuschneiden und neue Konsultationsgremien einzuführen. Was in den neuen und alten Gremien tatsächlich passiert – wenn überhaupt etwas –, das ist damit schon programmiert: Reformkonzepte, die an diesem Widerspruch vieler nationaler Interessen an der Nato kunstvoll herumformulieren; und sobald es auf ein Eingreifen in wirkliche Konflikte zugeht: Streit um eine gemeinsame Linie; ein Streit, an dem sich keine Linienprobleme entscheiden sollen, sondern an dem die Führungsfrage ausgetragen wird; die Behandlung des Jugoslawiens-Falls gibt davon einen guten ersten Eindruck.[3]
Die Deutschen jedenfalls – mit Schwung dabei beim „Reformieren“ und durch einen würdigen Nato-Chef in Brüssel vertreten – verlassen sich überhaupt nicht darauf, daß der Streit um eine neue Nato in einer für sie irgendwie befriedigenden Form aufgehen könnte. Einerseits dringen sie, formell im alten Rahmen, auf ausgewogene bündnispartnerschaftliche Beziehungen zu einzelnen Nato-Mitgliedern und stellen bi- und trilateral gemeinsame Brigaden auf; das wäre, wenn die „Reform“ so weitergehen soll, gleich die Auflösung der alten Bündniseinheit in ein Sammelsurium punktueller, rein national kalkulierter Kooperationsbeziehungen. Zum andern ergänzen sie ihren Willen zur Nato-Reform durch ein Projekt, mit dem sie die Erwartung, bei der Bündnisreform könnte etwas ihren Ansprüchen Genügendes herauskommen, gleich selber dementieren. Sie wollen und betreiben:
Eine europäische Sicherheitsidentität
Unter diesem Titel hat vor allem Frankreich die Wiederbelebung der WEU betrieben und die EG in Maastricht zu dem Bekenntnis gedrängt, dieses alte, längst in Vergessenheit geratene Bündnis der europäischen Nato-Mitglieder zum militärischen Instrument einer EG-Weltpolitik fortentwickeln zu wollen; das alles in der erklärten Absicht, die EG als eigenständige Ordnungsmacht von den Weltordnungsstrategien der USA zu emanzipieren. Deutschland hat das akzeptiert und damit den Status der Selbständigkeit unterstrichen, den es in der Definition nationaler Ordnungs- und Kontrollinteressen nunmehr geltend macht: Es will – wie Frankreich – diese Interessen noch ein zweites Mal nicht allein verfolgen, diesmal aber ausdrücklich ohne die USA.
Und schon indem sie diesen gegen den amerikanischen Führungsanspruch gerichteten Standpunkt eingenommen hat, ist die deutsche Regierung mit der Erklärung hervorgetreten, der Entschluß zur militärischen Gemeinschaft ohne die USA wäre bestens vereinbar mit der Nato, ja geradezu die denkbar konstruktivste Ergänzung zum Bündnis unter Einschluß Amerikas. Die alte Nato-Phrase vom „europäischen Pfeiler“ wurde bemüht, die zu den Zeiten amerikanischer Atomkriegsstrategie das doppeldeutige Ideal bezeichnet hatte, die Westeuropäer sollten militärisch stark genug werden, um die europäische Front gegen die Sowjetunion auch ohne – sofortigen – Rückgriff auf amerikanische Atomwaffen halten zu können: für manche Europäer ein Emanzipationsideal, von Amerika aus das Ideal eines Entscheidungskampfs mit dem Hauptfeind ohne strategischen Atomschlagabtausch; deswegen immer im Verdacht, das Bündnis zu spalten; praktisch ohnehin nie verwirklicht. Heute soll diese Formel gerade umgekehrt ein wunderbar passendes Ergänzungsverhältnis fingieren, wo die Einheit der alten Allianz dem Recht auf die rein nationale Definition militärischer Interessen gewichen ist und wo dazu der Beschluß gesetzt wird, eine Gemeinsamkeit der nationalen Standpunkte der Westeuropäer ohne die USA zu suchen. Deutschland vor allem besteht darauf, die – von Frankreich wie aus den USA dringlich angemeldete – Frage, was es denn jetzt will, ein Militärbündnis mit oder ohne Amerika, mit einem entschlossenen „Beides!“ zu beantworten.
Klar ist damit erstens, daß in Bonn noch immer die Einschätzung in Kraft ist, wonach die alten Nationalstaaten
nicht mehr die „handlungsfähigen Akteure“ sind, die – nicht Deutschland, nicht Amerika, sondern: – die neue multipolare Welt braucht…
Ebenso klar ist zweitens das Negative, daß dem deutschen Bedürfnis, für seine Aufsichtsinteressen Verbündete zu gewinnen, weder das eine noch das andere Bündnis allein genügt. Und so rätselhaft ist es drittens auch nicht, wozu die Nation beide haben will: Mit der Europäischen Union und ihrer Sicherheitsidentität will sie die Einmischung der USA in europäische Entscheidungen abwehren bzw. dafür Bedingungen setzen können; mit den USA im Rücken und als Anwalt amerikanischer Mitspracherechte will sie diktieren können, wie ein europäisches Bündnis auszusehen hat, das es ermöglichen
soll, uns dauerhaft von einer Politik wechselnder Koalitionen und machtpolitisch begründeter Rivalitäten zu lösen
– ein seltsamer Blick des Bundesverteidigungsministers auf die Vergangenheit – so sah die Nato ja gerade nicht aus! –, der schlagend verdeutlicht, was der Mann voraussieht und wohl weniger sich als seinen Partnern verwehren möchte. Er fordert: Europa muß in der Lage sein, mit einer Stimme zu sprechen, wenn es die gemeinsamen Interessen der europäischen Staaten gegenüber der Außenwelt vertreten soll.
Und wenn es so kommen soll, dann ist es um so wichtiger, diese Stimme zu bestimmen. Dafür, so kalkulieren die Deutschen, kann es nur nützlich sein, wenn die USA nur einerseits „Außenwelt“ sind und andererseits zugleich von ihnen zur Teilhabe an den politischen Prozessen in Europa
eingeladen werden.[4] So eröffnet die Nation jedenfalls auch in diesem Bündnis die Konkurrenz um die militärpolitische Hegemonie über Europa.
Was das heißt und wie das zur Zeit läuft, davon gibt die Betreuung des jugoslawischen Bürgerkriegs durch Deutschland und seine Sicherheitspartner einen Eindruck. Dort hat die Bonner Regierung die Intervention der EG vorangetrieben; in der Absicht, gleich ein paar Maßstäbe dafür zu setzen, welche Freiheiten und Rechte sich dieser Club auf dem alten Kontinent herausnehmen soll und wer dabei das Sagen hat; an Zerfall, Chaos und Krieg hat sie ja auch einiges vorangebracht und überwacht. Mittlerweile geben allerdings viel mehr die Franzosen und Briten den europäischen Ton an; die einen mit ihren Offizieren vor Ort und ihrer UNO- und Nato-Diplomatie, die anderen mit ihrem in Deutschland mittlerweile zutiefst verhaßten Vermittler. Die Deutschen sehen sich ausmanövriert und auf ihre Defizite in der Kunst des bewaffneten Intervenierens zurückgeworfen. Darunter leiden sie unter Anleitung ihres Außenministers heftig; und der zieht seine Schlüsse. Als ersten den, daß er in den Vermittlungsbemühungen und Kontrollanstrengungen seiner EG-Partner keine gemeinsame europäische Sache mehr zu sehen vermag; auch das wieder sehr passend. Denn offenbar ist dem neuen Deutschland der Standpunkt, der der alten BRD noch nahegelegen hätte, inzwischen völlig fremd: die Bereitschaft, Mängel auf dem Gebiet auswärtiger Gewalteinsätze durch die berechnende Kooperation mit ihren europäischen Freunden zu kompensieren. Die Regierung reagiert genau entgegengesetzt: Sie demonstriert Distanz zu den diplomatischen wie militärischen Bemühungen ihrer EG-Partner, Unzufriedenheit mit den erzielten Ergebnissen, Desinteresse an der Erarbeitung einer gemeinsamen Linie, die sie dann vorbehaltlos unterstützen würde. „Europäische Politische Zusammenarbeit“ findet in der Frage derzeit nicht statt. Damit erzielt das Bonner Außenamt zwar auch nicht den gewünschten Erfolg; Deutschland ist nicht Herr der Lage in Europa und wird es so auch nicht. Immerhin hat es aber den kleinen Triumph, daß es nicht allein gegen einen EG-Konsens steht, sondern unter Ausnutzung des amerikanischen Widerstands gegen eine europäische „Lösung“ deren Erfolg hintertreibt und die Gemeinschaft in der Balkanfrage ein wenig spaltet. Und auf alle Fälle macht die Nation so ihren Standpunkt deutlich: daß sie entweder als Führungsmacht in der Politischen Union Europas stärker Anerkennung findet – oder gar nicht mehr im gewohnten EG-Sinn „solidarisch“ europäisch ist.
Aus dem weltpolitischen Defizit, das ihr am Fall Jugoslawien so bitter aufgefallen ist, hat die deutsche Außenpolitik im übrigen längst noch eine andere Konsequenz gezogen, die noch einmal klarstellt, wie ihre Bemühungen um allseitige alte und neuartige Bündnisbeziehungen zu verstehen sind. Zu denselben großen Partnern, mit denen sie sich in der und über die Nato, EG und WEU auseinandersetzt, tritt sie noch auf einer ganz anderen weltpolitischen Bühne in Konkurrenz und beantragt:
Einen ständigen Sitz mit Vetorecht im Weltsicherheitsrat der UNO
Die Phase der höflichen Umschreibungen dieses Ziels, des kindischen Versteckspiels mit den Japanern – „Nur wenn die…, dann aber schon längst…“ – ist mit dem G7-Gipfel in Tokio vorbei. Die Forderung, den Rat um Deutschland als Dauermitglied zu erweitern, ohne ihn ansonsten übermäßig zu vergrößern und dadurch die „Entscheidungsstrukturen“ zu „verkomplizieren“, liegt auf dem Tisch; und aus gegebenem Anlaß – die Europa-Freunde Frankreich und Großbritannien hatten so etwas vorgeschlagen – hat der Kanzler die Klarstellung nachgereicht, daß ein Sitz minderen Ranges, nämlich ohne Vetorecht, für seine Nation nicht in Frage kommt.
Die offizielle Begründung für diesen Vorstoß ist denkbar lapidar:
„Zu dieser Normalisierung gehört auch ein deutscher ständiger Sitz im Sicherheitsrat.“ (Kinkel, FAZ 19.3.93)
Denn schließlich sind „wir“ drittgrößter Beitragszahler; da steht „uns“ dieser Posten einfach zu. Deutschland erhebt einen Rechtsanspruch direkt aus seinem Reichtum heraus. Eine sanfte Kritik an der bisherigen Zusammensetzung des Rates ist darin eingeschlossen: Vergleichsweise armselige Nationen nehmen sich mit ihrer privilegierten Mitgliedschaft zuviel heraus. Und eine Absage auch: Die Möglichkeit, sich im Zeichen Europas auf die Ratsmitglieder Frankreich und Großbritannien zu verlassen – ein Vorschlag dieser beiden Länder im Zuge ihres Rückzugs von einem strikten Nein –, kommt für die Europäer in Bonn gar nicht erst in Betracht. Deutschland besteht darauf, daß der Rat das Kräfteverhältnis an der Weltspitze, die Konkurrenzlage, wie sie sich aus seiner Sicht darstellt, gerechter widerspiegelt als bisher.
Warum? Was fehlt der Nation, solange sie nicht dabei ist? Was will sie im Rat anstellen, was sie jetzt nicht vermag? Welches Interesse verlangt hier sein Recht?
Die Sache ist sehr grundsätzlicher Natur. Deutschland will mit dabei sein, Initiativen ergreifen können, wirksam ‚Nein‘ und ‚So nicht‘ sagen dürfen, wenn auf höchster Ebene über Gewalt und Krieg und ihre passende Betreuung durch ordnungschaffende Mächte beraten und beschlossen wird. Denn das ist die Funktion, die die USA dem Weltsicherheitsrat der UNO verschafft haben, seit ihnen dort nicht mehr die Sowjetunion als erklärte Gegenmacht gegenübersitzt.[5]
Aus sich heraus, bloß als Gremium der „Weltgemeinschaft“ genommen, vermag der Rat überhaupt nichts, entgegen allen wohlmeinenden Theorien über eine erste Ahnung von Weltregierung, die er darstellen könnte; er besitzt nichts von einem Weltgewaltmonopol und ist überhaupt keine Instanz, die mit eigener Macht irgendetwas entscheiden könnte; insoweit bedeutet die Mitgliedschaft keinen Machtgewinn. Was er an Bedeutung hat, bekommt er durch diejenigen ständigen Mitglieder – mit Frankreich, Großbritannien und Amerika bislang drei –, die völlig unabhängig von der UNO erstens das Interesse und zweitens die Mittel haben, die Politik aller übrigen Staaten zu überwachen und nötigenfalls durch Erpressung oder mit Gewalt in ihrem Sinn zu korrigieren. Die anerkannt stärkste dieser drei Mächte, die USA, hat sich entschlossen, bestimmte gewaltsame Eingriffe ins Weltgeschehen, die sie für fällig hält, mit ihren beiden kleineren gleichgesinnten Partnern sowie mit Rußland und China vorher abzusprechen und formell beschließen zu lassen. Dadurch kommt der Imperialismus nach zwei Seiten hin in Form:
– Alles, wozu die im Weltsicherheitsrat vertretenen Weltmächte sich anderen Staaten gegenüber in diesem Gremium ermächtigen, gilt damit als unbestreitbar legitimiert. Die UN-Mitgliedschaft – ohne die ein Staat heutzutage so gut wie nicht vorhanden ist auf dem Globus – wird als Unterwerfung unter das UNO-Regelwerk und somit unter alle Beschlüsse aufgefaßt, die nach diesen Regeln zustande kommen; Staaten, die von im Rat ordnungsgemäß abgesegneter Gewalt betroffen werden, haben folglich vorab ihrer eigenen Bestrafung zugestimmt und kein Recht auf Beschwerde, geschweige denn auf Widerstand. Der Rat erhebt so die herrschenden Interessen und Kräfteverhältnisse auf dem Globus in den Rang eines weltumspannenden Rechtszustandes; er überbietet die „Breschnew-Doktrin“ der einstigen Sowjetunion[6] durch die praktisch wahrgemachte „Lehre“ von der beschränkten und bedingten Souveränität aller kapitalistischen Nationen und UNO-Mitglieder überhaupt unterhalb der obersten Führungsebene.
– Nach der anderen Seite hin geht die kapitalistische Weltordnungsmacht über den Weltsicherheitsrat ein ambivalentes Führungsverhältnis zu den anderen Dauermitgliedern dieses Gremiums ein: Sie bindet diese in ihre Vorhaben ein und bindet zugleich ihre eigene Eigenmächtigkeit an deren Konsens. Das sieht viel zivilisierter aus, als wenn sich konkurrierende Weltmächte um Einflußsphären schlagen, ist aber in der Sache eine noch härtere Art von Konkurrenz. Denn damit wird nicht bloß Respekt vor konkurrierenden Ordnungsvorstellungen von begrenzter Reichweite verlangt, sondern Mächten mit eigenen Ansprüchen das Mitmachen bei einer Weltpolitik von universeller Reichweite abverlangt. Institutionalisiert ist damit das Ringen der Großen um die Funktionalisierung ihrer Macht, um Beschränkung durch und Unterwerfung unter eine tonangebende Führungsnation. Die amerikanische Diplomatie um den Golfkrieg herum, ihr ultimativer Umgang mit Großbritannien und Frankreich, hat dafür Maßstäbe gesetzt und gezeigt, worum es geht.
An dieser Sorte „Absprachen“ will Deutschland also fortan in vorderster Linie beteiligt sein. Und zwar deswegen, weil es an der Sache, um die es im obersten UNO-Gremium geht, längst beteiligt ist: Der Verweis auf das Geld, das ihm eigentlich längst ein Anrecht auf Präsenz im Weltsicherheitsrat verschafft hat, macht ja deutlich, daß Weltordnungsmaßnahmen der Großen schon gar nicht mehr ohne die Deutschen auskommen, also auch schon nicht mehr an ihnen vorbei zu entscheiden sind. Sie hätten genausogut darauf verweisen können, daß sie schließlich längst zu den „G7“ gehören. Entscheidend ist: Sie finden sich einfach zu wichtig, um am Ringen um die Richtlinienkompetenz in Sachen Weltordnung, um Führung und Unterordnung, nicht auch an der UNO-Spitze beteiligt zu sein.
Deutschland akzeptiert damit nach beiden Seiten hin die Bedeutung, die die USA dem Rat gegeben haben: daß imperialistische Gewaltaktionen höheren Ranges, die eine der in der ganzen Welt aktiv eingemischten Mächte braucht, hier beantragt werden müssen und blockiert werden können. Es stellt sich positiv dazu, daß derartige „Probleme“ von dem Staat, der sich betroffen und in seinen Rechten herausgefordert sieht, nicht auf eigene Faust „gelöst“ werden – auch wenn man in Bonn so gut wie anderswo weiß, daß genügend Gewaltaffären auf der Welt, auch solche, deren Urheber in jenem höchsten Rat beieinander sitzen, nach wie vor an der UNO vorbei und ohne deren höchsten Segen ihren Gang gehen. Denn man weiß ja auch, daß Streitfragen, an denen die Konkurrenz um die Federführung in Sachen Weltordnung ausgetragen wird, – derzeit und solange die USA es so haben wollen – nicht an der UNO vorbeigehen; eben weil in deren oberster Ratsversammlung um den Konsens, also die Einordnung der paar wichtigen Mächte auf der Welt und um den Preis der Unterordnung gerungen wird.
Dort nicht dabei zu sein: Das läßt die Deutschen nicht mehr gleichgültig. Nicht, weil sie dadurch auf eine Stufe mit machtlosen Nationen gestellt würden – daß sie zu den Kleineren nicht gehören, steht außer Frage –, sondern weil gerade sie, mit ihren weltweiten Interessen, Anrechten und Sicherheitsbedürfnissen, so in die Rolle des imperialistischen Außenseiters gedrängt würden. Das wollen sie nicht sein; und ihr entscheidendes Argument für die Zustimmung der imperialistischen Konkurrenten zur Aufnahme in deren erlauchtes Gremium ist die Erinnerung daran – ob mit oder ohne Hitler –, daß auch die eine solche Rolle für die Deutschen nicht wollen können. Auch Deutschland will keine andere Sorte Konkurrenz um Weltherrschaft eröffnen als die, die als Ringen um eine allgemeinverbindliche „Linie“, als Kampf um anerkannte Führung stattfindet – nicht zuletzt eben im Weltsicherheitsrat; es will sich dazu freilich auch nicht gezwungen sehen. Denn daß es sich in die Konkurrenz um die von anderen monopolisierte Herrschaft über die Weltordnung einschaltet, das steht für das Kernland Europas erst recht außer Frage.
Deutschlands konstruktive Stellung zu den ordentlichen Verfahrensregeln des Imperialismus, die die USA institutionalisiert haben, bezeugt also seine Entschlossenheit, in diese Sorte Konkurrenz, nämlich um die Macht über den Konsens der Imperialisten, einzusteigen. Mit seinem Aufnahmeantrag greift es – nicht an irgendeinem Fall, sondern prinzipiell – in bestehende Machtverhältnisse ein, um die Macht über das Dürfen und Erlauben in offiziellen Kriegsangelegenheiten neu aufzuteilen. Auch zu amerikanischen Vorhaben will Deutschland gleich an der Quelle Nein sagen können; es will in die Lage kommen, daß man ihm seine Zustimmung abhandeln und dafür seinen Anliegen, die gewaltsame Zurechtweisung von Staaten betreffend, entgegenkommen muß – auch wenn es aktuell gar keinen ordnungsstiftenden Krieg vorzuschlagen hätte (was in Jugoslawien immerhin der Fall ist!) bzw. mit keinem Antrag auf Krieg konfrontiert ist, der seine Interessen durchkreuzen würde (was am Golf immerhin ein bißchen der Fall war!). Sie verlangt die Anerkennung ihrer Weltordnungskompetenz, also die (Selbst-)Beschränkung der anderen Mächte, die hier gar nicht mehr als engstens verbundene Partner, als Nato- und G7-„Freunde“ bzw. Mitmacher einer „Europäischen Union“, angegangen werden, sondern definitiv als Konkurrenten in letzten Fragen der Weltherrschaft.
Bei alledem ist den Deutschen klar, daß die Macht, die sie mit einem Vetorecht im Weltsicherheitsrat anerkannt haben wollen, nicht bloß auf ihrem Reichtum beruht, sondern ebenso in ihrer Kriegsfähigkeit und -bereitschaft besteht. Dem Volk wird dieser Sachzusammenhang in der moralisch verdrehten Form erklärt, die UNO-Mitgliedschaft samt Kriegseinsätzen wäre eine humanitäre Pflicht, die nun einmal auch die eine oder andere Last mit sich brächte; worauf die SPD mit dem kongenialen Oppositionsbedenken einsteigt, man dürfe es bei allem Pflicht- und Verantwortungsbewußtsein mit der militärischen Belastung der Nation nicht übertreiben – zumindest nicht bevor sie Sitz und Vetorecht an der UNO-Spitze hat. So müht sich die Nation darum, im Maße ihrer Weltordnungsansprüche kriegerisch zu werden. Genügend Waffen hat sie ja; die Heimatfront wird bearbeitet. Ein erstes Exerzierfeld ist mit Somalia gefunden.
Gewiß, der Einsatz dort wirkt etwas lächerlich im Vergleich zu Deutschlands daran verdeutlichten Ambitionen; das weltpolitische Mandat, das die Nation für sich verlangt, und ihre bewiesenen Fähigkeiten stimmen noch nicht zusammen. Den Anspruch entkräftet das aber nicht: Man fängt ja erklärtermaßen erst an! Um Fortsetzungskapitel, die die Gelegenheit bieten, größer einzusteigen, braucht Deutschland ohnehin nicht verlegen zu sein; da ist die Regierung sich ganz sicher. Auf Anfrage deutet sie unbestimmt in die ganze Welt, bezeichnet alles, was 40 Jahre Weltordnung und 4 Jahre kampfloser Sieg über den Sozialismus dort angerichtet haben, als Risiko, das sie jederzeit zu ordnungsstiftender – „friedenschaffender“ – Einmischung herausfordern kann, und gibt damit zu verstehen, daß Eingriffstatbestände in der Welt von heute nichts weiter sind als eine Frage des Interesses und der Macht, sie als solche zu definieren.
Ihre Kompetenz dazu meldet sie für den gesamten sogenannten Süden des Globus unter einem Titel an, der ihren kritischen Dritt-Welt-Freunden so gut gefällt, daß die ihren eigenen Idealismus von den praktischen Vorhaben der Bonner Zuständigen schier gar nicht mehr unterscheiden können: Deutschland besteht auf mehr
Respekt vor den Menschenrechten in der 3. (4., 5., …) Welt
Was damit gemeint ist, wird aus dem Junktim ersichtlich, das diese Forderung stereotyp begleitet: Wo deutsche Experten Demokratiedefizite und Menschenrechtsverletzungen feststellen, wird, was unter dem Titel „Entwicklungshilfe“ läuft, reduziert, storniert oder eingestellt. Das ist, sollte man meinen, kaum mißzuverstehen – schon deswegen nicht, weil es von deutscher Seite aus keiner Regierung als „Verstoß gegen die Menschenrechte“ übelgenommen wird, wenn sie ohne oder unter dem Druck des IWF ihren Untertanen die Chance auf medizinische Versorgung oder überhaupt aufs Subsistieren nimmt; und um so weniger, weil das Junktim niemals umgekehrt aufgemacht und für die anständige Behandlung des Volkes die Sicherung seines anständigen Überlebens versprochen wird. Der Schluß ist wirklich nicht schwer, daß in Wirklichkeit dort, wo die deutschen Entwicklungshelfer nichts mehr entwickeln und sparen statt helfen wollen, unerträgliche politische Zustände diagnostiziert werden. Dennoch gibt die Bonner Menschenrechtspolitik guten Menschen Anlaß zu deplazierten Fragen; z.B., ob das Kriterium denn auch gerecht gehandhabt wird und nicht an vielen Stellen zu lax – darauf wird man in Bonn bei Bedarf gerne zurückkommen! –, oder ob Sanktionen und die Streichung von Hilfsmaßnahmen den „Ärmsten der Armen“ allemal mehr schaden als der herrschenden Elite – so wird es schon sein, wenn es um die Betreuung von Staaten geht, wo allemal die einen das Sagen und die andern sich zu fügen haben, und daran wird sich auch überhaupt nichts ändern, wenn die Souveräne vor Ort sich demokratisieren, was immer das dort heißt, und unter dem Diktat, das Menschenrecht auf freie Marktwirtschaft zu gewähren, das Elend ihrer Massen unter die Überschrift „freier Arbeitsmarkt“ stellen. Deplaziert sind solche Nachfragen deshalb, weil es bei der neuen deutschen Menschenrechtspolitik eben noch nicht einmal darum geht, mit ökonomischer Erpressung überhaupt eine andere innere Politik der Machthaber in den verkommenden Staaten des „Südens“ zu erreichen; noch nicht einmal eine solche, an die deutsche Unternehmer die Erwartung knüpfen könnten, bessere Geschäftsbedingungen vorzufinden – wo überhaupt noch etwas zu verschlechtern ist, wird unter dem Titel „Demokratisierung“ eher das Gegenteil erreicht.[7] Wenn deutsche Politiker heute durch eine Welt mit höherer Ordnungszahl reisen und im Sinne des genannten Junktims die Menschenrechtslage überprüfen, dann tun sie das nicht, um Anlagesphären zu betreuen, sondern um erstens die Streichung von Unterstützungsmaßnahmen anzukündigen – und um zweitens einen Anspruch auf gewaltsame Überwachung anzumelden, der mit der Entscheidung, ganze Regionen verkommen zu lassen, überhaupt nicht erloschen ist. Der Imperialismus wird in diesen Weltregionen bloß arg elementar: „Menschenrechte“ steht aktuell für die Maxime Kontrolle statt Benutzung.
Die Gegenprobe ist leicht zu haben. Wo es noch um deutsche Benutzungsinteressen geht, und auch dafür gibt es genügend Kandidaten in der Drittwelt; wo der deutsche Blick sich auf Staaten richtet, die allein schon wegen ihrer Land- und Bevölkerungsmasse ein Minimum an produktiver Geschäftspartnerschaft versprechen und keinesfalls der Konkurrenz überlassen werden dürfen; da sprechen deutsche Weltpolitiker ihr Interesse heutzutage unumwunden aus, reden Klartext über ihren Bedarf an „politischer Stabilität“ in der Welt und hüten sich vor einem Junktim des deutschen Zugriffs mit irgendwelchen liberalen Idealen. Ausdrücklich und programmatisch spricht sich der liberale Außenminister in Bezug auf China von dem Grundsatzbeschluß frei, auswärtigen Gesprächspartnern mit dem Moralismus der Menschenrechte auf die Nerven zu fallen;[8] und zwar unter Berufung auf den für Weltpolitiker unerläßlichen Realismus, der es gebietet, in China einen unendlich wichtigen „Markt von morgen“ zu sehen, den es heute schon zu erschließen gelte. Daß es darum geht, in und mit China – und außerdem in und mit Südkorea, Indonesien, Indien, den wichtigsten besuchsstationen der letzten Weltreise des Kanzlers; in Lateinamerika usw. – starke Konkurrenzpositionen gegen Japan und die USA aufzubauen, wird im Namen desselben Realismus auch nicht verschwiegen, sondern offensiv vertreten. „Wir dürfen diese Märkte nicht den andern überlassen“ – heute schon gar nicht, wo es um die Chancen geht, besser als die Konkurrenz aus der Krise der Weltwirtschaft und der Schrumpfung des Welthandels herauszukommen. Da bleibt es also wieder einmal den Amerikanern überlassen klarzustellen, daß China wegen unerlaubten Waffenhandels unter ein Handelsembargo gehört, und damit – ähnlich wie im Fall des hemmungslosen westeuropäischen Handels mit Saddam Hussein – der Konkurrenz zu eröffnen, daß es noch ganz andere Konkurrenzfragen als solche des friedlichen Geschäfts gibt und daß es im Fall China eben um so ein Problem der höheren Ordnung geht. Natürlich im Namen genau der Menschenrechte, die wiederum der deutsche Außenminister ausgerechnet im Falle Chinas für extrem „unrealistisch“ hält…
In diesen Streit der gehobenen Sorte hat auf deutscher Seite eine starke Gruppe eher rechter Bundestagsabgeordneter eingegriffen, die damit die zweite Gegenprobe auf die neue Stoßrichtung des Menschenrechts-Arguments geliefert haben: Unter Berufung auf die Unerträglichkeit von Folter und Gefängnis – anderswo… – fordern sie von ihrer Regierung, das Verbot eines umfangreichen Waffengeschäfts zurückzunehmen, das der Außenminister mit Blick auf die verheißungsvolle deutsch-chinesische Freundschaft durchgesetzt hat. Der „Taiwan-Fraktion“ geht es beim Export dieser heißen Ware nicht bloß ums Geschäft, sondern um die Verankerung des deutschen Einflusses auf die militärische Konkurrenz in der Region, also um einen weltpolitischen Kontrollanspruch, den man noch weniger als den 1-Milliarde-Kunden-Markt den USA und Japan überlassen darf, den man sich notfalls sogar ein paar Geschäftschancen in China kosten lassen muß. So stimmt der deutsche Menschenrechts-Standpunkt wieder: Wer deutsche Waffen importiert, der bekommt den moralischen Rechtstitel auf ihren Einsatz gratis mitgeliefert.
Auch, wenn Taiwan einstweilen ohne deutsche U-Boote bleiben muß: Den Aufbau eines weltweiten Netzes militärischer Einflußpositionen betreibt das neue Deutschland massiver als je zuvor, gerade in Südostasien: Thailand und Singapur bekommen Waffen; den Indonesiern hat der Kanzler bei seinem Besuch im Frühjahr 39 Kriegsschiffe aus NVA-Beständen und 3 neue U-Boote zugesagt, die die indonesische Kriegsmarine zur stärksten der Region machen würden; usw. In weltweiter Mission ist auch der deutsche Verteidigungsminister unterwegs, auch er mit Sonderangeboten aus dem ohnehin abzubauenden Arsenal der NVA im Gepäck: Überall, wo auf Wirtschaftsbeziehungen Wert gelegt wird, wirbt der Befehlshaber der Bundeswehr um gute Beziehungen zwischen den Armeen, selbstverständlich im vorbildlich zivilen Geist der „inneren Führung“. Man sieht, über ihrer Konkurrenz um das Mitmischen bei der obersten totalen Kontrolle über die Staatenwelt insgesamt versäumen die Deutschen es keine Stunde, in die Konkurrenz um eine gerechtere Aufteilung der Welt, nämlich des bestimmenden Einflusses auf fremde Regierungen, einzusteigen.
Der Schwerpunkt der Mission, die den deutschen Verteidigungsminister um die Welt treibt, liegt übrigens auffälligerweise im Osten, in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Die sollen in die Nato zwar nicht hinein; aber beim Nato-Kooperationsrat, diesem eigentümlichen Gesprächsforum, das die Allianz für die Erbengemeinschaft ihres ehemaligen Hauptfeindes eingerichtet hat, möchte man es in Bonn, was Militärfragen betrifft, auch nicht bewenden lassen. Bilaterale Verträge über gute Zusammenarbeit mit den Resten und nationalen Nachfolgetruppen der Roten Armee sind anscheinend ein zentraler Punkt in einem weiteren erklärten Anliegen deutscher Weltpolitik. Deutschland wünscht nämlich nachdrücklich:
Den Erfolg der Reformen in Rußland
Was die ökonomische Seite dieses sogenannten Reformprozesses betrifft, so hat die Bonner Regierung beschlossen, daß sie für deren Erfolg nicht mehr viel tun kann, jedenfalls nicht mit Geld. Davon hat man, nach eigener Auffassung, schon mehr als genug bezahlt – was für Posten auch immer da zusammengezählt werden – und per Saldo feststellen müssen, daß solche Hilfe für die „Umstellung auf die Marktwirtschaft“ nichts bewirken könne, solange diese Umstellung nicht gelungen ist.
Was hingegen schon vorher gehen muß, schon deshalb, weil Deutschland sein Recht darauf politisch einklagt, ist die pünktliche Bedienung der Schulden, die Rußland bei deutschen Gläubigern hat. Mit dieser Botschaft ist der Moskauer Ministerpräsident bei seinem Bonn-Besuch im Sommer empfangen worden; und mit seiner launigen Entgegnung, unter Freunden spräche man nicht über Schulden und Zinsen, hat er sich unter seinen Gastgebern keine Freunde gemacht. Die wüßten nämlich durchaus, wie man, Marktwirtschaft hin oder her, den Schuldendienst zum Fließen bringen könnte:
„Rußland ist mit Rohstoffen gesegnet wie kaum ein anderes Land auf dieser Erde. Es muß nun im Rahmen der gesamteuropäischen Energiecharta die notwendige Rechtssicherheit zur Sanierung der russischen Erdöl- und Erdgasindustrie herstellen.“ (Kinkel, FAZ 19.3.93)
Was daneben auch geht, ganz einfach weil es sich lohnt, sind alle möglichen Direktgeschäfte zwischen deutschen Unternehmern und einzelnen Kombinaten oder auch Regionen im großen ehemaligen Sowjetreich. Zum Beispiel der Billigeinkauf russischer Rohstoffe; der Billigexport deutschen Giftmülls; die zinsbringende Verwaltung von Devisenkonten, auf denen russische Geschäftemacher das Verdiente vor ihrem Staat in Sicherheit bringen, ohne daß deutsche Aufsichtsbehörden hier „organisierte Kriminalität“ argwöhnen. So kommt auf deutscher Seite doch noch manch schöner Gewinn zustande, wenn auch keine solide, dauerhafte kapitalistische Geschäftsverbindung. Denn auf der russischen Seite wird mit solchen Extrageschäften erstens der ökonomische Ruin vorangetrieben, zweitens jede Chance untergraben, daß die zentrale Staatsgewalt jemals die Kontrolle über die letzten Reichtümer ihrer Regionen, über das Geschäftsgebaren ihrer Betriebe, also über ihre elementaren Funktionsbedingungen gewinnt.
Diese Wirkung kommt einerseits ganz von selbst zustande, nämlich einfach deswegen, weil die deutsche Politik bei ihrer „Rußland-Hilfe“ ihre Sorgen mit Rußland im Blick hat und alle Chancen ausnutzt, sich schadlos zu halten; dies um so mehr, als die westlichen Partner dasselbe versuchen, man also aufpassen muß, nicht zu spät zu kommen. Ein bloßer Nebeneffekt ist es andererseits nicht, wenn die Reformhilfe aus dem Westen das Ihre zum ökonomischen Bankrott und politischen Zerfall Rußlands beiträgt. Zumindest verbindet jede der mitmischenden Weltwirtschaftsmächte damit ihre politischen Berechnungen. Die haben den einen gemeinsamen Nenner – insoweit lebt auch da der Freie Westen als politische Interessengemeinschaft noch ein wenig fort –, daß der Haupterbe der Sowjetmacht endgültig und unwiderruflich aufhören soll, Großmacht zu sein, und gar nicht erst wieder anfangen darf, Weltpolitik treiben zu wollen. Der deutsche Außenminister hat in diesem Sinne schon im Frühjahr im Kreis der Großen Sieben festgestellt, man dürfe Rußland keine „Garantiemachtrolle“ für das Gebiet der früheren Sowjetunion zugestehen und auch nicht dulden, daß russische Truppen im Baltikum stationiert blieben, bis der Rechtsstatus der russischen Minderheiten in diesen Ländern irgendwie gesichert wäre. Im Sommer mußte er sich dann schon wieder darüber wundern, daß sein russischer Kollege sein Land noch immer für eine „Weltmacht mit Interessen“ hält; erklären konnte er sich das nur so, daß dieser Überrest des untergegangenen Sowjetreichs „im Trubel der Ereignisse den Verlust seiner Weltmachtstellung nicht wahrgenommen“ hat. Der definitive Zusammenbruch der russischen Macht kann demnach deutscherseits als Faktum in Rechnung gestellt werden.
Das ist sehr frech gedacht und keineswegs die ganze Wahrheit. Zumindest die ehemals sowjetischen Atomwaffen vermitteln den deutschen Sicherheitspolitikern durchaus noch eine bange Ahnung von noch vorhandenem Weltmachtpotential auf russischem Boden. Sie stellen sich zu diesem Objekt ihrer Sorgen aber schon gar nicht mehr so, daß sie darin das Potential einer Weltmacht respektieren. Was sie fürchten, ist die Gefahr, bestimmte Waffen könnten „in falsche Hände geraten“ – fast so, als wären sie bei der alten Roten Armee noch am sichersten aufgehoben. Gemeint sind mit den „falschen Händen“ zum einen eventuelle unkontrollierte Zerfallsprodukte des ehemals sowjetischen Militärs; doch daß aus der russischen Armee eine disziplinierte, schlagkräftige Truppe wird, die das ganze Land fest genug im Griff hat, um jedes militärische Bandenwesen garantiert zu unterbinden, das wünscht man sich in Bonn durchaus nicht – das hatte man ja 40 Jahre lang. Und das ist die viel größere Sorge: daß „Kräfte“ an die Macht kommen, die für ein starkes Rußland plädieren und versuchen könnten, aus den Trümmern der Sowjetmacht doch wieder eine zur Selbstbehauptung und Einflußnahme fähige, nach innen und außen souveräne Staatsmacht zu schmieden, die sich am Ende mit den anderen großen GUS-Republiken wiedervereinigt.
Insoweit wirkt der Nachruf auf jegliche von Moskau aus kommandierte Weltmacht fast etwas verfrüht – aber um eine Tatsachenfeststellung geht es dem deutschen Außenminister ohnehin nicht, wenn er das Ende der östlichen Machtzusammenballung ausruft. Er reklamiert damit für seine Seite das Recht, dem russischen Staat keinerlei außenpolitische Interessen zuzugestehen, ihn vielmehr wie eine Art Entwicklungsland zu behandeln, seine Atomwaffen quasi als herrenloses Gut, das unter westliche Aufsicht gehört, und in den innerrussischen Machtkampf so hineinzuwirken, daß kein falsches Ergebnis herauskommt. Die dreiste Manier, den eigenen Anspruch als einen in der Sache liegenden Zwang darzustellen, um dem eigenen Interesse Recht zu geben, beherrscht jeder bürgerliche Politiker; deswegen wundert sich auch niemand, wenn aus dem behaupteten Ende der russischen Macht umstandslos die Notwendigkeit gefolgert wird, ihr ein Ende zu machen.
Mit diesem Ziel sind Abgesandte aller westlichen Nationen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion unterwegs. Denn das ist für alle Anwälte einer ordentlichen Welt unübersehbar, daß da eine ganze Region unter Kontrolle gebracht werden muß. Und dieser Notwendigkeit entzieht sich keine der Mächte, die für Kontrolle über andere geradestehen. Denn einerseits brauchen sie alle einander, weil die Aufgabe für jede von ihnen allein zu gewaltig ist; andererseits wird da die Zuständigkeit für eine halbe Welt aufgeteilt, und dabei will keiner der Staaten fehlen, die um nichts anderes als die Verteilung der Macht über die Welt konkurrieren.
Also mischt sich auch Deutschland ein, mit dem Vorrecht des großen Nachbarn; nutzt alle alten und neuen Beziehungen, um sich in den ex-sowjetischen Nachbarländern Rußlands und in den russischen Provinzen – bis hin zum deutschen Rayon bei Omsk – einzunisten; schickt den Verteidigungsminister zu allen wichtigen Befehlshabern; greift sich Hauptabteilungen der ehedem sowjetischen Weltraumfahrt… Das alles keineswegs mit dem Ergebnis, daß es dadurch ein Stück wirklicher Macht in den Griff bekommen würde, geschweige denn ein sanftes Ende der russischen Großmacht wirklich garantieren könnte; man kommt sich ja auch dauernd mit den Diplomaten, Waffenhändlern, Abrüstungsexperten und Geheimdiensten der Verbündeten in die Quere, mit denen man zusammenarbeitet. Aber das ist ja nirgends so, daß Deutschland die brisanten Fragen, in die es sich mit seinem neuen Anspruchsniveau und Rechtsbewußtsein einmischt, gleich unter Kontrolle hätte; und das ist nirgends ein Hindernis für deutsche Vorstöße, die dem Rest der Welt zu schaffen machen. In Rußland jedenfalls verfolgt die Nation schon wieder ganz offensiv ihre neue Linie, daß sie nichts an politischer Einflußnahme und kein Stück Zugriff und Kontrolle ihren Partnern überlassen darf. Mit denen geht sie Zweckbündnisse ein, etwa in der Frage der russischen Schulden oder für die Abrüstung; aber Unterordnung wie in alten Zeiten, als die BRD sich wichtige Prämissen ihrer Politik, gerade im Osten, vom Bündnis abgeholt hatte, kommt nicht in Frage. In Konkurrenz gegeneinander betreiben sie ihre gemeinsame Einmischung – einig immerhin darin, daß sie alle gegen ein starkes, weltpolitisch konkurrenzfähiges Rußland sind und keiner anfangen soll, mit so einer Alternative zu kalkulieren.
*
So sieht es also aus, wenn Deutschland – nach Aussage seiner führenden Häupter – normal wird. Es bereitet sich in neuer Weise auf weltweite Kriegseinsätze vor; aber das für sich ist gar nicht das Entscheidende; daß die gesamte demokratische Debatte zwischen Regierung und Opposition sich um nichts als die Reichweite der deutschen Kriegsbereitschaft dreht, erfüllt geradezu den Tatbestand der Ablenkung. Entscheidend ist der Standpunkt, von dem aus die Nation ihre Einmischungsrechte definiert und wahrnimmt. Der schließt eine Menge Militarismus ein – aber kriegsbereit, sogar weltkriegsbereit war die alte BRD, solange es sie gab; und an ihr lag es nicht, daß diese Bereitschaft nie auf die letzte praktische Probe gestellt wurde. Deutschlands Standpunkt in der Welt ist der des zutiefst berechtigten Anspruchs, sämtliche äußeren Bedingungen seiner Macht autonom in Konkurrenz zu allen anderen Mächte, die Gleiches wollen, zu diktieren; die anderen Staaten darauf festzulegen, sich selber umgekehrt auf nichts festlegen zu lassen; keine Prämissen für die eigene Politik zu kennen, geschweige denn anzuerkennen, die seinem Konkurrenzwillen entzogen wären. Mit einem Wort: Deutschland will – endlich wieder! – so imperialistisch werden, wie es seit dem 2. Weltkrieg im strengen Sinne nur die USA waren.
Aus diesem Standpunkt folgt keineswegs bloß für die Bundeswehr eine neue Auftragslage. Er bringt nicht bloß alle sicherheitspolitischen Kräfteverhältnisse und Bündnisbeziehungen durcheinander. Er ändert ebenso alles, was Deutschland in seiner Eigenschaft als „Zivilmacht“, im Bereich von Handel und Wandel, will und betreibt. Denn mit seinem neuen weltpolitischen Ehrgeiz hört diese Nation ja mitnichten auf, zuerst und vor allem Weltwirtschaftsmacht zu sein und erfolgreich bleiben zu wollen; eben dafür wird sie ja so kriegerisch; und das ist schon Beweis genug, daß sie ihre Weltwirtschaftsmacht auch anders exekutiert als bislang.
So hat es eine schärfere Bedeutung als früher, wenn alle deutschen Außen- und Wirtschaftspolitiker heute die uralte Maxime der bundesdeutschen Staatsräson bekräftigen, wonach ihr Land auf nichts dringlicher angewiesen ist als – nochmals – auf einen bedingungslos
Freien Welthandel
Bonner Politiker können gar nicht genug vor dem Unheil warnen, das über die Welt und ihre Wirtschaft hereinbricht, sollten die großen Wirtschaftsmächte auf den Versuch verfallen, ihre Krise durch Abschottung gegeneinander zu bewältigen. Gleichlautende Mahnungen sind übrigens aus so gut wie allen maßgeblichen Hauptstädten zu vernehmen; insofern besteht ja eigentlich überhaupt keine Gefahr… In Wahrheit gilt natürlich auch hier, daß, wenn alle einander vor demselben Fehler warnen, Drohungen ausgetauscht werden. Jeder kündigt an, daß er auch anders kann, nämlich protektionistisch, sollten die anderen an der falschen Stelle auf ihren Interessen bestehen; und dieser Fall tritt offenbar gerade ein, wenn die wechselseitigen Ermahnungen Konjunktur haben.
Die Deutschen jedenfalls sind sich sicher, daß in und wegen der nichtendenwollenden „weltweiten Rezession“ Versuche der Partner zur Korrektur der internationalen Geschäftsbedingungen fällig werden, die sie bekämpfen müssen. Sie wissen das von sich selbst: Sie melden ja, gegen Japan vor allem und auch gegen die USA, das dringliche nationale Bedürfnis an, die Ergebnisse des freien Welthandels politisch zu korrigieren und hierfür den Protektionismus ihrer Konkurrenten zu brechen – i.e. alles, was sie als solchen interpretieren, vom deutsch-amerikanischen Luftverkehrsabkommen bis zu den japanischen Einkaufsgepflogenheiten. Aus demselben Grund fällt es ihnen leicht zu antizipieren, was auf den Weltmärkten erst los ist, wenn die Krisenüberwindungs- und Standortsicherungsprogramme, mit denen derzeit alle großen kapitalistischen Nationen ihre inneren Verhältnisse reformieren, demnächst für gescheitert erklärt werden müssen und die Schuldfrage von jeder Nation endgültig mit dem Verweis auf die Machenschaften der anderen beantwortet wird. Folgerichtig erklären sie eben den Kampf um einen „freien“, nämlich für sie gedeihlichen Welthandel zum vorrangigen Anliegen ihrer Außenpolitik und engagieren sich in einer Konkurrenz, die nicht mehr bloß unter den Bedingungen und vereinbarten Regeln des Weltgeschäfts geführt wird: Es geht um deren Neudefinition im Sinne der eigenen nationalen Bedürfnisse gegen die Partner, gerade dann, wenn die darüber gar nicht mehr aus ihrer Wirtschaftskrise herauskommen.[9]
Ein für Deutschland besonders wichtiger Fall in diesem Streit liegt bereits seit längerem an und ist unter den neuen Vorzeichen akut und kritisch geworden: die Fortschreibung des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens in der seit mehreren Jahren sich hinziehenden „Uruguay-Runde“. Die EG und die USA sind sich erst lange nicht über ein paar neue welthändlerische Zugriffsrechte einig geworden; dann wurde im Herbst vorigen Jahres ein Kompromiß erzielt; Frankreich als Hauptbetroffener hat sich nicht wunschgemäß durchsetzen können. Jetzt widersetzt es sich und meldet das unabweisbare Bedürfnis an, die Vereinbarung „nachzubessern“, was Amerika genauso strikt ablehnt. Die Materie des Streits ist für Frankreich sehr, für die USA weniger wichtig, für beide Seiten aber gut genug, ihre unvereinbaren Interessen zur Existenzfrage zu erklären; an ihrem Getreidekrieg wollen sie das Grundsatzproblem aufwerfen, wie es überhaupt mit dem Welthandel weitergehen soll. Deutschland nimmt – wie in jeder französisch-amerikanischen Streitfrage – die Position des interessierten Vermittlers, also einen mit beiden Kontrahenten unvereinbaren dritten Standpunkt ein, weil es für seine Stellung in der Weltwirtschaft beide braucht. Dieser Standpunkt hat für Franzosen wie Amerikaner Gewicht; denn Deutschland ist weder bloßes Anhängsel der einen oder anderen Seite noch bloßer Betroffener eines „Streits der Großen“. Deren Streit wird umgekehrt erst dadurch so bedeutend, daß der „Exportweltmeister“ involviert ist. Damit steht nämlich wirklich die Prinzipienfrage an, ob Frankreich den europäischen Protektionismus als Grundbedingung eines freien Welthandels durchsetzt oder die USA das Recht des Stärkeren, einem gar nicht schwachen Schwächeren im Bedarfsfall den Ruin eines für diesen wichtigen nationalen Wirtschaftszweigs aufzuzwingen. Deswegen kommt es Frankreich wie Amerika sehr darauf an, die Deutschen jeweils auf ihre Seite zu ziehen.
Deutschland hatte sich zunächst entschieden:
„Deutschland hat sich hier“ – nämlich bei den GATT-Verhandlungen – „bislang in der Gemeinschaft sehr solidarisch gezeigt. In dieser nicht nur für uns, sondern für den Osten und Süden ebenfalls“ – Heuchelei nebst Verweis auf das supranationale Gewicht der eigenen nationalen Position dürfen nicht fehlen! – „lebenswichtigen Frage darf aber Solidarität in der Gemeinschaft keine Einbahnstraße sein.“ (Kinkel, FAZ 19.3.93)
– also gegen das französische Interesse, aber im Rahmen einer „solidarischen“ EG-Lösung mit Ausgleichsfonds und unter Wahrung protektionistischer Prinzipien; so entschied dann auch die EG. Gegen diesen „Kompromiß“, mit dem allein Deutschland seine Interessen voll wahren konnte, erhebt Frankreich jetzt Einspruch. Es will das Entweder-Oder, das die deutsche Seite nicht gelten lassen will und gerade abgewehrt hatte. Die Deutschen sehen sich herausgefordert, rein nach ihrem nationalen Interesse zu entscheiden; eine Alternative allerdings, die sie, zumindest jetzt und so, um keinen Preis wollen. Sie unterliegen einem Entscheidungszwang, den sie viel lieber ihren Partnern aufgemacht hätten.
Diese Zwangslage hat – wie alle Probleme der Krisenkonkurrenz, die Deutschland derzeit meistern will – eine ökonomische und eine politische Seite. Mit der Krise stellt sich nämlich mit der Wucht eines Sachzwangs die Frage, ob es überhaupt noch einen politischen Konsens über den freien Welthandel gibt, mit dem Deutschland seine „weltmeisterliche“ Stellung auch nur bewahren, geschweige denn wunschgemäß ausbauen kann. Politisch sieht es sich von seinem Partner Frankreich ultimativ vor die Frage gestellt, ob es einen solchen Konsens – dessen Nutzen in dem einen wie dem anderen Fall völlig zweifelhaft ist! – mit Frankreich gegen die USA oder gegen Frankreich und damit, wenigstens vom französischen Standpunkt aus, gegen Europa überhaupt suchen will. Mit diesem Ultimatum wehrt sich die französische Regierung gegen eine Notlage, in die sie sich ihrerseits durch die deutsche Politik versetzt sieht. Denn wenn die Nation heute nicht mehr aushält, was sie ein knappes Jahr zuvor allenfalls noch hinzunehmen bereit war, und darüber von den Bonnern eine klare Entweder-Oder-Entscheidung über die Zukunft eines deutsch-französischen Europa erreichen will, dann hat das sehr viel mit der Art und Weise zu tun, auf die Deutschland seit einigen Monaten sein erklärtes politisches Hauptziel verfolgt:
Die Einigung Europas
Das Maastricht-Programm steht felsenfest, versichert die Regierung. Bei den Randbedingungen allerdings haben sich ein paar Änderungen ergeben. So beim Zeitplan – der immerhin vertraglich festgelegt ist –: Der soll zwar nach wie vor gelten, einerseits; andererseits kann sich die deutsche Führung ganz gut auch einen mehrjährigen Aufschub des Jahres 99 vorstellen, mit dessen erstem Januar die Wirtschafts- und Währungsunion quasi automatisch in Kraft treten soll. Das läßt jedenfalls aus seinem Urlaub derselbe Kanzler verlauten, der noch nach dem Abschluß des Maastricht-Vertrags nach dem Motto „Jetzt oder nie!“ die Notwendigkeit beschworen hatte, schleunigst auf den Zug, das Rad oder den Mantel der Geschichte aufzuspringen, um nicht eine unwiederbringliche Gelegenheit zur Vollendung Europas zu versäumen. Anschließend ist dem deutschen Finanzminister ein Junktim eingefallen, das in Maastricht nun wirklich nicht vereinbart worden ist: Das Europäische Währungsinstitut, das, vorbereitend ab kommendem Jahr, für das gemeinsame Geld zuständig sein soll, muß nach Frankfurt am Main – „oder aus der ganzen Sache wird nichts!“ Da hat sich dann doch mancher gute Europäer gewundert, warum Raum und Zeit auf einmal so kritisch ins Spiel kommen, und des völlig richtigen Eindrucks nicht erwehren können, daß es natürlich um die Sache geht.
Mit der steht es grundlegend anders als in Maastricht beschlossen,[10] seit „die Spekulation“ im Sommer 93 auch ihre zweite Runde gegen das Europäische Währungssystem gewonnen hat und der darin garantierte Währungsverbund zwischen D-Mark und Franc praktisch und in aller Form aufgelöst ist. Zwar wurde die Einstellung der Währungsgarantie Deutschlands für seine EWS-Partner nach Kräften beschönigt: Sie wurde als bloße Erweiterung der zulässigen Schwankungsbreite des Wechselkurses der schwachen Währungen von 2,25 auf 15 % nach unten und oben organisiert – als wäre dadurch immer noch „im Prinzip“ garantiert, was das EWS garantieren sollte und auch jahrelang garantiert hat, nämlich die Gleichwertigkeit aller nationalen Gelder, die sich auf dem Gemeinsamen Markt kapitalistisch verdienen und vermehren lassen; außerdem soll diese „Lockerung“ des Währungsverbundes selbstverständlich nur seiner alsbaldigen Festigung dienen – so wie im vorigen Jahr ja auch schon die Lira nur ausgeschieden ist, um noch vor Weihnachten wieder beizutreten, und die Pesete nur abgewertet wurde, um stabil zu bleiben; mit bekanntem Ergebnis. Solche Schönfärberei war freilich auch nötig; denn tatsächlich ging es um ganz andere Dinge als „Turbulenzen“, wildgewordene Spekulanten und eine „Beruhigung der Märkte“.
Erstens ist die Spekulation ein Angriff auf die Fiktion, der Kreditüberbau der kapitalistischen Nationen, die in ihren Währungen notierten Schulden, wären so gut wie kapitalistisch verdientes Geld. Sie bewerkstelligt die Entwertung von Kredit, der nichts mehr taugt. Auf diese Weise gesteht das großartige marktwirtschaftliche System ein, daß es wieder einmal über-akkumuliert und sich mit seinen Erfolgen in eine Krise hineingewirtschaftet hat. Zweitens ist die Devisenspekulation ein Angriff auf die weltweit zirkulierende Kreditmasse, der zwischen besserem und schlechterem Kreditgeld unterscheidet, diesen Unterschied ausbeutet und so die schwächeren nationalen Währungen zugunsten der stärkeren ruiniert. Drittens findet dieser kritische Währungsvergleich deswegen auch in Europa so hemmungslos und so wirkungsvoll statt, weil die Machthaber über die stärkste, die „Anker“-Währung dieses für andere ruinöse Geschäft mit der Entwertung nicht von vornherein aussichtslos gemacht, sondern eher ins Recht gesetzt haben. Gegen den Verdacht, ihre deutlich geäußerte Distanz zu dem Projekt und den Partnern einer immer engeren Verknüpfung der nationalen Währungen – „in deren derzeitigem Zustand…“ – hätte der Spekulation überhaupt erst die Richtung gewiesen, wehrt sich die deutsche Seite nur matt und mit dem aufschlußreichen Hinweis, letztlich sei jede Nation noch selbst für ihre Geld-, Zins- und Währungspolitik verantwortlich.
Viertens schließlich haben die deutschen „Währungshüter“ mit der Auflösung des EWS in seiner alten Form und Funktion aus der Kreditkrise, die die Währungsreserven ihrer Partner aufgezehrt hat, den politischen Schluß gezogen, daß es mit Europa nun definitiv nicht mehr so weitergeht wie bisher. Sie haben eine Politik für undurchführbar erklärt und aufgegeben, die sich vorgenommen hatte, das europäische Wirtschaftsgeschehen einschließlich des freien Währungsvergleichs in Richtung auf eine Wirtschafts- und Währungsunion zu beeinflussen und in diesem Sinne die Entwertung des einen nationalen Kreditgeldes und die komplementäre Stärkung des anderen – nämlich, bislang, des deutschen – zu bremsen, womöglich zu verhindern. Stattdessen bestehen die Währungspolitiker aus Bonn und Frankfurt kompromißlos auf der Stabilität ihrer Mark, gegen alle schwächeren europäischen Alternativwährungen. Von dem gesamten Währungsverbund wollen sie, rückblickend aufs EWS und vorausblickend auf die Währungsunion à la Maastricht, nur noch wissen, daß er der D-Mark eine Last aufgebürdet hätte, die ihren einzigartigen Wert in Gefahr brächte. Bekenntnisse zur WWU legen sie gerne ab, knüpfen die Sache aber an die Bedingung, daß der Super-GAU einer DM-Schwächung mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen wird, den sie mit absoluter Sicherheit für den Fall voraussagen, daß die WWU in Kraft tritt. So kann niemand mehr an ihrer Entschlossenheit zweifeln, ihre Hartwährungswirtschaft zu verteidigen; auf Kosten ihrer Partner und erst recht aller Hoffnungen, die diese auf eine Gemeinschaftswährung gesetzt haben mögen.
Ob diese Konkurrenzrechnung aufgeht, ist höchst fraglich – das Dümmste war der alte Standpunkt ja auch nicht, ein Währungsverbund könne der D-Mark nur nützen, weil dadurch andere nationale Gelder praktisch zu ihren Unterabteilungen werden und sie als „Leitwährung“ den Reichtum, d.h. die kapitalistische Ertragskraft eines halben Kontinents repräsentiert. Aber um eine rein innerökonomische Kalkulation vom Maßstab der Währungsstärke her geht es sowieso nicht, auch wenn die Bundesbankiers es in ihrem bornierten Stolz auf ihr Geschöpf gerne so darstellen. Wenn Deutschlands Führung sich aus den alten und den in Maastricht beschlossenen neuen Währungsbeziehungen heute nur lauter Nachteile ausrechnet – und damit den dümmsten Nationalisten recht gibt, die Deutschland schon immer in der Rolle des „Zahlmeisters der EG“ gesehen haben –, dann zeigt das ihre Rechnungsart: Sie will diese Beziehungen nicht. Die Alternative ist schlicht: Wer ein einiges Europa als neues (supra)nationales Konkurrenzsubjekt in der Welt haben will und dafür eine starke Währung, der macht die Union und sorgt sich um deren Geld. Wer umgekehrt die Stärke der eigenen nationalen Währung über alles stellt und die Kombination mit den vergleichsweise wackligen Kreditgeldern der Partner als Gefahr für das Projekt einstuft, der geht vom Standpunkt der währungspolitischen Konkurrenz gegen die anderen gar nicht ab. Und das ist der Standpunkt der Deutschen. Mit der Zustimmung zum Maastricht-Vertrag hat diese Nation noch – und wohl zum letzten Mal – ihre europäische Zukunftschance so definiert, daß sie durch Souveränitätsverzicht, sogar in der wichtigsten nationalökonomischen Angelegenheit: beim Geld, an wirklicher nationalökonomischer Souveränität entscheidend hinzugewinnen könnte; nämlich gegen die sonst uneinholbar überlegenen Konkurrenten Japan und USA. Jetzt besteht Deutschland auch im Verhältnis zu seinen europäischen Mitmachern erst einmal auf sich; es will europäische Gemeinsamkeit, schließt aber nichts mehr von seinem Willen aus, sich auch da konkurrierend durchzusetzen; den Beschluß, beim innereuropäischen Währungsvergleich nicht zu konkurrieren, macht es hinfällig.
Betroffen ist davon in erster Linie Deutschlands europäischer Hauptfreund. Frankreich mußte nicht bloß ein Stück Entwertung seines nationalen Geldes hinnehmen, sondern eine ökonomische Perspektive abschreiben, auf die es seine Planung einer französisch-europäischen Großmacht abgestellt hatte. Heute, wo die deutsche Vorteilsrechnung gegen jede innereuropäische Kreditgarantie ausfällt, wollen deutsche Zeitungskommentatoren, die neulich noch alternativlos für Europa waren, von einem französisch-deutschen Geschäft des höchsten Kalibers wissen: Zustimmung aus Paris zur deutschen Einheit gegen Zustimmung aus Bonn zur Währungsunion – eine Geschichtslegende, die von der heutigen Beschlußlage her die Sache so sieht, als wäre das einheitliche Euro-Geld für die Deutschen schon immer eindeutig ein einseitiges Opfer gewesen. Die Moral der Geschichte ist deswegen auch keine Anklage gegen die deutsche Perfidie, sondern Zufriedenheit, daß die Nation – „endlich wieder“ – auf ihren nationalökonomischen Vorteil und sonst gar nichts achtet. Diesem Standpunkt entspricht umgekehrt die französische „Irritation“; und der Beschluß der Pariser Regierung, auf den kaum beigelegten GATT-Streit Europas mit Amerika zurückzukommen, ist gleich in zweierlei Hinsicht die adäquate Reaktion. Erstens sieht Frankreich, nachdem ihm die Stützung seiner Währung durch die deutsche Weltwährung – Spekulation und Krise hin oder her – entzogen und die Aussicht auf eine Vereinigung beider Währungen fragwürdig geworden ist, gar keine guten Gründe mehr, dem deutschen Partner in irgendeiner Außenhandelsfrage entgegenzukommen; stattdessen um so mehr die Notwendigkeit, um seiner Bilanzen willen auf jedem Anteil am Weltgeschäft zu bestehen. Zweitens probiert es eine Erpressung: Es testet ultimativ die deutsch-französische Solidarität gegen die USA und dringt damit zugleich auf eine Korrektur der Richtungsentscheidung, die der Bonner Partner mit seiner „D-Mark zuerst!“-Politik getroffen hat. Das gewählte Erpressungsmittel ist bezeichnend: Nicht bloß für Frankreich war der gemeinsame Antiamerikanismus noch allemal die stärkste Klammer der EG.
Und auch für Deutschland steht eins noch immer fest: Die EG, vor allem deren zweitgrößte Wirtschaftsmacht Frankreich, ist unentbehrlich, um die Konkurrenz mit den USA und Japan erfolgreich durchzustehen. Das gilt gerade auch von dem Standpunkt des nationalen Erfolgs aus, der sich in der Absage an den währungspolitischen Supranationalismus in Europa geltend macht. Deswegen hat die Bundesregierung sich so beeilt, gleich nach der Auflösung des EWS im Streit mit Frankreich ungebrochene deutsch-französische Harmonie vorzuspiegeln und den Abbruch des Währungsverbunds als unumgängliche „Anpassung“ des „Maastricht-Prozesses“ an „die Realitäten“ hinzustellen. Aus demselben Grund ist Deutschland auch durch das Ultimatum zu treffen, das der französische Partner gleich anschließend am GATT-Streit aufgemacht hat; die Erbitterung des Kanzlers belegt den Ernst, mit dem man nun in Bonn nach einem Kompromiß zwischen dem EG-Kompromiß mit Amerika und Frankreichs Kompromißlosigkeit sucht. Denn nach wie vor kalkuliert man dort so, daß Deutschland mit Europa weltwirtschaftlich steht und fällt – freilich mit einem Europa, das sich den deutschen Währungsinteressen erstens bedingungslos beugt und ihnen zweitens einseitig nützt.
Dafür, ein solches Europa zu erzwingen – auch wenn der wirtschaftliche Nutzen sich gar nicht erzwingen läßt –, baut die deutsche Politik ihre Erpressungspositionen auf. So hatte die Liquidierung des EWS einen bemerkenswerten politischen Aspekt: Deutschland hat sich da mit einem exklusiven Kreis von Kleinstaaten zusammengetan – einschließlich der Schweiz und Österreichs, also ohne dem Kriterium der EG-Mitgliedschaft eine übermäßige Bedeutung zuzuerkennen –, die aus seiner Sicht die Gewähr bieten, mit ihren Währungen die D-Mark nur zu stärken und mit gar keinem „Risiko“ zu belasten. Mit deren Hilfe haben die deutschen Währungspolitiker es erreicht, den französischen Rettungs- und Überbrückungsvorschlag zurückzuweisen, wonach das EWS zeitweilig ohne die D-Mark fortgeführt werden sollte, und damit eine bedeutende Klarstellung erzielt: Im Konfliktfall steht Deutschland keineswegs isoliert einem europäischen Block unter französischer Führung gegenüber; vielmehr versteht es noch allemal, den „harten Kern“ Europas zu bilden und alle schwächeren Mitglieder auf einen Platz in der zweiten Reihe zu verweisen. Damit nimmt eine „Europa-Idee“ Gestalt an, die bislang immer als uneuropäisch zurückgewiesen wurde, nämlich das „Europa der zwei Geschwindigkeiten“; mit der erheblichen Modifikation allerdings, daß nun, unter dem Druck des übermächtigen deutschen Währungsinteresses, auch Frankreich, das selbstverständlich immer auf den schnelleren „Geleitzug“ abonniert war, ein wenig in die langsamere Abteilung abgeschoben wird. Genau dagegen richtet sich die französische Politik, indem sie den Streit ums GATT heranzieht, um mit ihrem ganzen europäischen Gewicht in Bonn Protest gegen schlechte Behandlung und Mißachtung nationaler Interessen einzulegen; genau das betreibt die deutsche Politik, indem sie rigoros nach ihren währungsmäßigen Vorteils-Nachteils-Rechnungen unter den EG-Partnern sortiert.
Die alte europäische Einheit wird so auf alle Fälle untergraben. Ob aus dem Projekt eines von deutschen Interessen diktierten neuen europäischen Zusammenschlusses überhaupt etwas wird und etwas gleichermaßen Nützliches, ist völlig offen. Aber es wird daran gearbeitet: an einem deutschen Europa etwa in dem Sinn, in dem es seit der Rückeroberung der DDR stets, verräterisch genug, als deutsches Ziel abgeleugnet wird. Und nicht bloß im Westen: Wenn die Vorzeichen stimmen, kann man in Bonn durchaus auch mit der anderen Hälfte des alten Kontinents etwas Gesamteuropäisches anfangen. Denn schließlich hat Deutschland sich auch das vorgenommen:
Die Erweiterung der EG nach Osten
Offiziell wird dieses Vorhaben wie die logische Ergänzung zum Ziel der fortschreitenden Einigung Europas besprochen. Dabei weiß jeder, daß die Hereinnahme von Polen, der tschechischen Republik oder Ungarn mit einer Politischen und Wirtschafts- und Währungs-Union nach Maastrichter Muster unvereinbar ist – immerhin ist man EG-seitig bis auf weiteres erst einmal dabei, die Abschottung gegen das Elend perfekt zu machen, das die „marktwirtschaftlichen Reformen“ jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs anrichten; und man dosiert genau, mit welchen Billigexporten diese Länder den Binnenmarkt nicht stören und deswegen antreten dürfen. Der Widerspruch zwischen „Vertiefung und Erweiterung“ der EG muß aber keiner sein, wenn die „Vertiefung“ immer eindeutiger darin besteht, daß das stärkste Mitglied seine Nachbarn für seine nationalen Konkurrenzinteressen funktionalisiert und diese sich eine entsprechende Sortierung gefallen lassen müssen. In einem System der Unterordnung unter den Führungswillen einer Macht wäre, in dritter oder fünfter Linie, durchaus auch für benachbarte produktive Elendsregionen ein Platz zu finden.
Deutschland jedenfalls findet nichts dabei, seinen osteuropäischen Anrainern das Angebot zu machen, es werde sie „an Europa heranführen“, schon „um eine Wohlstandsgrenze quer durch Europa zu verhindern“ – mehr als das platte Dementi des Offensichtlichen fällt den Ideologen dieses Angebots gar nicht ein. Die „Führung“ – mit einem griechischen Fremdwort: „Hegemonie“ –, die den Osteuropäern da offeriert wird, wird bei Gelegenheit dahingehend verdeutlicht, daß sie anders als „über Deutschland“ ohnehin nicht „nach Europa“ gelangen, weil das nun einmal da liegt, wo es liegt: eine ziemlich erbärmliche Umschreibung des Anspruchs auf Unterordnung, ohne die die slawischen Nationen erst gar keine Chance bekommen, überhaupt irgendwie am EG-Kapitalismus zu partizipieren. Mit der geballten ökonomischen Erpressungsmacht des kapitalistischen Westeuropa tritt Deutschland ihnen entgegen und diktiert die Bedingungen, unter denen sie versuchen dürfen, sich nützlich einzugliedern. Das Europa, an das sie auf diese Weise „herangeführt“ werden, ist dann freilich alles andere als eine supranationale Idylle, deren integrierter und mitbestimmender Teil sie jemals werden könnten; eher ein Staatenbündnis mit einer deutschen Vormacht, die mit ihrer „Vermittlungstätigkeit“ das schafft, was es an gesamteuropäischer Einheit gibt.
Fazit
Deutschlands außenpolitische Konzeption ist klar genug. Es will seine weltwirtschaftliche Führungsmacht gegen seine Partner, die entweder Konkurrenten oder Instrumente und dementsprechend zu behandeln sind, ausbauen. Sein Europa-Engagement, einschließlich der Sonderbeziehungen zu Frankreich, und seine Weltwirtschaftspolitik der einvernehmlichen Absprachen über Konkurrenzbedingungen, einschließlich der Sonderbeziehungen zu Amerika, revidiert es unter dem Gesichtspunkt nationaler Durchsetzung als D-Mark-Macht. Überkommener Supranationalismus wird nicht mehr als Erfolgsmittel akzeptiert, wo erforderlich gekündigt.
Gleiches gilt für die Sicherheitspolitik. Sie wird nicht mehr vom westlichen Bündnis her definiert, sondern vom nationalen Recht auf universelle Aufsicht aus, das Deutschland nach eigener Einschätzung bislang viel zu zurückhaltend wahrgenommen hat. Ohne deutsches Vetorecht soll kein Stück Weltkriegsgeschichte mehr gemacht werden, stattdessen einiges davon unter deutscher Verantwortung, also unter der national kalkulierten Drohung deutscher Waffen und Truppen. Gemeinsamkeiten mit den Verbündeten werden gepflegt, soweit die nationale Kalkulation es gebietet. Umgekehrt wird bei allem Respekt vor den geltenden Verfahrensregeln kein Partner und schon gar nicht die alte Führungsmacht aus der Konkurrenz um die Richtlinienkompetenz in Sachen Weltherrschaft und um deren Aufteilung ausgespart – und sowieso keine Weltgegend, am allerwenigsten die brisante ungeordnete Hinterlassenschaft des ehemaligen sowjetischen Feindes.
Deutschlands Anspruch steht: In diesem Sinn will es normal werden. Es trägt damit sein Teil dazu bei, die Welt durcheinanderzubringen, indem es sie ordnet – in seinem Sinn. Die Ergebnisse hat es keineswegs souverän im Griff, auch kein Rezept für die erfolgreiche Bewältigung der Folgen; das setzt aber noch lange nicht die Kritiker ins Recht, die „das Konzept“ vermissen und damit ein Patentrezept für Erfolge meinen, das es in der Weltpolitik gar nicht geben kann, weil es dort um die Konkurrenz von Weltmächten geht. Im übrigen läßt Deutschland sich durch weltpolitische Defizite in seinem Vorwärtsdrang überhaupt nicht aufhalten; es nimmt sie als Herausforderung, und es nimmt diese an, auch ohne sein Wunschergebnis vorab abgesichert zu haben. Um in der Sprache der amtierenden rechtsradikalen Reformregierung zu reden: Die „Vollkasko-Mentalität der Deutschen“ ist in der Weltpolitik gründlich vorbei.
[1] Wie, dazu finden sich ein paar Ausführungen in dem Aufsatz zur „Normalisierung des deutschen Militarismus“ in GegenStandpunkt 2-93, S.49.
[2] Was im folgenden zum notwendigen Zusammenhang von Kapitalismus und Krieg behauptet wird, kann auch in systematischer Ableitung nachgelesen werden; denn es ist gar nicht so, daß der Marxismus es noch immer zu keiner besseren Imperialismus-Theorie gebracht hätte als zu der schlechten von Lenin: Imperialismus 1, in: Resultate Nr. 4, München 1979; zu beziehen über den GegenStandpunkt-Verlag.
[3] Näheres dazu berichtet der Artikel „Der Krieg in Bosnien. Nichts als ein Anlaß für den Kampf um die Dominanz der Weltmächte“ in diesem Heft.
[4] Alle Zitate in diesem Abschnitt aus der bereits zitierten Rede des Verteidigungsministers Rühe vom März 93.
[5] Mit Grund und Zweck der UNO und ihrer gegenwärtigen großen Aktionen befaßt sich der Artikel „Die UNO der 90er Jahre: Fortschritte des Imperialismus unter der Losung seiner Überwindung“ in GegenStandpunkt 1-93, S.15.
[6] Dem seinerzeitigen Generalsekretär der KPdSU war nach dem Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in die CSSR – zwecks „Rettung des Sozialismus“ – vorwurfsvoll nachgesagt worden, er hätte die „Souveränität sozialistischer Staaten“ für prinzipiell „beschränkt“ erklärt. Heute meldet der deutsche Außenminister stolz: Gegenwärtig bewegen wir uns vom Interventionsverbot im Namen staatlicher Souveränität hin zum Interventionsgebot im Namen der Menschenwürde und humanitären Hilfe.
(Kinkel, FAZ 19.3.93) Wenn das richtige „wir“ zum Aufmischen antritt, verfügt es eben auch über den richtigen Rechtstitel.
[7] Mit diesem Thema befaßt sich der Artikel „Der Verfall der Dritten Welt“ in GegenStandpunkt 4-92, S.175.
[8] Glaubwürdigkeit und Akzeptanz unserer Außenpolitik hängen wesentlich von unserem Engagement für die Menschenrechte ab. Daß wir mit diesem Ziel im täglichen außenpolitischen Geschäft immer wieder in Interessenskonflikte kommen und daß hierbei auch Kompromisse gefunden werden müssen, ist eine Realität, die aber die grundsätzliche Ausrichtung unserer Politik nicht in Frage stellt.
(Kinkel, FAZ 19.3.93)
[9] Was da von den G7 neu unternommen wird, erklärt der Artikel „IWF heute: Supranationaler Kredit unter der Bedingung der Krisenkonkurrenz“ in diesem Heft.
[10] Was in Maastricht beschlossen wurde, analysiert der Artikel „35 Jahre EG – Teil II: Vom Staatenbündnis zur Staatsgründung“ in GegenStandpunkt 3-92, S.107.