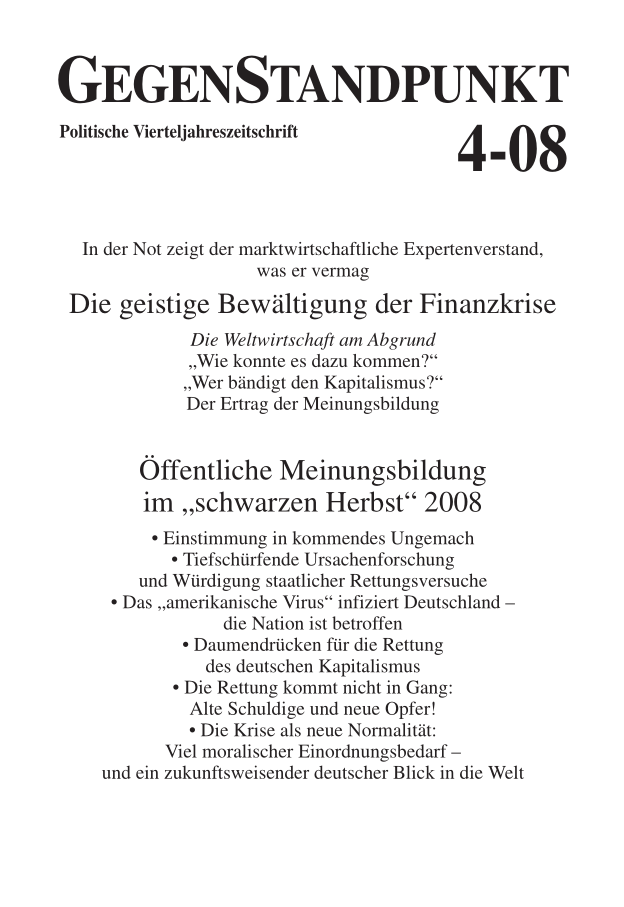Öffentliche Meinungsbildung im „schwarzen Herbst“ 2008
Mitte September 2008. In den USA eskaliert die Finanzkrise. Lehman Brothers, die viertgrößte amerikanische Investmentbank, ist pleite. Die zwei größten US-Hypothekenfinanzierer, Fannie Mae und Freddie Mac, werden durch Verstaatlichung vor dem Bankrott gerettet worden. Der größte Versicherungskonzern der Welt, AIG, ist in „beträchtlicher Schieflage“, wie es so schön heißt, und die Finanzwelt des gesamten Globus ist betroffen: „Bankpleite erschüttert die Börsen der Welt“, „Dax fällt erstmals seit 2006 unter 6000 Punkte“, „große Kursverluste nach Lehman-Konkurs.“ Die deutsche Leitkultur rückt die Finanzkrise ins Zentrum ihrer Betrachtungen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. Einstimmung in kommendes Ungemach
- 2. Tiefschürfende Ursachenforschung und Würdigung staatlicher Rettungsversuche
- 3. Das „amerikanische Virus“ infiziert Deutschland – die Nation ist betroffen
- 4. Daumendrücken für die Rettung des deutschen Kapitalismus
- Im Kanzleramt brennt noch Licht (ARD)
- Muss der Staat die Banken retten?
- Sparer können aufatmen!
- Starker Staat gefragt!
- Angst vor der Angst – Die gefährliche Psychologie der Finanzkrise!
- Die Märkte handeln völlig irrational! (Börse im Ersten)
- Wie sicher ist mein Geld?
- Die Merkel-Garantie
- Island kurz vor dem Staatsbankrott
- Nie wieder DDR!
- Ein Fall für Zwei!
- Gott
- Die Erwartungen sind groß!
- 5. Die Rettung kommt nicht in Gang: Alte Schuldige und neue Opfer!
- 6. Die Krise als neue Normalität: Viel moralischer Einordnungsbedarf – und ein zukunftsweisender deutscher Blick in die Welt
Öffentliche Meinungsbildung im „schwarzen Herbst“ 2008
1. Einstimmung in kommendes Ungemach
Mitte September 2008. In den USA eskaliert die Finanzkrise. Lehman Brothers, die viertgrößte amerikanische Investmentbank, ist pleite. Die zwei größten US-Hypothekenfinanzierer, Fannie Mae und Freddie Mac, werden durch Verstaatlichung vor dem Bankrott gerettet worden. Der größte Versicherungskonzern der Welt, AIG, ist in beträchtlicher Schieflage
, wie es so schön heißt, und die Finanzwelt des gesamten Globus ist betroffen: Bankpleite erschüttert die Börsen der Welt
, Dax fällt erstmals seit 2006 unter 6000 Punkte
, große Kursverluste nach Lehman-Konkurs.
Die deutsche Leitkultur rückt die Finanzkrise ins Zentrum ihrer Betrachtungen.
Mitten in den Krisenlärm posaunt der Doyen des ökonomischen Sachverstands der Süddeutschen Zeitung:
Der Kapitalismus lebt
!
„Milliardenvermögen wurden vernichtet, eine Weltrezession kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Kreditkrise hat sich erneut dramatisch verschärft. Sie ist aber, historisch betrachtet, keine beispiellose Krise, und schon gar nicht das Ende des Kapitalismus.“ (SZ, 18.9.)
Man merkt es, wie der Kapitalismus lebt
: Das Geld geht dahin, die Weltwirtschaft stürzt ab, jeder blickt besorgt in die Zukunft – alle Achtung! Eine Zerstörung gesellschaftlichen Reichtums in globalem Maßstab, ein weltweiter Einbruch von Produktion und Konsumtion, ganz aus sich heraus, und das in beispielhafter Manier nicht bloß einmal, sondern historisch betrachtet
immer wieder – welches System kriegt das schon hin! Aber was macht das schon, wenn nur das System überlebt! Unseren Kapitalismus desavouieren jedenfalls keine Misserfolge, wie das mal im realsozialistischen Osten der Fall war: Da haben ‚Mängelwirtschaft‘ und ‚Planungsfehler‘ unseren Systemkennern eindeutig bewiesen, wie verkehrt das ganze System ist, gerechterweise dazu verurteilt, auf dem Misthaufen der Geschichte zu landen wg. Misserfolg. Hier und heute ist das natürlich anders. Da muss man das Kurzfristige
– die Krise – vom Langfristigen
unterscheiden, und langfristig ist schließlich unser System Marktwirtschaft unverwüstlich; wenn mal vorübergehend alles kracht, dann ist das allenfalls ein Ausweis von Versäumnissen und Fehlern, die Krisenexperte Piper im Nachhinein scharfsinnig identifiziert:
„Krisen brechen immer dann aus, wenn Geld zu billig ist. Genau dies ist zu Beginn dieses Jahrzehnts geschehen. Viel billiges Geld löst Euphorie aus, der nach einiger Zeit unweigerlich die Depression folgt.“
Klar, wenn der ganze Wachstumsoptimismus nichts als überspannte Euphorie war, wie wir heute wissen, ist hinterher unweigerlich
Katerstimmung. Außerdem ist dieser Fehler woanders passiert, nämlich in Amerika; und wenn die Lenker der größten Volkswirtschaft der Welt so einen Fehler auch noch ganz lange praktizieren, dann fällt eine Krise auch mal etwas schwerer aus:
„Mit dem Terminus ‚billiges Geld‘ lässt sich auch die Krise Amerikas umschreiben. Seit gut vier Jahrzehnten lebt die größte Volkswirtschaft der Welt über ihre Verhältnisse. Die Amerikaner konsumieren zu viel und sparen zu wenig. Das äußert sich in den Defiziten von Staatshaushalt und Leistungsbilanz, aber auch in den Budgets von Durchschnittsfamilien. Die können ihren Lebensstandard oft nur mit teuren Krediten wahren. Der letzte Exzess dieser Kreditkultur war der Boom zweitklassiger Hauskredite (‚Subprime Loans‘), dessen Ende im vergangenen Jahr die Krise ausgelöst hat.“
Dass ganz Amerika jahrzehntelang falsch gewirtschaftet hat und deshalb Krise ist, haben wir jetzt verstanden – für diesen Gedanken addiert uns der promovierte Ökonom ja eigens Kraut und Rüben – Staatsschulden, ein Leistungsbilanzdefizit, eine Kreditkultur und die chronische Geldknappheit von Normalverdienern – zu einem einzigen gewaltigen Fehler in der Handhabung des guten Geldes zusammen. Nur müsste uns die SZ noch erklären, wieso dieses notorisch ‚zu billige Geld‘ für Durchschnittsamerikaner immer noch ‚zu teuer‘ ist. Oder wollte sie uns einfach nur mitteilen, dass die Kreditierung von Leuten, die von ihrer Arbeit leben müssen, grundsätzlich ein Verstoß gegen marktwirtschaftliche Regeln, Kapitalismus also nichts für arme Leute ist?
Wie auch immer, ein bisschen journalistische Spekulation auf die Bedeutung der Krise soll auch noch sein, und da gibt es zu vermelden, dass eine Krise in Amerika auch eine Krise Amerikas ist. Die Krise bringt nämlich, das ist für einen Kenner der Materie selbstverständlich und selbstverständlich hochinteressant, die Rangordnung der Nationen durcheinander:
„Es ist eine fundamentale Krise der Vereinigten Staaten, die Nation sieht sich in ihrer Rolle als ökonomische Führungsmacht gefährdet“.
Muss ja dann schon sehr viel dran sein an der Diagnose, wenn die Nation sich selbst so sieht, wie der interessierte Blick aus München sich die Lage denkt. Leider heißt das nicht, dass wir Deutschen uns wegen der amerikanischen Krise keine Sorgen machen müssten – womöglich können wir nämlich an der amerikanischen Unsolidität nicht mehr so schön mitverdienen, wenn die Amerikaner nicht mehr über ihre Verhältnisse leben
und uns darüber Exportmöglichkeiten schaffen
.
*
Tags darauf meldet sich der Abteilungsleiter für ‚Rechtsstaat und Demokratie‘ derselben Zeitung, Heribert Prantl, zu Wort und vertritt, was die Krise betrifft, das Gegenteil. Irgendwie sei der heutige Kapitalismus doch eher ziemlich am Ende :
Die kapitale Läuterung
„Der Kapitalismus hat gesiegt. So sagt man, seitdem Kommunismus und Staatssozialismus weltweit gescheitert sind. Mittlerweile drängt sich aber der Eindruck auf, dass der Kapitalismus gar nicht gesiegt, sondern nur überlebt hat, womöglich auch sich selbst. Sieger sehen anders aus.“
Hören wir da etwa eine Art moralischer Genugtuung über die historische Niederlage des Kapitalismus?
„Die Form des Kapitalismus, die man ‚Turbo-Kapitalismus‘ genannt hat, widerlegt, zerlegt und besiegt sich gerade selbst. Der Turbo war die Gier. Die Gierlehre, die eine Irrlehre war, behauptete, dass die gigantische Geldakkumulation an der Spitze nicht nur den Leuten an der Spitze, sondern, im Wege des Durchsickerns, auch den Armen helfe und so für Gerechtigkeit sorge. Die Theorie blieb aber Theorie. Die Praxis zeigt sich jetzt: Der Turbokapitalismus frisst seine Kinder, seine Künder und seine Derivate.“
Gegenstand der Kritik ist also doch nicht der Kapitalismus als solcher, sondern eine Form
desselben, die sich durch den Zusatz „Turbo-„ auszeichnet, womit der Autor zweifelsfrei zu erkennen gibt, dass diese Abart von Kapitalismus ein unanständiger Exzess einer eigentlich tugendhaften Einrichtung ist – ‚soziale Marktwirtschaft‘ heißt dieser gute Kapitalismus dann später. Die moralische Verfehlung, die für die Entartung verantwortlich ist, lautet Gier
; die Sünde ist, dass soziale Versprechungen nicht gehalten wurden; und die Übeltäter büßen schon für ihre Taten, sie erleiden nämlich selber gehörigen Schaden:
„Die Welt erlebt derzeit ein Fegefeuer des Kapitalismus.“
Es ist zwar etwas gewagt, die krisenhafte Entwertung von Geld, Kapital und Kredit als eine Art reinigendes Strafgericht über eine fundamentale Sünde namens Gier
und als Widerlegung einer falschen Theorie
zu deuten, derzufolge ausgerechnet Opfer des Systems zu seinen größten Gewinnern zu rechnene wären. Aber diese ‚Theorie‘ nimmt der SZ-Schreiber furchtbar ernst, um sie dann ausgerechnet durch den schlechten Gang der Geschäfte für deren Nutznießer als großen Irrtum zu entlarven. Das ist die Deutung, auf die Herr Prantl im Unterschied zu seinem Kollegen hinauswill: Ihm ‚beweist‘ der aktuell zu verzeichnende Misserfolg, dass der Kapitalismus mit den bösen Vornamen sich moralisch disqualifiziert hat. In seinem Weltbild ist der Kapitalismus nun einmal fest mit dem Ideal sozialer Wohltätigkeit verknüpft, also ist für ihn ausgemacht: Weil die Verhältnisse der letzten Jahre unanständige Exzesse und fatale Irrtümer waren, mussten sie in die Krise geraten und scheitern! So verschafft die Krise in seinen Augen der Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit ein schlagendes Argument und damit seinem Ideal eines besseren Kapitalismus eine wundervolle Perspektive. Wenn dem realen Geschäft im Moment der Erfolg fehlt, kommen seine Veranstalter einfach nicht um Einsicht herum, in der Abteilung ‚soziale Gerechtigkeit‘ einiges versäumt zu haben. Was kommt danach? Es wird ein geläuterter Kapitalismus sein müssen.
Ganz gewiss, zumal es doch schon ein erhebendes Beispiel gelungener staatlicher Läuterung gibt:
„Manche vergleichen den nackten Kapitalismus mit einem Krieg, einem Krieg gegen Arbeitsplätze unter anderem. Wenn man bei diesem Vergleich bleiben will: Die Weltgemeinschaft hat es zwar nicht vermocht, den Krieg abzuschaffen – aber immerhin, ihn einzuhegen, Regeln dafür aufzustellen, was im Krieg erlaubt ist und was nicht. Das muss auch für den Kapitalismus gelingen.“
Das ist unverwüstlicher Humanismus – noch in den größten Brutalitäten staatlichen Wirkens entdeckt man zivilisatorische Fortschritte! Und ein gelungenes Angebot an die neoliberalen Kollegen ist das auch: Ihr müsst euren ‚Krieg gegen die Proleten‘ noch nicht mal aufgeben, ihr müsst ihn nur ein wenig beschränken, dann geht er auch schon in Ordnung und ist obendrein noch viel erfolgreicher als euer gescheitertes Turbo-Modell, wie schon bewiesen:
„Es gibt ihn schon, in kleinem Format, man kann seinen Erfolg studieren – er heißt soziale Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist die erfolgreichste Wirtschafts- und Sozialordnung, die es in der Wirtschaftsgeschichte je gegeben hat. Sie ist nicht Kapitalismus pur. Sie ist der erfolgreiche Versuch, Wettbewerb und soziale Gerechtigkeit auf einen Nenner zu bringen.“
Besser kann man für soziale Gerechtigkeit nicht werben: Mit etwas mehr Berücksichtigung seiner sozialen Opfer wird unser Spitzensystem auch noch krisenfest!
*
Aussagekräftige Vergleiche müssen nicht das Privileg gebildeter Leser sein, die beherrscht auch die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands, wenn es um die Information des einfachen Volkes über die Finanzkrise geht:
Die Finanzwelt bebt – weltweit
‚Finanz-Tsunami‘, ‚Börsenbeben‘, ‚Bankensterben‘: Die Bezeichnungen für die weltweite Schieflage des Finanzsektors sind kreativ. Alle weisen auf dasselbe hin: Die Welt wird nach der Krise nicht mehr so sein, wie sie einmal war.“ (Bild, 18.9.)
Dass da ein Ungemach größten Kalibers passiert ist, muss jedem Deutschen unmissverständlich klar sein: Irgendwie ist da in Amerika etwas geschehen, was mit der Wucht und Unabänderlichkeit eines Tsunami oder Bebens über die Menschheit hereingebrochen ist. Derart eindrucksvolle Bilder legen die Perspektive fest, unter welcher der ‚einfache Mann‘ das Ganze zu betrachten hat: Ahnungs- und machtlos, wie er ist, erfährt er von Zuständigen und Experten, was da Unausweichliches auf ihn zukommt. Zuerst soll man sich das Unfassbare vorstellen, das passieren könnte und offensichtlich als die Katastrophe gilt:
„Der Mythos Wall Street ist zerschlagen. Die Finanzkrise hat Börse und Banken platt gemacht – und damit auch ein ganzes Land. KANN AMERIKA JETZT SOGAR PLEITE GEHEN?“
Anschließend kann man sich durch den Experten wieder beruhigen lassen:
„Unmöglich, sagt Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise zu Bild. ‚Die USA verfügen über ein gewaltiges Vermögen im In- und Ausland. Auch die Wirtschaft ist alles andere als pleite. Das US-Bankensystem ist ausgeufert und muss jetzt dringend auf ein vernünftiges Maß schrumpfen – auch wenn das sehr schmerzlich ist‘.“
Diese inszenierte Auf- und Abregung angesichts der Wucht unabänderlicher Ereignisse ist aber nur die eine Hälfte der Bewusstseinsbildung in Krisenzeiten, der sich die Bild-Zeitung widmet. Die andere ist die Erregung öffentlicher Empörung über die Schuldigen, welche die ausgemalte Großkatastrophe verursacht haben. Das gute demokratische Volk soll sich schließlich ideell mit zuständig wissen im Kampf um geordnete Verhältnisse, und bekommt dazu von Bild und einem echten Professor den richtigen Weg der Kritik gewiesen.
Verzocken Banker unseren Wohlstand?
„Der Fall der einst hoch angesehenen Investmentbanken zeigt drastisch, wohin ungezügelte Gier von Bank-Managern führen kann. Die Finanzmarktakteure haben sich im ganz großen Stil verspekuliert. Hochriskante, gefährliche Geschäfte aus Gier nach mehr sind die Ursache.“
Auch bei Bild ist man also übereingekommen, dass das moralische Versagen der wirtschaftlichen Elite namens Gier
die Wurzel des Übels ist und dass Banker wegen dieses menschlichen Defekts ihren allgemeinwohldienlichen Auftrag verfehlen: Sie sollen, bitteschön, anständig und deswegen erfolgreich wirtschaften, lautet der Antrag – schließlich geht es um unseren Wohlstand
, als ob der kapitalistische Reichtum eine Art Gemeinschaftsprodukt wäre, für das alle Beteiligten ihre Pflicht zu tun haben! Zwar bringt es die Mehrheit mit ihrer Arbeit gar nicht zu dem beschworenen Wohlstand, den die Manager da angeblich verspielen. Aber gerade weil sie ihre Pflichten ehrlich und bescheiden erledigt, kann sie von diesen ‚Akteuren‘ des Finanzgewerbes verlangen, dass auch die das Ihre leisten und ihr Geschäft der Geldvermehrung gefälligst solide betreiben. Stattdessen aber sackt die pflichtvergessene wirtschaftliche Elite Provisionen
ein, obwohl sie der Gemeinschaft die Leistung schuldig bleibt:
„‚Banker haben alles dafür getan, um Geld zu generieren. Je mehr, desto höher die eigenen Provisionen. ‚Perversion des Leistungsprinzips‘, nennt Prof. Dr. Rudolf Hickel von der Universität Bremen diese Entwicklung. Über die Millionen für die Pleite-Manager sagt er: ‚Es ist ein Skandal, dass die Leute, die Mist bauen, dafür auch noch fürstlich entlohnt werden.‘“
Eine erfrischend volksnahe Auskunft des Gelehrten: Wer nichts leistet, hat auch nichts verdient, das gilt auch für die, die gar keine Arbeit leisten, sondern managen! Da kann das Volk, für das im kapitalistischen Alltag die Rolle der schweigenden und arbeitenden Manövriermasse vorgesehen ist, sich endlich mal gehörig Luft verschaffen, kann von ‚denen da oben‘, von denen es kommandiert wird, weil die über den Reichtum und die wirtschaftlichen Mittel gebieten, von denen es abhängt, lautstark Verantwortung einfordern, ihre Unfähigkeit und Unredlichkeit anprangern – und was das Schönste ist: Es kriegt mit allem von berufener Seite auch noch Recht!
*
In diesen bewegenden Krisentagen rückt auch die ehrenwerte Figur des deutschen Sparers ins Rampenlicht. Zwar haben wir von Wirtschaftskommentatoren gelernt, dass die Krise im Wesentlichen eine amerikanische ist; irgendwie breiten sich die Pleiten aber langsam doch so aus, dass „sich derzeit viele, die das Geschehen an der Börse beobachten, wie im Kasino fühlen. Insbesondere Privatanleger verunsichert die Finanzkrise. Sie fragen sich, was die großen Spieler an den Märkten genau treiben“ (SZ, 17.9.) – mit ihrem Geld und ihren Anlagen zum Beispiel. Aus gutem Grund, schließlich haben sie als aufgeschlossene Bürger ihr Geld nicht mehr unter der Matratze geparkt, sondern in die Spekulation der internationalen Finanzwelt hineinverwickeln lassen: Derivate, Aktien- und Geldmarktfonds, Tagesgeld, Rentenmarkt – die Ersparnisse von jedermann sind komplett dem Finanzkapital überantwortet. Sorge ums eigene Geld ist also geboten, und mit dieser Sorge darf das deutsche Volk von Sparern keinesfalls allein gelassen werden. Also nimmt die Öffentlichkeit die deutschen Bürger an der Hand und bietet ihnen Aufklärung. Allerdings eher nicht darüber, was die Finanzgrößen da in ihrem Kasino
so genau treiben
. Wirtschaftsredakteure übernehmen die Rolle des vertrauenswürdigen Anlageberaters in schwerer Zeit und führen ihre Leserschaft durch die große Welt des Finanzkapitals – auf der Suche nach Antworten auf die allein interessante Frage nach den Folgen, die da zu gewärtigen sind, an erster Stelle die:
Ist das Geld der Sparer noch sicher?
Die 25 wichtigsten Fragen und Antworten für Anleger und Arbeitnehmer
. Auf die Frage: sind auch deutsche Banken vom Konkurs bedroht?
, kommt die nicht weniger kluge Antwort: Genau weiß das keiner. Immerhin IKB ...
Daraus ergibt sich, dass wir Deutsche schon irgendwie betroffen sind, da hilft alles nichts. Also stellt sich die nächste Frage:
„Was passiert, wenn eine deutsche Privatbank pleite gehen sollte?“ Kein Grund zur Panik: „Dann greift der Einlagensicherungsfonds des Bankenverbandes. Ihm gehören die großen Bankhäuser sowie viele kleinere Institute an. Bei der Dresdner Bank z. B. sind konkret Spareinlagen bis zu 2,8 Milliarden Euro geschützt, und zwar pro Kunde!“
Als deutscher Sparer kann man aufatmen und sich beruhigt zurücklehnen: 2,8 Milliarden, pro Kunde, da ist man ja total überversichert; schenken wir also den Banken weiterhin unser Vertrauen, lesen weiter und freuen uns darüber, dass bei den Sparkassen & Genossenschaftsbanken alles eher noch sicherer ist. Doch dann:
„Unbestritten ist, dass die Sicherungssysteme ausreichen, um Pleiten von kleineren und mittleren Banken aufzufangen. Was passiert aber bei einer Pleitewelle? (...) Branchenkenner raunen, die IKB wurde nur deshalb gerettet, weil die Einlagensicherung an ihre Grenzen gestoßen wäre.“
Aha, massenhaft in Anspruch darf der Sicherungsfonds also nicht genommen werden, dann reicht er nämlich nicht! Daraus lässt sich immerhin auch eine beruhigende Konsequenz ziehen: Wenn alle auf die Bank rennen, nützt das gar nichts – das Geld ist eh nicht da! So bleiben wir gefasst, behalten unser Gottvertrauen in Banken, Politiker und Öffentlichkeit und darauf, dass sie alles mögliche für unser Geld tun, und haben als deutsche Sparer die Lage so schon nicht schlecht im Griff.
*
Auch die Wissenschaft steht den krisengeschüttelten Gesellschaften zur Seite und vermeldet einen
Kollaps aus dem Nichts
Die globale Finanzkrise zeigt: Ihre zunehmende Komplexität macht moderne Gesellschaften zerbrechlich
. (SZ, 17.9.) Eine Krise aus dem Nichts
– haben die Forscher das vergangene Jahr durchgeschlafen? Oder haben die System- und Wissenschaftstheoretiker, Mathematiker, Ökonomen und Organisationssoziologen so fest über das Grundwort des Kompositums ‚Finanzsystem‘ nachgedacht, dass sie das mit den Finanzereignissen glatt übersehen haben? Jedenfalls scheint ihnen aktuell ein modernes und hochkomplexes System gestört
zu sein, das ist eine Katastrophe
, und damit ist das gesamte Denkmuster auch schon fertig, mit dem man die Finanzkrise ganz gut in eine Reihe mit Epidemien
, Atomkriegen
und anderen Naturkatastrophen wie dem Klimawandel
stellen kann, wo – streng systemtheoretisch gedacht – immer dasselbe vorliegt:
„Die Vernetzung und zunehmende Abhängigkeiten in modernen Gesellschaften führen dazu, dass die Folgen von Entscheidungen unabsehbar werden und – so wie bei der Finanzkrise – lokale Probleme schnell zum globalen Desaster anwachsen.“
Das ist doch mal eine Erkenntnis im Dschungel der unübersichtlichen Finanzwelt: Wer sich aufs Denken der Abstraktion ‚Zusammenhang‘ versteht und mit Vokabeln wie ‚komplex‘ nur festhalten will, wie schwierig es ist, dass da irgendein großes Ganzes aus ganz vielen Teilen auch verlässlich ein Ganzes bleibt, der kennt Entscheidungen bar jeden Inhalts, die Folgen egal welcher Art nach sich ziehen, jedenfalls unabsehbar
sind und zum globalen Desaster
werden. Nach der bestechenden Logik ‚kleine Ursache – große Wirkung‘ hat er dann, wenn er ein Desaster registriert, die Welt geistig komplett im Griff: Dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt und deshalb leicht auseinander brechen kann, sieht man an einer Krise, die lokal anfängt und global aufhört.
*
Reicht das an Ursachenforschung? Ging mit Lehman Brothers nicht die viertgrößte Investmentbank der USA in die Pleite? Eben! Für die seriöse Presse in Deutschland ein Anlass, nochmals die Frage zu wälzen, was da eigentlich in die Krise geraten ist und warum. Da ist man sich einig: Die Krise ist Ausdruck der Niederlage eines Geschäftsmodells. Desavouiert hat sich da ein ganz bestimmter Typus von Bank, der – logo – v.a. in den Vereinigten Staaten beheimatet ist:
Tod der Investmentbanken
„Von den fünf größten Wertpapierhäusern sind nur noch zwei unabhängig. Es ist der größte Umbruch in der amerikanischen Bankenbranche seit der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts – und ein Sieg der Universalbanken.“ (FAZ, 20.9.)
Und auch die SZ sieht das so:
„Das Ende der Wall Street – In der Finanzkrise hat sich das Modell der Investmentbank überholt.“ (SZ, 17.9.)
Wenn etwas pleite ist, ist es überholt
, das darf als gesichert angesehen werden. Und wenn an der Wall Street Krise ist, dann ist das wohl auch das Ende der Wall Street – diese Logik kennen wir, angewendet auf die gesamte amerikanische Nation, ja schon. Nur: War dieses Modell, die Trennung der Banken in Einlagen- und Wertpapierbanken, in den USA nicht als Lehre aus der letzten großen Krise 1929 entwickelt worden? Egal. Wir in Deutschland haben jedenfalls vor allem den Siegertypus von Banken, und den noch dazu auf drei Säulen! Was kann uns da passieren!
*
Gier hin, US-amerikanisches Bankenmodell her – die Sache mit den Krisenursachen scheint in dieser Woche doch noch nicht erschöpfend geklärt. Die SZ jedenfalls nimmt einen dritten Anlauf zum Wochenende hin:
Aus der Traum
lautet der Leitartikel, noch mal Amerika. Wenn man nämlich etwas genauer hinsieht, ist das mit der Finanzkrise für Amerika noch viel schlimmer als gedacht. Kaputt sind nicht bloß die Abermilliarden an Vermögenswerten. Die sind nur oberflächlicher Ausdruck eines weit tiefer gehenden Zerstörungswerks – Amerikas Grundwerte sind kaputt, also die höheren wie Freiheit und Gerechtigkeit
, Unternehmergeist
, Risikobereitschaft
und gar der Optimismus
, kurz: der ganze amerikanische Traum
ist im Eimer. Eine wegen verspekulierter Dollarmilliarden ideell daniederliegende Nation?! Einerseits ein Witz in einer Welt, deren beinharter Materialismus in der Vermehrung von Geld besteht. Andererseits aber auch ein schönes Bekenntnis dazu, dass eine gelungene Bereicherung den Tugend- und Wertekatalog so großartig macht, der den Einzelnen wie eine ganze Nation adelt und geistig aufrichtet.
Fragt sich, wie diese moralische Katastrophe passieren konnte. Der Traum wurde verraten und verkauft
, nämlich von Amerikas unmoralischer Elite, die ihrem Privatinteresse die Regulative der Märkte
, also ein gebotenes rechtes Maß privater Bereicherung – da ist sie wieder, die ‚Gier‘! – geopfert hat:
„Die Schamlosigkeit, mit der die Regierung Bush und Kongressmitglieder ihre Ämter für ihre Interessen missbrauchten, ebnete so auch den Weg für die Schamlosigkeit und Verantwortungslosigkeit, mit der die Finanzwelt sich am Traum der Durchschnittsamerikaner vom eigenen Heim bereicherte.“ (A. Kreye, SZ, 20./21.9.)
Wer hätte das für möglich gehalten: Amerika lebt an die 40 Jahre nicht nur finanziell über seine Verhältnisse und damit auf unsere Kosten. In Amerika finden auch noch unamerikanische Umtriebe statt, angestiftet und angeleitet von ganz oben. Wie betrüblich für einen deutschen Fan einer amerikanischen Nation, von der all das Gute der kapitalistischen Welt ausgeht:
„Der Rest der Welt aber braucht Amerika als Führungsmacht in Sachen Idealismus, Innovation und Optimismus. Es gibt niemanden, der in die Bresche springen könnte.“
Aber noch ist die Welt ja nicht verloren.
2. Tiefschürfende Ursachenforschung und Würdigung staatlicher Rettungsversuche
Die amerikanische Regierung nutzt das börsenfreie Weekend, um Rettungspakete für ihre fallierenden Investmentbanken zu schnüren; der deutsche Bundesfinanzminister telefoniert schon mal mit seinen EU-Kollegen in Paris, London und anderswo, weil er ein Hilfsersuchen aus Washington erwartet, das er ablehnen will – aber möglichst im Rahmen einer kollektiven Front von Nein-Sagern. Und die seriöse Presse unseres Landes nutzt das Wochenende, an dem die Panik freihatte
, für etwas Besinnung. So eröffnet die SZ den montäglichen Arbeitsbeginn der Börsen mit einem Leitartikel über die
Lehren aus der Krise
„Das ist die erste Lehre aus der großen Krise: dass Menschen Dinge zugelassen und veranstaltet haben, die sie nicht begriffen und schon gar nicht in ihren Konsequenzen übersehen haben. Das war ein unverzeihlicher Fehler. Wie im richtigen Leben muss auch in Politik und Wirtschaft, beim Führen eines Unternehmens und erst recht einer Bank oder Versicherung gelten: Tue nur, genehmige nur, bewerte nur, was du auch verstehst.“ (SZ, 22.9.)
Der SZ-Kommentator hat offenbar die Meldungen im Fernsehen mitbekommen, wonach sogar mancher Bankvorstand den Verkaufsprospekt eines „strukturierten Zertifikats“ nicht versteht und der kleine Sparer erst recht nicht, und hat aus diesen Meldungen eine Moralphilosophie der Krise fabriziert, die irgendwo zwischen Kant und Murphy’s Law – das Gesetz vom Butterbrot, das immer auf die bestrichene Seite fällt... – angesiedelt ist: Man muss wissen, was man tut, sonst geht’s womöglich schief! Diese goldene Regel einer ordentlichen Lebensführung für jedermann hat auch für diejenigen „Menschen“ zu gelten, die nach dem Verständnis des geistigen Mahners der SZ selbstverständlich in einem eigenen, dem alltäglichen ‚richtigen Leben‘ enthobenen höheren Bereich tätig sind. Und da muss er registrieren: Die Akteure, Emittenten und Anleger in den oberen Finanzetagen kennen ihre eigenen Geschäftsprodukte nicht! Der Mann hätte eigentlich bloß in seiner eigenen Zeitung ein bisschen nach hinten blättern müssen oder die 15-seitige Beilage vom Donnerstag „Derivate und Zertifikate“ aufschlagen sollen, wo seine Kollegen vom Wirtschaftsressort just aufgeschrieben haben, was die Experten aus der Alltagspraxis des Bankgeschäfts ihnen über ihre Kreationen so erzählen. Oder er hätte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor dem Wort zum Sonntag lernen können, wie solche unverständlichen Finanzgeschäfte gehen, z.B. solche, in denen leere Sachen verkauft werden:
„Bei Leerverkäufen verkaufen Investoren Aktien, die sie gar nicht besitzen, sondern bloß geliehen haben. Sie spekulieren auf fallende Kurse, also darauf, die Aktien später billiger zurückzukaufen.“
Das gibt eine Rendite. Das verstehen die Schöpfer der komplexen Wertpapierchen allemal, dafür konstruieren sie die verrücktesten Kombinate aus ‚Risiko‘ (gegen hohen Zins) und ‚Sicherheit‘ (für weniger Zins), um das Geld der Anleger für ihre spekulativen Geschäfte an sich zu ziehen und für die Bereicherung ihres Finanzinstituts zu nutzen. Und was den Menschen aus dem richtigen Leben
und da vor allem den Kleinsparer
angeht: Der soll und braucht überhaupt nicht zu verstehen, wie ein Lehman-Zertifikat sich von einem Sparbuch der Frankfurter Sparkasse unterscheidet. Er soll anlegen und darf dafür die Verwandlung seiner nicht konsumierten Lohnbestandteile in Geldkapital – Geld, das ‚arbeitet‘ – erwarten. Da sind unsere Banken ganz offen: Vertrauen ist der Anfang von allem
– mit der Parole dringen die Profis
von der Deutschen Bank bei ihrer Kundschaft darauf, das Geld bei ihnen abzuliefern und sich so für die Refinanzierung ihrer Investments einspannen zu lassen. Dafür darf Otto Normalverbraucher sich nun, da auch seine Anlagen in der Krise, also vom Verlust bedroht sind, von der SZ einer verantwortungslosen Naivität bezichtigen lassen: Auch er hat schließlich, ebenso wie die Finanzprofis und Politiker, eine Spekulation zugelassen
und mit veranstaltet
, die – wie man heute weiß – schief gehen musste!
Vor allem aber gilt die Schelte des Wirtschaftsredakteurs der inkompetenten Elite. Die leitenden Banker, aber nicht nur die, sondern auch die Staatsaufsicht – alle haben versagt. Der Beweis: Hätten die Verantwortlichen ihr Handwerk verstanden und ihre Aufgaben erfüllt, hätte ‚der Kern der Wirtschaft‘, ‚die reale Wertschöpfung‘, dauerhaft floriert und nicht eine ausufernde ‚Finanzindustrie‘ mit ihren undurchschauten Risiken; dann gäbe es jetzt keine Finanzkrise. Unschwer ist zu bemerken, was Wirtschaftskommentatoren, die ihr Publikum ansonsten mit den fantasievollen Entwicklungen in der Geld- und Kreditproduktion unterhalten, zu ihrer ‚Denn-sie-wissen-nicht-was-sie- tun‘-Theorie motiviert. Sie meinen, die Banker hätten nur solide Spekulationen veranstalten und die politischen Aufseher nur solche Finanzgeschäfte zulassen sollen, deren Erfolg verbürgt ist.
So eine Direktive fällt natürlich nicht unter die Rubrik ‚naiv‘. Schließlich hat der Fachmann von der SZ ja gerade gesagt, dass er kapitalistisches Wirtschaften für eine ausgesprochen komplizierte Angelegenheit hält, von der Leute, die sich nicht auskennen, die Finger lassen sollten. Und damit ist auch klar, welch eine gewaltige Anforderung da an die politischen Macher gestellt wird. Eine Freie Marktwirtschaft richtig dirigieren – das ist die große, schier unlösbare Aufgabe der Staatsmänner:
„Dies ist nun die doppelte Herausforderung: die entfesselten Finanzmärkte zu bändigen und zugleich der Wirtschaft mehr Freiraum zu geben. Ein Jahr vor der Bundestagswahl ist eine solche differenzierte Politik fast unmöglich. Trotzdem müssen verantwortliche Politiker diesen Versuch starten.“
So etwas wie die Quadratur des Kreises müssen sie schaffen, auch wenn die Demokratie mit ihrem Wahlkampf mal wieder stört. Auch ein schönes Kompliment an die Produktionsweise, die der Staat seiner Gesellschaft verordnet: Schwierig zu durchschauen, noch schwieriger zu managen, aber eigentlich toll – wenn man die gute Wirtschaft machen lässt und die problematische bändigt.
*
Tags darauf ist klar: Das Rettungspaket für die Wall Street wird täglich größer.
(FAZ, 23.9.) 700 Milliarden Dollar will der amerikanische Staat zur Sanierung seiner Banken aufbringen.
Die deutsche Bundesregierung lehnt den Antrag der US-Regierung ab, sich an der Finanzierung zu beteiligen oder eigene Pakete für Not leidende Banken zu schnüren. Wirtschaftsminister Glos übermittelt die hämische Botschaft: Jeder kehrt vor seiner Tür, und sauber ist das Stadtquartier.
Damit steht fest:
Deutsche Milliarden für die Pleite der US-Banken?
NEIN!
Die Öffentlichkeit teilt den Bürgern mit, dass das schwer in Ordnung geht. Die Amis sollen ihre Suppe selbst auslöffeln:
„Aus guten Gründen reagieren die Regierungen der EU-Länder oder Japan zurückhaltend. Diese Finanzkrise ist aus den Vereinigten Staaten in die Welt exportiert worden, sie muss dort auch behoben und die Rechnung beglichen werden.“ (FAZ, 23.9.)
Als ob es um die Begleichung einer Rechnung ginge! Mit dem Hinweis auf den Schuldigen wird freilich das Gerechtigkeitsempfinden des patriotischen Gemüts bedient, dem immer wieder vorgesagt worden ist, dass Europa mit der Krise und ihrer Bewältigung eigentlich nichts zu tun hat, weil sie in Amerika angefangen hat. Auch so eine hochinteressante Lehre aus der Weltwirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts: Über die hat man in Gestalt einer „Lehre“ ein ums andere Mal erfahren, dass heutige Staatslenker garantiert nicht mehr so kurzsichtig
und verantwortungslos
wie damals nur auf Rettung der eigenen Nation sinnen dürfen, weil das ja die Katastrophe von 1929 erst richtig in Gang gesetzt habe ...
Kongenial und einfach macht Bild Stimmung für die Politiker, die unseren
Finanzsektor mit seiner wunderbaren Kreditvermehrung bislang so prächtig geschützt haben. Erstens mit einer rhetorischen Titel-Frage:
„Warum sollen wir Milliarden für die Pleite der US-Banken zahlen?“ (23.9.)
Bei dem falschem WIR, das da staatliche Haushaltsführer mit dem lohnabhängigen Fußvolk zusammenschließt, gibt’s nur eine Antwort: GENAU! Zweitens zitiert Bild als Beweis einen, der es wissen muss, einen deutschen Politiker, der dem deutschen Steuerzahler aus dem Herzen spricht:
„FDP-Chef Guido Westerwelle: ‚Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass die Steuerzahler dafür blechen sollen, dass einige Banker in Amerika den Hals nicht voll kriegen konnten und Staatsbanken in Amerika Monopoly gespielt haben.‘“
Solche Entgleisungen wie bei den Amis können unserem soliden Bankwesen mit der vorbildlichen Bundesbank nie und nimmer passieren! Oder hat das Geschäftsgebaren in Amiland doch eher System und ist auf Amerika gar nicht beschränkt? Das scheint der skeptische Bild-Kollege Lohmann irgendwie zu befürchten:
Das NEIN der Kanzlerin auf das amerikanische Drängen, bei der Schadensbegrenzung zu helfen, ist nur konsequent. Und völlig richtig. Niemand weiß, welche Milliardenlöcher noch bei deutschen Banken klaffen.
Denen darf und muss dann natürlich geholfen werden. Wenn die Rechnungen von Finanzinvestoren hierzulande nicht aufgehen und deshalb Krise ist, darf der brave Bürger sich nämlich noch lange nicht über die ganz normalen Machenschaften empören, die zu deren ehrenwertem Beruf gehören. Denn:
„Sicherheit wird es nie geben. Gewinne und Spekulationen sind nicht von sich aus verwerflich. Sie sind Triebkraft unserer Marktwirtschaft.“
Das muss klar sein und bleiben: Die Kapitalisten mit ihrem Geschäftssinn sind grundsätzlich zu bewundern und nicht zu verdammen. Sie treiben mit all ihren Geschäften schließlich unser System voran. Und insofern ist ihre ‚Gier‘ nach immer mehr Geld, so sie mit ihren Gewinnen die Marktwirtschaft
ordentlich voranbringen, keine Schande, sondern eine Tugend. Wenn der Mann aus dem Volk diesen Grundsatz beherzigt, dann darf er sich gerechterweise aber auch umso mehr aufregen über unanständige Banker, vorzugsweise aus Amerika, die Milliarden verzocken und in der Pleite fröhlich ihren Bonus verjubeln
. Und darf entschieden darauf bestehen: Die müssen nicht noch belohnt werden!
Beim Thema Gerechtigkeit muss man eben immer fein differenzieren!
*
Am selben Tag fühlt sich ein SZ-Feuilletonist bemüßigt, wieder mal ein bisschen herauszutreten aus den Niederungen des politischen Tagesgeschäfts. Er nimmt die laufende Vernichtung von Finanzvermögen zum Anlass einer tieferen Reflexion über das, was eigentlich falsch läuft in diesem unserem System, in dem die Geldvermehrung der oberste Zweck ist. Die Überschrift gibt die Richtung vor:
Wir Schuldenmacher
„Leben in Rot: Wie der Kapitalismus seine Ehrbarkeit verlor“ (SZ, 23.9.)
Hier möchte also einer über die Frage verhandeln, wie es um die Sittlichkeit bestellt ist, die er für die eigentliche Grundlage unseres Gesellschaftssystems hält und deren Verlust er als den wahren Grund der Krise ausgemacht hat. Die gängige Auskunft über das moralische Fehlverhalten der Banker erscheint ihm da ungenügend, also wirft er die Schuldfrage neu auf: Amerika hin, eine versagende Wirtschaftselite her – schauen wir doch mal nach, ob wir alle
, die menschliche Massenbasis des Kapitalismus, wirklich so unschuldig sind an dem beklagten Desaster:
„Wie aber sieht es an der Basis aus, bei uns, den vielen Millionen Subjekten der Marktwirtschaft? Derzeit wirkt es, als hätten wir gar keinen Anteil an der großen Krise; als sei diese der Effekt von ein paar Erfindungen skrupelloser und gieriger Investmentbanker.“
Natürlich ‚wirkt‘ das nur so: Da spielt einer mit der doppelten Bedeutung des Wortes ‚Subjekt‘, um uns alle – als Menschen, also jenseits aller ökonomischen Realität – in die Rolle von Veranstaltern des Krisengeschehens zu befördern. Und inwiefern ist jeder beteiligt? Es ist ganz einfach:
„So bleibt doch eine triviale Voraussetzung im kapitalistischen System mit seiner Wirtschaftsmoral, ohne die der ganze Schlamassel nicht möglich geworden wäre. Sie besteht in der seit einigen Generationen eingerissenen bedenkenlosen Schuldenmacherei auf allen Ebenen, vom Privatmann bis zu den Staatshaushalten. Der einfache Grundsatz, dass man nicht über seine Verhältnisse leben dürfe, hat alle Anschaulichkeit eingebüßt.“
Will sagen: man wird nicht mehr bestraft für wirtschaftliche Unmoral. Staaten gehen kaum mehr bankrott, Privatschuldner blechen dank eines menschenfreundlichen
Insolvenzrechts nur bedingt, so dass die Rechnung am Ende immer von Dritten beglichen
wird. Deshalb machen Mann und Frau, Finanzminister und Zwischenschichtler, kurz: wir alle munter weiter Schulden, allenthalben unsittliches Verhalten mithin. Doch wer jetzt das handelsübliche Anprangern der überbordenden ‚Gier‘ erwartet, wird enttäuscht. Da gilt es zu differenzieren! Ganz wie sein Kollege von der Bild-Zeitung bricht der Verhaltensforscher der SZ erst einmal eine Lanze für den gesunden, sprich systemdienlichen Materialismus:
„Der derzeit kursierende moralische Hinweis auf die ‚Gier‘, welche an der Börse zuletzt ausschließlich regiert habe, ist so zutreffend wie nutzlos. Das Problem ist nicht die Gier. Gierig ist jedermann, vom kleinen Schnäppchenjäger bis zum Vorstandsvorsitzenden; ohne Gier würde das Wirtschaftsleben über den Naturaltausch nicht hinausgekommen sein.“
Die Gier als Motor des zivilisatorischen Fortschritts? Wahrscheinlich hat den homo oeconomicus auf der Suche nach Tauschpartnern da mal ein Geistesblitz ereilt: Mit Geld kann man sich doch alles kaufen, was man braucht! Das hat zwar den kleinen Nachteil, dass man schlagartig auf nichts mehr von dem zugreifen kann, was man zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt. Aber auch den großen Vorzug, dass man ja sofort weiß, wie der Knappheit aller Güter allein Herr zu werden ist, mit der man Bekanntschaft schließt: Mittels Arbeit, die den stofflichen Reichtum schafft, vor allem den Stoff zu vermehren, mit dem man auf den Reichtum auch zugreifen kann, das ist praktisch! Die Geldgier als Elementarbedürfnis einzurichten: Das führt das moderne Wirtschaftsleben
endlich über seine absurd unpraktischen Vorformen hinaus
! Diese gute Moral der Gier gab es einmal, und die ist es, die der heutigen Schuldenmentalität zum Opfer gefallen ist. Zu studieren ist das exemplarisch an denen, die die Tugend der Geldgier als ihren Hauptberuf ausüben – der pedantisch-tugendhafte
, knauserige, asketische, eben: der ehrenhafte Kapitalist ist ausgestorben:
Die ersten Kapitalisten hatten zähe, dürre, harte, vor allem aber verlässliche Seelen
- und an deren Stelle sind volatil leichtfertige Manager
getreten, die das kapitalistische System von Arbeit auf Konsum
umgestellt und damit gleich die ganze Menschheit verdorben haben:
„Diese Umstellung hat langfristig einen neuen Menschentypus herangebildet. Das sind wir, die schwerelosen, heiteren und leichtsinnigen Bürger der Wohlstandszonen auf der nördlichen Hemisphäre des Erdballs.“
Müßig die Frage, ob da nicht einer seinen schwerelosen Konsum zu einem heiteren Schlaraffenland umdichtet. Seine Botschaft, dass es sich der heutige „Menschentypus“ jedenfalls viel zu leicht macht, wenn er immer nur Geld ausgibt anstatt zu arbeiten, ist ja unübersehbar. Deshalb kommt ihm die Krise mit ihren schweren Zeiten für die heiteren und leichtsinnigen Wohlstandsbürger als schmerzliches Heilmittel gerade recht:
„Wenn die Menschen am eigenen Leib wieder erfahren, wie Geld und Arbeit zusammenhängen, dann kann das kapitalistische System, diese komplexe, großartige, freiheitsverbürgende Errungenschaft der Menschheitsgeschichte, vielleicht zu seiner ursprünglichen Ehrbarkeit zurückfinden.“
Klar, wie für den Mann Geld und Arbeit zusammenhängen: Arbeit
ist gleichbedeutend mit weiser Selbstbeschränkung, weil Geld verdient sein will, bevor man leichtsinnig
alles ohne Arbeit konsumiert – und diese Erfahrung würde das System ausgerechnet zu seiner Sittlichkeit zurückführen! Das geht dann doch ein wenig weit mit dem Lob der guten Erfahrungen, die die Menschen
mit diesem System machen: Seitdem es die kapitalistische Geldwirtschaft gibt, hat die Mehrheit von ihnen – wenn überhaupt – noch nie mit etwas anderem konsumieren dürfen als mit den Erträgen, die sie sich mit ihrer Lohnarbeit verdient hat! Genau das ist es, was schon die frühen Kapitalisten
als die große Errungenschaft der ihnen verbürgten Freiheit zur Ausbeutung und zum Konsum ohne eigene Arbeit geschätzt haben und die Vertreter dieser gesellschaftlichen Spezies auch heute nicht minder schätzen! Was an dieser schlichten Gemeinheit komplex
sein soll und menschheitsgeschichtlich betrachtet großartig
, bleibt das Geheimnis dieses Apologeten, ebenso wie die von ihm angehimmelte ursprüngliche Ehrbarkeit
eines Systems, das seit seinen Ursprüngen in seinen Fabriken aus Geschäftsgründen ganze Generationen verzehrt, halbe Kontinente entvölkert und es allein im letzten Jahrhundert zu zwei Weltkriegen gebracht hat!
*
Ach ja, apropos Konsum, es gibt tatsächlich noch eine Tarifrunde – mitten in der Krise! Und der Skandal ist ungeheuer:
Acht Prozent mehr Lohn!
Eine kleine Präposition unterstreicht den Irrsinn, der da unterwegs ist:
„Trotz der weltweiten Finanzmarktkrise geht die IG Metall mit der Forderung nach acht Prozent mehr Lohn in die Tarifrunde.“ (SZ, 23.9.)
Da können nur Hasardeure am Werk sein, und richtig, drei Seiten weiter lernen wir sie kennen, die Tarif-Spekulanten
von der IG Metall:
„Sie spekulieren. Sie spekulieren darauf, dass es mit der Konjunktur doch nicht so sehr bergab geht, wie die eigenen Experten vermuten. Sie spekulieren darauf, dass sie in der Metallindustrie imstande sind, jede Forderung in weiten Teilen auch durchzusetzen – in der Branche sind schätzungsweise vier von zehn Beschäftigten bei der Gewerkschaft organisiert ... Vielleicht weiß Huber ja, dass sein Acht-Prozent-Kurs langfristig gefährlich ist. Aber erst mal geht es ihm wie jedem Finanzhai: Er braucht den kurzfristigen Erfolg.“
Sehr originell. Wenn „Spekulant!“ das aktuelle Schimpfwort ist, mit dem die nationale Pflichtvergessenheit von ‚gierigen Finanzzockern‘ angeprangert wird, dann wenden wir es doch mal auf die Gewerkschaft an und fertig ist die Denunziation. Die Unterstellung, von der sie lebt, braucht man gar nicht mehr auszusprechen: Gewerkschaftliche Lohnforderungen sind eine Kost für die Wirtschaft, insofern immer zu hoch; und wenn die Gewinne neulich schon keine Lohnerhöhungen vertragen haben, dann gilt das natürlich jetzt erst recht. Wenn Wirtschaft und Finanzen Not leiden, dann hat die Gewerkschaft jedes Recht verloren und ihre Forderung zu revidieren! Und hat das den Arbeitern klar zu machen, falls die nicht von selbst darauf kommen.
*
Am selben Tag formuliert das Sprachrohr der deutschen Arbeiterklasse, die Bild-Zeitung, eine – gerade in unheilvollen Zeiten – gerechte Forderung an die deutschen Politiker:
Schenkt uns reinen Wein ein!
Sie sollen aufhören, das Spiel der Gaukler
zu betreiben und uns für dumm zu verkaufen. Von wegen, die Krise sei eine inneramerikanische Angelegenheit, die USA lägen außerdem weit weg und die deutsche Wirtschaft wäre bestens aufgestellt. So einfach ist es eben nicht!
(Bild, 23.9.)
Denn von einer möglichen gigantischen Rezession
, die US-Präsident Bush angekündigt hat, wäre schließlich auch die Exportnation Deutschland betroffen. Millionen Arbeitsplätze kämen in Gefahr
. Und wenn es so kommt, es sich also nicht vermeiden lässt, dass auch unser tüchtiges Deutschland zum Opfer der amerikanischen Krise wird und damit massenhaft Plätze frei werden, an denen bisher für Deutschlands Exporterfolge gearbeitet werden durfte, dann haben die betroffenen Bürger zumindest einen Anspruch: zu erfahren, wie viele von ihnen demnächst auf ihren Lebensunterhalt verzichten müssen. Und zwar so, dass es noch der Dümmste versteht:
„Wir brauchen keine Schönfärberei mehr, sondern Realismus. In klaren deutschen Sätzen!“
Dass man von den Führern der Nation rechtzeitig und offen gesagt bekommt, auf welche Not es sich einzustellen gilt: Darauf hat man ein Recht. Dann weiß man, was die für Geschäft und Politik Zuständigen einem demnächst an Lebensumständen servieren werden, was also auf einen zukommt
und womit man fertig zu werden hat. Und dann bleibt immerhin noch eines: die Hoffnung, dass es schon nicht so schlimm kommen wird.
*
Auf die geforderten klaren Sätze müssen die Deutschen noch ein paar Tage warten, da die Kanzlerin und ihr Wirtschaftsminister die laufende Ausweitung der Krise einstweilen noch nicht herbeireden
wollen. Sie sind noch zu sehr damit beschäftigt, der Krise eine für Deutschland gar nicht so unangenehme politische Perspektive abzuringen: Es könnte doch sein, dass es in der Welt noch Gerechtigkeit gibt und der Krisenverursacher auch der Hauptleidtragende dessen ist, was er angerichtet hat. Im Bundestag verkündet der deutsche Wirtschaftsminister Steinbrück in Anspielung auf den 11. September: Die Welt wird nicht wieder so werden wie vor der Krise
, und sagt frohgemut die Degradierung Amerikas an:
Die USA werden ihren Status als Supermacht des Weltfinanzsystems verlieren.
Das nimmt Deutschlands größte Tageszeitung zum Anlass, dem deutschen Minister und dem deutschen Leser zu bestätigen, dass der Wunsch des Mannes bereits Wirklichkeit geworden und dies außerdem sehr gerecht ist:
„Mit ihrer Maßlosigkeit (beim Schuldenmachen) haben die Amerikaner den Rest der Welt als Geisel genommen ... Die Amerikaner haben sich als Finanz-Supermacht aufgespielt, wie Peer Steinbrück es nennt. Ein Status, den sie nun zu Recht verlieren.“ (SZ, 26.9.)
Weil der Autor Amerika als Schuldigen der Finanzkrise und Schädling am Rest der Welt
– also an UNS! – an den Pranger stellen will, sieht er geflissentlich darüber hinweg, dass die finanzkapitalistische Welt, also auch deutsche Banken und Konsorten sich nicht minder an den Dollar-Anleihen bereichert haben und sich deswegen äußerst bereitwillig zu ‚Geiseln‘ der amerikanischen Staatsschulden haben machen lassen. Gemeinsam mit dem deutschen Finanzminister träumt er vom Niedergang des amerikanischen Imperiums und vom Aufstieg des europäischen – und vergisst dabei glatt, dass der Status einer Führungsmacht in der Staatenwelt nicht unbedingt auf der Beherzigung volkswirtschaftlicher Gleichgewichts-Ideologien beruht. Er geht einfach davon aus, dass die Amerikaner
aufgrund von zwei Fehlern
– dauernd auf Pump gelebt
der erste, das Vertrauen darauf, dass sich Geld beliebig vermehren lässt
, der zweite – ihre Führungsrolle verwirkt haben.
Dagegen mahnt der Kollege von der FAZ vor allzu voreiligen Schlüssen:
Eins sollte man dennoch nicht tun: in den Abgesang auf die Vereinigten Staaten einstimmen.
Er kommt etwas früh.
(FAZ, 26.9.)
Der Mann denkt an die überlegene ökonomische und militärische Macht der USA, die mit dem Finanzcrash nicht einfach annulliert ist. Diese Überlegenheit gilt ihm als Ausweis der besonderen Fähigkeiten dieser Nation und ist ihm ein Kompliment wert:
Sie (die USA) verfügen über enorme Energie und erstaunliche Kraft zur Regeneration.
Freiwillig von ihrem Status als maßgebliche Weltmacht zurücktreten werden die Freunde aus Übersee also nicht, da sollte sich Deutschland nicht vertun. So führt die Öffentlichkeit einen herrschaftsfreien Diskurs darüber, worauf es bei der Krise am Ende auch und vor allem ankommt: wie Deutschlands Chancen stehen, aus der Krise Gewinn in der Machtkonkurrenz der Nationen zu ziehen.
*
So oder so: Was aus Amerika auf UNS zukommt, kann uns nicht egal sein. Und aus Amerika kommt nicht nur die Krise, sondern auch ein neuer Präsident.
Wahlkampf in Amerika!
– ist das „Thema des Tages“ in der SZ, und zwar so:
„Manöver am Abgrund – John McCain präsentiert sich nicht mehr als Wahlkämpfer, sondern als Patriot, doch die meisten werten dies nur als Taktik. Im Moment scheint die Krise dem Demokraten Obama zu nutzen.“ (26.9.)
Es kann passieren was will – Demokraten finden für alles einen gemeinsamen Nenner: Es geht ihnen darum, wie sich die politischen Führer über alle Gegensätze und Entzweiungen im Land hinweg erfolgreich als Inkarnation der Einheit ihrer Nation präsentieren, und wenn Krise ist oder eine andere Katastrophe, dann schon gleich. So ist so ein Abgrund
in einem Wahljahr für sie der Auftakt zur Prüfung, ob diese Selbstdarstellung dem einen der zur Auswahl stehenden Kandidaten überzeugend gelingt, und siehe da: Bei dem wollen die meisten
glatt durchschaut haben, dass der den Patrioten, der die Nation an oberster Stelle eint, doch bloß mimt, er als Patriot
doch nichts weiter ist als Taktik
, ein Akt bloß geschauspielerter Selbstdarstellung. Man berichtet im Tonfall größter Selbstverständlichkeit davon, dass die Glaubwürdigkeit, mit der da einer punkten will, etwas Erschwindeltes zum Inhalt hat – und gibt gleich danach zu verstehen, wofür allein man dies von Belang hält: Wie erfolgreich ist der Mann bei seinem Schwindel, wird er durchschaut oder nicht? Das interessiert den Fachmann für Demokratie, und in derselben abgebrühten Manier attestieren die Wahlkampfbeobachter dem Konkurrenten dann auch mehr Professionalität beim Schauspiel: Dieselben Profilierungskünste, die sie bei dem einen als taktisches Manöver durchschauen, würdigen sie bei dem anderen absolut verständnisvoll als erfolgreiche Taktik, die Krise für sich zu nutzen
! So will es ihnen wenigstens scheinen, denn schließlich ist der Mann ja auch unser Favorit.
*
Am selben Tag dient derselben Zeitung das Beben an den Finanzmärkten
als Stoff für ein ganzseitiges Drama in 10 Akten
. Die Spannung hält sich allerdings in Grenzen, da gleich zu Beginn feststeht, wie es enden wird:
Ein Traum zerbricht.
„Die einen wollten ein schönes Haus, die anderen einfach nur reich werden. Das konnte nicht gut gehen.“ (SZ, 26.9.)
Und warum nicht?
„Am Anfang ist der Traum. Er beginnt mit einer Unterschrift. Viele Amerikaner unterschreiben, weil sie sich den Traum vom eigenen Heim erfüllen wollen. Es gibt Kredite für alle. Alle sind glücklich, alle dürfen mitträumen. Auch die Finanzmakler sind glücklich, sie kassieren Provisionen, indem sie Menschen Darlehen aufschwatzen, die sich so etwas eigentlich gar nicht leisten können.“
Tja, Träume sind zum Träumen da. Das Glück jedenfalls, das sich einfindet, macht man sich an ihre Erfüllung, steht auf tönernen Füßen: Arme Leute machen doch nur Schulden, die sie nie bezahlen können, wenn sie meinen, die schöne Welt des Privateigentums wäre auch für sie eingerichtet. Und Finanzmakler, die ausgerechnet mit Armen noch reicher werden wollen, fliegen auf die Nase, weil sich deren Selbsttäuschung bei ihnen bloß als Minus in der Bilanz saldiert. So kommt es, wie es kommen muss, und am Ende bleibt den Amerikanern wohl nichts anderes übrig, als wieder anzufangen zu träumen
– nur dass sie diesmal ihrer Einkommenslage entsprechend auch beim Träumen zu bleiben haben.
*
Zum Wochenende die nächste Bankenpleite in den USA: Größte Sparkasse kollabiert
, wie es so unverantwortlich schlampig in der SZ heißt. Die deutschen Sparkassenmanager müssen gleich am Montag Beschwerde wegen Rufschädigung einlegen: Das war keine Sparkasse, wie wir eine sind – Deutschland und Europa sind anders! Freilich, die SZ ist sich da nicht mehr so ganz sicher und ruft uns alle auf dem alten Kontinent zur Umkehr auf, ehe es zu spät ist: Wie sich Europa von den amerikanischen Exzessen lösen kann
– ganz einfach, meint Alexander Hagelüken: Abschied von der Gier nehmen
(SZ, 27./28.9.). Kam aber wohl doch zu spät, der Tipp. Außer der verheerenden Niederlage für die CSU
in den bayerischen Landtagswahlen gibt es einen ersten deutschen Exzess zu vermelden. HypoRealEstate! Die – vormals amerikanische – Krise ist bei uns angekommen!
3. Das „amerikanische Virus“ infiziert Deutschland – die Nation ist betroffen
Noch aber ist Wochenende und damit auch Zeit für Besinnliches. Gegen alle Neunmalklugen, die heute sagen, das konnte nicht gut gehen
, gegen die Kapitalismuskritiker aus allen Lagern
, die sich mit ihrem alten Glauben, die Finanzmärkte sind des Teufels, wieder sehen lassen können
, fühlt sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zu einem weiteren Kapitel im Kampf gegen unerträgliche Systemkritik aufgerufen. Denn anstatt wie die verzärtelten Apologeten des Kapitalismus
andauernd den Preis des Evolutionsgeschehens
, das von der kapitalistischen Marktwirtschaft befördert wird, klein zu reden oder ganz zu verschweigen, muss man schon einmal eines deutlich machen: Eine wahre Apologie des Systems ist nichts für Warmduscher und taugt ohne ein glasklares Bekenntnis zu allen Härten und Gemeinheiten des Kapitalismus einfach nichts! Ohne Wenn und Aber gehört sich fürs System Partei ergriffen, dann muss man sich auch von niemandem mehr mit dem Verweis auf Kinkerlitzchen, die daneben gehen, anöden lassen: Ohne Krisen sind freie Märkte tatsächlich nicht zu haben. Aber das ist gut so
– denn risikofreudige Finanzspekulanten sind ein einziger Segen für die Evolution. Das sieht man erstens an der Eisenbahn:
„Am Beginn einer Finanzkrise steht gewöhnlich eine Spekulation, die aus billigem Geld und einer verheißungsvollen Investmentidee bestand. Nach der Krise war die Spekulation vorüber, die Investmentidee aber geblieben. Das berühmteste Beispiel sind die Spekulationen mit Eisenbahnaktien Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals finanzierten die Anleger den Eisenbahnbau, und wenn auch viele Gesellschaften pleite gingen, so blieb doch die Eisenbahn als volkswirtschaftlich höchst nützliches Transportmittel.“ (FAS, 28.9.)
So wird aus dem Irrsinn einer Produktionsweise, in der die Schaffung des stofflichen Reichtums an die allererste Bedingung geknüpft ist, dass sich mit ihr Geldreichtum vermehren lässt, ein einziger Geniestreich. Man verweist auf eine Eisenbahn, ein ungemein nützlicher Gebrauchsgegenstand, wie man weiß, und die soll natürlich auch fahren können, im Dienste des Fortschritts für alle selbstverständlich. Dass dieses schöne Projekt als riesiges Spekulationsgeschäft, also nur wegen der verlockenden Gewinnaussichten für Geldanleger zustande kommt, nimmt man umgekehrt zur Kenntnis: Die Investmentidee
, also die Spekulation mit Eisenbahnaktien, ist der Weg zum späteren Eisenbahnbau, und wenn die Spekulation dann platzt und das Investment flöten geht – was bleibt dann übrig, nachdem sich die große Staubwolke gelegt hat und der zerstörte Reichtum nachgezählt ist? Richtig, die Idee für ein neues Investment und eine wirkliche Eisenbahn, an der man dann nur sieht, was für ein höchst nützliches Transportmittel für den Fortschritt von Technik und Menschheit das Spekulieren ist. Das sieht man zweitens auch an ihm selbst und dann besonders schön, wenn es in der Krise ist:
„In der aktuellen Krise besteht der Fortschritt gerade in der Entwicklung und Verbreitung jenes heute verteufelten Finanzproduktes: der Verbriefung von Forderungen in handelbare Wertpapiere. Grundsätzlich verbessern diese Innovationen die Effizienz der Finanzmärkte, weil sie für die individuellen Bedürfnisse von Investoren maßgeschneidert werden können“.
Schon toll, diese Finanzmärkte: Jeder Spekulant kommt mit ihnen auf seine Kosten! Mit ihren ‚Innovationen‘ schafft die Spekulation ihren Fortschritt, und wenn sie dabei platzt, dient auch das nur ihrem Fortschritt: Dass nicht alle diese Produkte die Krise überstehen und nicht wenige Banken bitteres Lehrgeld zahlen mussten, gehört zu einem notwendigen, wenn auch teuren Lerneffekt.
Sicher: Etwas teuer ist er schon, der Lerneffekt, der in der Vernichtung von Reichtum in erstaunlichen Größenordnungen, Stilllegungen ganzer Schlüsselindustrien und einer Beschädigung der Lebenslage von Millionen besteht. Aber eben auch notwendig für den großartigen Lernerfolg, dass das Spekulieren nach der Krise ja wieder von vorne und genau so wie vorher losgehen kann! Schon wahr: Was nicht verzärtelte Apologeten des Kapitalismus betrifft: ohne eine gewisse Grobheit des Verstandes und Rohheit des Gemüts ist ihr Anliegen einfach nicht zu haben.
*
Dann kehrt doch wieder Ernst ein im Land: Erste Anzeichen einer vernehmlichen Betroffenheit durch die Krise kündigen sich an. Geistig ist man zwar noch ganz in Amerika vertieft, geißelt zum wiederholten Mal die Verfehlung, finanzkapitalistische Innovationen für das soziale Programm einer Förderung von Wohneigentum
zweckentfremdet zu haben, und nimmt außerdem das sich ankündigende wirtschaftspolitische Verbrechen ins Visier, US-Autokonzerne am Leben erhalten zu wollen – wo doch europäische Autos billiger, besser und umweltfreundlicher sind
. Aber pünktlich zum Wochenbeginn steht für die Redaktion des Weltblatts aus München fest – der Konjunktur droht Ungemach:
„Nun kann auch die Bundesregierung nicht mehr anders, als die Realität einzugestehen. Die deutsche Wirtschaft wird nächstes Jahr deutlich weniger wachsen als vorausgesagt ... Die Bundesagentur für Arbeit macht den Deutschen zwar ein wenig Hoffnung. 2009 soll es keine Zunahme der Arbeitslosigkeit geben. Aber das kann nur bedeuten: noch nicht. Die Wachstumsschwäche wird sich eher früher als später auf die Beschäftigung auswirken.“ (SZ, 29.9.)
Für einen Kenner der ökonomischen Gesetze, die in einer Marktwirtschaft gelten, besteht da kein Zweifel: Von einem Einbruch in der Ziffer des kapitalistischen Wachstums führt der Weg zielstrebig zum Anstieg der Zahl derer, die für dessen produktive Herstellung nicht mehr gebraucht werden. Und auch wenn er sich beim Zeitpunkt des Eintretens dieses Sachzwangs nicht festlegen will – eine Konsequenz weiß er aus dem schon für heute abzuleiten:
„Die nächsten Lohnabschlüsse werden in einer Phase des Abschwungs gelten. Wenn die Gewerkschaften zusätzliche Entlassungen vermeiden wollen, müssen sie dies berücksichtigen.“
Noch so ein unwiderrufliches Gesetz der Marktwirtschaft kommt mit dem Rückgang des kapitalistischen Geschäfts also zum Tragen. An den Verein, der sich der Besserstellung von Leuten widmet, die von ihrer Arbeit leben müssen, ergeht der sachverständige Rat, sich beim Lohnkampf äußerster Zurückhaltung zu befleißigen: Nur so nämlich ließen sich möglichst viele der Arbeitsplätze retten, die demnächst mangels Rentabilität ohnehin wegfallen werden. Und aus derselben Logik, keinesfalls mit verkehrten Diensten am Lebensunterhalt der lohnarbeitenden Massen den Umstand noch zu befördern, dass sich für die Ausbeuter der Arbeit ihr Geschäft demnächst wohl weniger rentieren wird, lässt sich auch noch eine Maxime für die politische Leitung des Standorts herleiten:
„Besonders brisant ist, dass der Abschwung in ein Wahljahr fällt. Weil die Deutschen 2005 die Schrödersche Agenda genauso abstraften wie Merkels Reformideen, sind SPD wie Union in letzter Zeit merklich nach links gerückt. Sie versuchen die Wähler mit Versprechen aller Art zu gewinnen, die im Zweifel Geld oder Wachstum kosten. Im Konjunkturtal sieht eine verantwortliche Politik anders aus. Die Gefahr ist groß, dass die verunsicherten Volksparteien die Folgen des Abschwungs verschlimmern.“
Gut, dass man seinen journalistischen Politikberater hat. Der weiß auch in einer Lage, in der von irgendeiner ‚linken‘ Reaktion in den Reihen der wählenden Massenbasis absolut nichts zu bemerken ist, vor der Gefahr eines Linksrucks zu warnen. Die sieht er nämlich allein schon dort gegeben, wo – nur weil gerade Wahlen anstehen – irgendein politisch Verantwortlicher womöglich meint, den Wählern unumgängliche Härten ersparen zu können, oder auch nur so tut, als wollte er dies. Das hält der Mann für den größten Fehler, den Politiker machen können, und den macht er mit dem Etikett ‚links‘ als Skandal namhaft: Die hohe Verantwortung fürs Wachstum, die Politiker tragen, lässt Geldgeschenke an die falsche Adresse grundsätzlich nicht zu, und in Zeiten, in denen das Wachstum knapper wird, erst recht nicht. Was hingegen ansteht, erläutert am selben Tag der Kollege von der Bild-Zeitung. Der geht gleichfalls davon aus, dass das Volk im deutschen Kapitalismus ein wahres Paradies vorfindet, das man nicht antasten darf – die liberale Marktordnung hat Millionen Menschen Wohlstand gebracht und darf nicht leichtfertig infrage gestellt werden.
Und weil das für ihn so ist, gilt bei allem, was im Abschwung der Konjunktur demnächst auf die Bewohner dieser Glücksinsel zukommt, hauptsächlich eines: Wir sollten nicht zulassen, dass die Linke in diesem Land das Thema für Wahlkampfzwecke missbraucht.
(Bild, 29.9.)
*
Nachdem bis gestern noch feststand, dass die Finanzkrise eine hausgemachte amerikanische Angelegenheit ist, Deutschland davon allenfalls, wenn auch ziemlich wahrscheinlich, mit einem Abschwung beim Wachstum betroffen ist, ist tags darauf der Schrecken umso größer: Mit der
Pleite der HypoRealEstate
ist die Finanzkrise auch bei uns
gelandet!
„Jetzt ist die Finanzkrise bei jedem Deutschen vor der Haustür angekommen... Bisher schien es vor allem eine amerikanische Krankheit zu sein, dass Banker blind auf Rendite starrten und Risiken nicht verstanden oder ignorierten. Nun zeigt sich, dass folgenschwere Fehleinschätzungen auch im Zentrum der deutschen Finanzbranche vorkommen.“ (SZ, 30.9.)
Fehlleistungen der Bankmanager, von deren ungesunder Gier man inzwischen ja weiß, waren es also, die den deutschen Finanzriesen in die Klemme gebracht haben – und für deren Fehler hat der Staat mit einer Bürgschaft in Höhe von 26 Mrd. einzustehen, damit die Folgen der Pleite nicht noch verheerender ausfallen. Das ist, da kennt der Journalist seine Bürger und auch, was die an der großen Welt der Politik besonders interessiert, vor allem ein Problem für den Gerechtigkeitssinn
im Volk: Deswegen hat er ihm ja die Pleite einer Bank gleich vor die eigene Haustür gelegt. Also macht die ‚Süddeutsche‘ sich vorauseilend die Gedanken des ‚Steuerzahlers‘, der in jedem Bürger steckt, um ihm behutsam beizubringen, wie er als diese Charaktermaske zu denken hat:
„Falls das Geld fließt, muss rechnerisch jeder einzelne Deutsche vom Säugling bis zum Rentner 350 Euro zahlen, mehr als der Hartz-IV-Regelsatz. Ein hoher Preis für die Verfehlungen von Managern. Was bekommt der Steuerzahler als Gegenwert? Diese Frage lässt sich leider schwieriger beantworten. Die Gefahr ist immer, dass der Kollaps eines Finanzhauses Panik auslöst und den Rest der Wirtschaft in den Abgrund stürzt: Banken geben keine Kredite mehr, Firmen investieren nicht mehr, Sparer plündern ihre Konten. Ein solches Szenario gilt es natürlich zu verhindern.“
Dem ‚Steuerzahler‘, der sich die Gelder, die er abführen muss, ja so gerne in einen eingebildeten „Gegenwert“ übersetzt, den er dafür erhält, wird empfohlen, in diesem Fall Weitblick zu zeigen: Laufen die Bankgeschäfte nicht, bricht alles Produzieren und Konsumieren zusammen und die Ersparnisse sind auch futsch. Also spricht diese Abhängigkeit der ganzen Volkswirtschaft bis hinunter zum Notgroschen fürs Alter von einer intakten Finanzwelt unbedingt für das staatliche Rettungsmanöver: Eine volkswirtschaftliche Großkatastrophe gilt es natürlich zu verhindern
. Das hat die Politik ihren Bürgern eindringlich zu vermitteln, also zerbricht sich ein verantwortlicher Journalist den Kopf, auf dass den Amtsinhabern das schwierige Werk gelingen möge. Dazu ruft er als erstes die eigentliche Bedeutung in Erinnerung, die so eine Bankpleite und die staatliche Bürgschaft, mit der sie abgewendet werden soll, in einer Demokratie allemal haben:
„Mit dem in letzter Sekunde abgewendeten Zusammenbruch der Hypo Real Estate finden sich Merkel und ihre Regierung inmitten ihrer ersten großen Krise wieder, weil sie weit über die Tatsache hinausgeht, dass die Finanzmisere nun auch Deutschland endgültig erreicht hat. Es sind die politischen Auswirkungen, die das letzte Jahr vor der Bundestagswahl überschatten dürften, welche der Kanzlerin, der Union und auch der SPD zu denken geben müssen.“
Wie alles ist auch eine Bankenkrise Prüfstein für die Frage, welcher der politischen Herren bei der nächsten Wahl das Vertrauen des Publikums verdient, und da hat im vorliegenden Fall die diesbezügliche Werbung beim Volk eines zu berücksichtigen: Das Verständnis des Bürgers wird schon sehr strapaziert, wenn er die Milliarden, mit denen der Staat für die Rettung seiner Banken bürgt, unter dem zwar sachfremden, ihm aber allemal naheliegenden Gesichtspunkt der Gerechtigkeit in Augenschein nimmt – und sich augenblicklich äußerst ungerecht behandelt vorkommt! Diesen Unmut der Bürger kann man jedenfalls sehr gut nachvollziehen:
„Es geht in erster Linie um den vorhersehbaren und nachvollziehbaren Eindruck vieler Bürger, dass die Politik mit zweierlei Maß misst, wenn die Verteilung von Milliarden von Euro zur Debatte steht. Es geht schlicht um das Gefühl, dass hier etwas verdammt schiefläuft.“
Mindestens genauso gut einfühlen kann man sich daher auch in die Schwierigkeiten der Politiker, den Bürgern das ungute Gefühl, bei der Verteilung staatlicher Gelder irgendwie verarscht zu werden, wieder erfolgreich auszureden:
„Einstweilen lautet die Losung, man müsse Schlimmes tun, um noch Schlimmeres zu verhindern. Man nimmt also für sich in Anspruch, zum Ärger der Bürger im Sinne der Bürger zu verhandeln. Wer das erklären muss, ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden.“
Weil sein muss, was sein muss, darf der Bürger sich zwar ungerecht behandelt vorkommen, daraus aber keinesfalls etwas anderes als einen Vertrauensbeweis für die ableiten, denen er die Verletzung seines Gerechtigkeitsgefühls zu verdanken hat. Ärgern kann sich der Untertan schon, sogar wütend
darf er über die Machenschaften seiner Herrschaft sein – aber dann hat er auch wieder die Schnauze zu halten: Und dennoch ist es richtig, dass die Bundesregierung hier einspringt. Weil es den Staat billiger kommt, diese Bank zu retten, als tatenlos zuzusehen, wie ein Finanzinstitut andere mit in den Abgrund reißt.
(Bild, 30.9.) So hat man seinen Politikern nicht nur die Rettung der Bank zu danken. Man hat ihnen darüberhinaus auch jede Menge Respekt dafür zu zollen, ein demnächst wieder florierendes Finanzkapital als verheißungsvolle Perspektive für das eigene private Fortkommen zu verkaufen!
*
Das weckt natürlich das Bedürfnis nach Verdeutlichung des moralischen Grundsatzproblems, zu dem die Krise und ihre Bewältigung gediehen sind. Onkel Wagner von der Bild-Zeitung geht das so an, dass er in einem kleinen Monolog an die Adresse des Finanzministers den politischen Stifter aller Gerechtigkeit, v.a. aber seine Leser daran erinnert, dass es der einfache Mann und seine Frau schon seit längerem auch nicht leicht haben; und in stummer Demut nicht nach Milliarden schreien, sondern höchstens um ein Paar Euro betteln:
„Lieber Finanzminister Steinbrück, die Hypo Real Estate, die Bank zur Immobilienfinanzierung, war nicht mehr liquide, flüssig. Mit einer 26,6-Milliarden-Bundesbürgschaft, dem Geld des Steuerzahlers, haben Sie die Bank über Nacht gerettet. Hier eine kleine Liste von Leuten, die auch nicht flüssig sind und auf Rettung warten. 1. Die alleinerziehende, berufstätige Mutter ... 2. Der Rentner ... 3. Die Kinder, die nicht mitdürfen zur Klassenfahrt, weil ihre Eltern die 20 Euro nicht haben. 4. Die Senioren ... 5. Die Studenten ... 6. Die Krankenhäuser ... Mein 7. Punkt ist der schlimmste: Es gibt Kinder, die kein richtiges Mittagessen bei uns in Deutschland haben. Lieber Finanzminister, Sie haben Milliarden für eine Bank. Warum haben Sie nicht ein paar Euros für uns.“ (Bild, 1.10.)
So gehört sich der Gerechtigkeitssinn im Bürger gepflegt. Man nimmt sich mitfühlend seines gewöhnlichen Elends an. Man erzählt ihm vor, was für ein armer Hund er ist, und wie recht er damit hat, sich von seinem Staat nicht besonders gerecht behandelt vorzukommen – erinnert ihn also daran, dass eine Behebung all seiner privaten Drangsale allemal ein Akt der Gewährung ist und würdigt seinen rechtschaffenen Lebenskampf ohne Staatshilfe. So übt man arme Leute in die Pose ein, die sich gegenüber der Macht, die über den Reichtum gebietet, allein geziemt: die des bescheidenen Bittstellers, der sich an seine Obrigkeit wendet und sich dabei gar nichts groß vormacht über den praktischen Effekt der eigenen Unterwürfigkeit. Der nur noch anerkannt werden möchte als jemand, der auch ein Recht hat auf Berücksichtigung seiner persönlichen Belange – auf dem er freilich, anständig, wie er nun einmal ist, überhaupt nicht besteht.
*
Dieser von der Bild-Zeitung im Namen aller ordinären Opfer des Kapitalismus erwiesene Vertrauensbeweis gegenüber der Instanz, die ihren kapitalistischen Laden gerade aus seiner Krise retten soll, ist manchem wirtschaftswissenschaftlichen Experten irgendwie zu oberflächlich. In der Krise des Finanzsystems, die jetzt auch Deutschland erwischt hat, entdecken sie eine
Vertrauenskrise
und über die machen sie sich in gebotener Grundsätzlichkeit her. Zum Beispiel so:
„Längst geht es nicht mehr allein um Aktienanleger. Weil in den USA und Europa Banken zusammenbrechen, fürchten Sparer um ihre überschaubaren Ersparnisse. Weil die Krise Staaten in die Rezession drückt, fürchten Beschäftigte um ihren Arbeitsplatz. Die Menschen müssen sich auf eine lange Zeit der Unsicherheit einstellen ... Wenn die Menschen unsicher werden, bedroht das die Existenz eines Wirtschaftssystems, das zuallererst auf Vertrauen aufgebaut ist ... Das ganze System basiert auf dem Zutrauen, dass all die virtuellen Billionensummen tatsächlich zur Verfügung stehen. Wenn aber Sparer das Vertrauen verlieren und die Filialen stürmen, bricht das System zusammen. Dann verlieren nicht einfach Banker ihre Millionengagen und Aktionäre ihre Dividenden. Dann bekommen Firmen keinen Kredit mehr, und die Maschinen stehen still. Weil die Menschen derzeit in rasantem Tempo unsicher werden, steht die Weltwirtschaft am Abgrund. Da alles auf Vertrauen gründet, ist es suizidal, dass die Finanzbranche so viel Vertrauen verspielt hat.“ (SZ, 1.10.)
Eines mag man dem Fachmann für Ökonomie nicht bestreiten: Es wird schon so sein, dass die Krise der Menschheit im Kapitalismus einiges an Unsicherheit
beschert. Äußerst verwegen allerdings ist die Behauptung, es sei deswegen die Unsicherheit der Menschen, die dem System seine Krise beschere. Eine Konkurrenz von Privateigentümern aus der Tugend herzuleiten, dass doch jeder sich auf alle anderen verlassen können muss, und derart eine Welt von Gegensätzen – zwischen den Konkurrenten wie zwischen ihnen und dem Staat, der sie mit seinem Recht kontrolliert – in ein System zwischenmenschlicher Bindungen zu verfabeln: Das zeugt erstens nur von einem abgrundtiefem Verständnis für alles, was sich in diesem System so abspielt, und zweitens vom unbedingten Wunsch, das alles möge ewig so weiter klappen wie bis neulich noch. Beides zeugt drittens aber schon auch von einer – höflich gesprochen: – extremen Unsachlichkeit dieses affirmativen Denkens, das vom Sparen und von virtuellen Billionensummen in Bankbilanzen bis zum Kredit und dem Stillstand der Produktion auf den Kapitalismus und seine seltsamen Einrichtungen nur deutet, um das Lob loszuwerden, welch filigranem Kunstwerk des moralischen Willens seiner Insassen der sich verdankt.
*
Altgediente Politiker aus den Reihen der christlichen Union, die sich um den Kapitalismus in Deutschland sehr verdient gemacht haben, avancieren mit ihrer christlichen Soziallehre, nur weil Krise ist, zu den anerkannten Kapitalismuskritikern. Ihre Kritik betrifft das Vertrauen, das die Zocker
gründlich verspielt haben. Sie sehen sich ins Recht gesetzt durch das Scheitern einer verfehlten Idee
(Geißler), die mit Beginn ihres politischen Ruhestands an die Macht gelangt sei, und steigen in einen Abgesang auf den Neoliberalismus ein:
„Der Neoliberalismus scheitert am Menschen, wie er ist, sein will und soll. (...) In der christlichen Soziallehre rechtfertigt sich Eigentum als ‚Frucht der Arbeit‘. Arbeit, mit der Eigentum legitimiert wird, kann freilich in vielerlei Gestalt auftreten. Sie kann auch eine Finanzdienstleistung sein, aber nur so lange sich diese Finanzdienstleistung in der Pflicht sieht, dem Allgemeinwohl zu dienen.“ (Blüm, SZ, 25.9.)
So konstruiert sich ein kritisierender Moralist den Kapitalismus als Heimat der Menschennatur zurecht: Der Mensch lebt im Kapitalismus von den Früchten seiner Arbeit, wie sie ihm so zufallen, will nichts anderes und soll auch nichts anderes wollen, womit es von der Rechtfertigung des Eigentums als Ertrag rechtschaffener Arbeit nahtlos zu der des Bankwesens als Dienst an der Gemeinschaft aller Rechtschaffenen übergeht und die Klassengesellschaft, wie sie geht und steht, als verwirklichtes Menschenrecht fertig dasteht. Diese Idylle haben wir schon einmal gehabt, nämlich in den goldenen Zeiten, in denen ein fröhlicher Arbeitsminister noch eigenhändig Plakate mit der Aufschrift klebte : ‚Die Rente ist sicher!‘ – und schon damals die Frage nicht aufkam, in welcher Höhe denn überhaupt. Diese schöne soziale Marktwirtschaft
und den sozialfriedlichen rheinischen Konsenskapitalismus
haben neoliberale Verbrecher
pervertiert, aus dem Kapitalismus, wie der Mensch sich ihn geschaffen hat, eine durchkapitalisierte Gesellschaft
gemacht – und herauskommt: Heimatlos ist der moderne Arbeitnehmer
geworden. Und mit diesem tiefen Seufzer nach der guten alten Zeit der Blümschen Rentenkürzungen wird er von seinem politischen Interessenvertreter i. R. in die neue entlassen, die auf ihn zukommt.
Der zweite, der sich in Talkshows und schriftlich in der einzigen Sorte Kapitalismuskritik exponiert, die es in der deutschen Öffentlichkeit gibt, ist Ex-Sozial- und Familienminister Geißler. Der hält ziemlich viele der hierzulande eingerissenen geschäftlichen Praktiken im Umgang mit der Arbeitskraft für höchst skandalös – „20 % Rendite in Rumänien statt 10 % in Bochum: dafür wird die wirtschaftliche Existenz von 10 000 Leuten vernichtet“ (WDR, Hart aber fair, 1.10.) –, hält aber natürlich nicht das Geschäft für den Skandal, dem es um seine Rentabilität geht. Das kapitalistische System
, für dessen Abschaffung er glatt plädiert, ist leider schon wieder nicht der Kapitalismus, den es gibt, sondern bloß das, was ein frommer Humanist an ihm unter den Titeln Turbo
oder ungezügelt
für kritisierenswert hält. An die Stelle des jetzigen kapitalistischen Systems
hat daher zu treten – der Kapitalismus in Gestalt einer öko-sozialen Marktwirtschaft
, mit geordnetem Wettbewerb, Demokratie, sozialer Ordnung und allem übrigen, was einem Christenmenschen das Arbeitsleben unbedingt lebenswert erscheinen lässt.
*
Und noch einer meldet sich, kaum ist die Finanzkrise in Deutschland angekommen, mit einer Absage an die kapitalistische Geldwirtschaft zu Wort: Wir sehen nun, beim Zusammenbruch der großen Banken, dass das Geld verschwindet, dass es nichts ist.
Wo Werte vernichtet werden, die für den Papst ohnehin keine sind, weil nur Konsequenz einer materialistischen Verblendung der Menschheit, sieht er unmittelbar, wie taufrisch die Lehre von der Eitelkeit alles Irdischen ist, die seine Kirche seit Ewigkeiten predigt: Es gibt kein richtiges Leben im falschen, in dem der schnöde Mammon regiert, ein hoffnungsloser Idealist ist, wer im Streben nach weltlichen Gütern sein Glück sucht – dies alles wirkt so real, wird aber eines Tages verschwinden. Ein wahrer Realist ist daher, wer auf das Wort Gottes baut
. Für ihn jedenfalls gilt, was er sagt: Angesichts der Opfer, die die Krise schafft, auf eine Hochkonjunktur des Angebots zur seelischen Tröstung zu spekulieren, für das er wirbt, zeugt durchaus vom Realismus des Mannes. Blöd ist nur eines: ‚In God we trust‘ steht ausgerechnet auf dem gewichtigsten aller Gelder, die vor Gott und seinem real wirkenden Stellvertreter nichts
sind – worauf sollen wir jetzt bauen? Hilft nur noch beten?
4. Daumendrücken für die Rettung des deutschen Kapitalismus
Das kann schon angesichts täglich neuer Tiefststände bei Dax und Dow Jones nicht schaden. Da bemühen Nachrichtenredakteure auch mal einen Scherz, um das Publikum auf die düsteren Zahlen einzustimmen: Heute fielen die Kurse nicht in den Keller
, meldet uns Tom Buhrow, denn am Wochenende haben die Weltbörsen zu
. Die Krise macht keinen Ruhetag! Deshalb spielt gerade das Wochenende in der Finanzwelt eine große Rolle: Wo andere die Füße hoch legen, finden in den Chefetagen der Nation fieberhafte Aktivitäten
statt, um die Atempause zu nutzen
; entscheidende Weichen
werden da hinter den Kulissen
gestellt – und aktuell eine ganz besonders wichtige: Bis zum Börsenstart Montag früh will der deutsche Staat seine HRE-Bank retten.
Im Kanzleramt brennt noch Licht
(ARD)
– und was sehen wir da? Dem gebannten Blick auf die Taten der Krisenmanager widmen die meinungsbildenden Anstalten ihre Hauptsendezeit. Bei allem, was die Herrschaft erörtert und verordnet: Das Volk ist live dabei! Gelingt dem OP-Team unter Chefärztin Merkel der komplizierte Eingriff
? Erste kantige Geste: Deutschlands Top-Banker mussten zur Krisensitzung nach Berlin jetten. Gegen 15 Uhr trafen die Chefs von u.a. Deutscher Bank (Ackermann), Commerzbank (Blessing), Bankenverband (Müller) in der Hauptstadt ein.
(Bild, 4.10.) TV-Reporter drücken uns allen die Daumen, der Staat möge die illustre Runde
dazu bringen, die Rettung der HRE nicht wieder zu verhindern
. Hinter der Kulisse ist jedenfalls jede Menge was los: Es wird regiert; Politiker handeln; sie kümmern sich um unsere Probleme, bestellen die Elite des Geldkapitals zum Rapport und zwingen sie zur Spätschicht! Das nährt Zuversicht: Wird die Tatkraft unserer politischen Häuptlinge Deutschlands Top-Banker auf Linie und die Nation voran bringen?
Das Thema beschäftigt uns bis Sonntagabend bei Anne Will: Turbo-Kapitalisten außer Rand und Band! Warum zahlen wir für die Versager?
– eine Themenstellung mit eingebauter Antwort: Erst lenkt man die Kritik auf entartete Exemplare einer grundguten Spezies, erklärt ausgerechnet die geschäftlichen Verfehlungen des freien Unternehmertums zum Skandal und gelangt am Ende streng pluralistisch zur Erkenntnis: Zwar eine Bande von Miss-Managern, aber ein prima System, das sie managen. Banker abwatschen, um die Rettung der Banken zähneknirschend zu begrüßen: Soviel Dialektik ist der Intelligenz am Sonntagabend zuzumuten.
Auch die SZ hakt kritisch nach: Tun unsere Entscheidungsträger das Richtige?
Muss der Staat die Banken retten?
Alexander Hagelüken und Marc Beise sind da konträrer Ansicht: Ja, ohne Hilfe geht alles unter
, titelt der erste, Nein, kein Geld. Für niemanden
(SZ, 4./5.10.) der zweite. Pro Rettung spricht an sich nur eines: die unverschämt hohe Meinung, die A. H. vom deutschen Kapitalismus hat. Wenn dieser Laden einfach alles ist, was uns lieb und teuer ist, dann ist ‚sozial, was Banken rettet‘. Geht dort nichts, geht gar nichts! – und das drückt der Befürworter der Staatshilfe dann glatt als Dienst aus, den er mit einer kindgerechten Feuerwehr-Metapher in den Rang eines humanitären Akts erhebt: Der Staat löscht Brände, damit die Menschen nicht stärker unter der Finanzkrise leiden
. Indem er seine Geldinstitute stützt, bewahrt er uns vor dem Untergang – die deutsche Klassengesellschaft, der süße Mittelstand, die Bausparkassen, die unserer Zukunft ein Zuhause geben: eine einzige Solidargemeinschaft! Kollege M. B. sieht die Lage ebenso fundamentalistisch. Gleichfalls Anwalt dieses kollektiven Wir, bezweifelt er mit seinem Contra, ob die Geholfenen die Hilfe wirklich wert sind: Verdienen die Banker unser Vertrauen, das Richtige zu tun?
Darum sieht er die Milliarden im Fall HRE sinnlos verpulvert: Es wird so sein, dass das Signal ‚Der Staat paukt uns raus‘ der Startschuss zu neuen Vabanque-Spielen ist – alles andere wäre wider die menschliche Natur. Wie sicher ist es eigentlich, dass nicht immer mehr Geld nachgeschossen werden muss, bis der Staat am Ende kapitulieren muss?
Auch das ein sehr staatstragender Alptraum: ‚Haushalt scheitert am Vabanque der nimmersatten Menschennatur‘! Zur Kapitulation kommt es – Berlin sei Dank – fürs erste dann aber doch nicht.
*
Chaos-Bank zum 2. Mal gerettet! Regierung und Finanzwirtschaft beschließen Rettungspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro
. Laut Bild ist das genau die richtige Antwort der Kanzlerin
, und das Beste daran:
Sparer können aufatmen!
Denn: Der Staat wird die Spareinlagen garantieren, und zwar zu 100 %! Im Klartext: Kein Bürger muss um sein Geld fürchten, falls seine Bank Insolvenz anmeldet.
Vorausgesetzt, der Versicherungsfall tritt nicht ein, zumindest nicht massenhaft, weil: Eine solche Garantie könnte beim Zusammenbruch mehrerer Banken sehr teuer werden. Deshalb muss der Staat alles tun, um ein Bankensterben zu verhindern.
(Bild, 6.10.) So schmiedet das Volksblatt ausgerechnet Sparer und Banken, die in ganz unterschiedlicher Weise mit Schulden zu wirtschaften pflegen, zu einer einzigen Einheitsfront zusammen: Für den gewöhnlichen Menschen und Kunden der Bank sind Schulden, die er macht, oder Geld, das er spart, zwei alternative Formen des Managements der Armut. Für die Bank hingegen sind Schulden, die ihre Kunden bei ihr oder sie bei ihren Kunden macht, prinzipiell Geschäftsmittel und Hebel der Geldvermehrung in ihrer Hand - und miteinander kommensurabel werden die derart entgegengesetzten Dienste, die Schulden für Arme und für Banken tun, überhaupt nur vom Standpunkt des praktischen Interesses armer Schlucker, die bei den Banken ihr Konto unterhalten: Für die gilt allemal, dass ihr Geld bei der Bank nur sicher ist, wenn die in der Krise ihrer Geschäfte auch überlebt! An diesem Interesse wird der Mensch gepackt, zum Aufatmen animiert, wenn der Staat seine Banken rettet – und darüber auch zur unbedingten Parteinahme für die Sicherstellung der Macht der Banken. Sie ist alternativlos und deshalb vernünftig.
„Viele wünschen sich, der Staat solle solche Banken doch untergehen lassen – und ihre Vorstände ebenfalls. Aber jetzt hilft nicht Wut weiter, sondern nur ein kühler Kopf. Und die Staatsgarantie für Sparer.“
Derweil hat sich auch die SZ von der Entwicklung belehren lassen, was das Gebot der Stunde ist:
Starker Staat gefragt!
Der soll sich jedoch nicht bloß durchs Spendieren von teurem Staatsgeld auszeichnen, sondern Stärke zeigen, indem er das Krisenvirus präventiv an seiner Wurzel packt:
„Mit teuren nationalen Rettungsaktionen bis zur kompletten Verstaatlichung lassen sich nur die Symptome der Krise angehen, nicht aber die Ursachen. Wer die Ursachen bekämpfen will, muss die staatliche Aufsicht verstärken. Aber nicht rückwärts gerichtet im Sinne der Wiedereinführung eines allumsorgenden Nanny-Kapitalismus, sondern auf Basis eines vorausschauenden Finanzmarkt-Regelwerks. Dazu zählen strengere Kriterien für Bonuszahlungen sowie schärfere Bilanzierungs- und Eigenkapitalvorschriften. Starke Eingriffe also, die wie Leitplanken wirken.“ (SZ, 6.10.)
Die Diagnose von der fehlenden Aufsicht als Grund der Krise, also die Erklärung einer geplatzten Spekulation aus einer unterlassenen Verhinderung ihres Platzens, scheint dem Autor zu gefallen. So gut, dass er die Ursachenforschung konsequent weiter spinnt: Mehr Kontrolle, ja – aber bitte keine Nanny
, nur Leitplanken
! Offenbar wächst mit jeder Festrede auf den heilsamen Effekt staatlicher Eingriffe das Bedürfnis, den Eindruck eines Angriffs auf die Freiheit des Kapitals zu vermeiden. Ihr gilt es, einen soliden Rahmen zu geben; dafür entwirft der Fachmann das Bild eines allumsorgenden
überlebten Kapitalismus, der mit der rechten Dosierung aus Freiheit für die Spekulation und deren Schutz vor allzu riskanten Wetten vorsorglich zu bekämpfen ist. So macht sich die blühende Fantasie berufener Politikberater einmal mehr um die Abwehr von Ideen verdient, die sie für marktwirtschaftlich absolut unvernünftig und deswegen tendenziell für systemkritisch halten – und wenn sie sich die erst selber ausdenken müssen!
Am selben Tag erscheint der Spiegel:
Angst vor der Angst – Die gefährliche Psychologie der Finanzkrise!
Die Titelgeschichte entführt uns geistig einerseits ins Wunderland der Seele, das auf den realen Kapitalismus mehr Einfluss hat, als man denkt: Angst, diese uralte menschliche Emotion, ist das Benzin in der Welt des Mammons – die Mutter aller schlechten Eigenschaften.
Die Herleitung der Finanzkrise aus der Angst vor ihr ist zwar paradox, hat aber einen bedeutenden intellektuellen Nährwert. Man kann sich die Finanzkrise einmal als etwas ganz anderes vorstellen, als Bootsfahrt auf einem See in Afrika z. B.: Die Besatzung ahnt, dass da Krokodile lauern, aber sie weiß nicht, wie viele und wie groß sie sind.
Spiegel-Leser dagegen wissen mehr: Über die internationale Finanzwelt – unheimlich
, eine heimliche Welt
; über die Politik – eine virtuelle Welt des Machtspiels
; über die Bürger – Angst macht sich breit
; über Politiker und Banker – Angst vor der Angst der Bürger
; über unser demokratisches Gemeinwesen im Allgemeinen und die Folgen der Angst für es im Besonderen – die Finanzkrise lässt nicht nur Vermögen schwinden, sondern auch das Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft und die Reformfähigkeit Deutschlands. Das alles ist ein Werk von Spielern
; und am Ende wissen Spiegel-Leser auch noch alles darüber, wie man in einem See, der ein einziges Krokodil ist, eine Bootsfahrt heil übersteht: Viel hängt davon ab, wie schnell die Akteure an den globalen Märkten wieder Vertrauen fassen, wie lange sie brauchen, bis diese fatale Angst vor der Angst gebannt ist.
Absolut gar nichts hängt für den Spiegel hingegen von der Frage ab, ob die Leute jetzt Grund für die Angst haben oder die Angst der Grund ist, vor dem sie sich ängstigen: Er lässt sie offen. Eines aber ist auch so klar: Wo andere beim Krisen-Management vorschnell politische Tatkraft bejubeln, herrscht beim Spiegel allergrößte Skepsis. Dass die Krise noch immer da ist, zeigt nur, dass die verantwortlichen Akteure ihre Befangenheit in der eigenen Befangenheit doch gar nicht von sich abgestreift haben. In der setzen sie auch noch den Fortbestand des Gemeinwesens aufs Spiel, das sie regieren, wenngleich da, beim schwindenden Vertrauen in die Marktwirtschaft, noch eine Frage offen bleibt: Sind die Leute in der jetzt gut aufgehoben – oder sollen sie glauben, sie wären es? Jedenfalls soll man sich für das VWL-Autorenkollektiv vom Spiegel die Lage auf den Märkten in dieser Woche als Produkt einer Angstspirale
zurechtdeuten – und kann sich am Ende des Artikels aussuchen, welche weiterführende Deutung der Zukunft man bevorzugt: Endzeitfantasien
? Manches spricht für sie, manches gegen sie, z. B. dass ein Wissenschaftler sich sogar vorsichtig optimistisch äußert
. Sogar ein Szenario bietet sich an, das Hoffnung macht
: Während in den gebeutelten Staaten USA, Spanien und Irland der Finanzsektor die produzierende Wirtschaft immer weiter zurückgedrängt hat, verfügt Deutschland nach wie vor über einen soliden industriellen Kern.
Sieht dann doch nicht so schlecht aus, wenn es nach der Krise wieder losgeht. Wenn da bei den Verantwortlichen nur nicht immer diese grundverkehrte Einstellung wäre, die sie bei allem lähmt, was bis dahin auf den Weg zu bringen wäre ...
*
Immerhin versuchen sie ihr Bestes, pumpen Abermilliarden in ihre Banken – doch was passiert? Die Aktienbörsen brechen ein!
Gestern hat man der sturzvernünftigen Finanzwelt Signale
gegeben und geflissentliche Beachtung empfohlen, heute wird gejammert:
Die Märkte handeln völlig irrational!
(Börse im Ersten)
Offenbar wurde erwartet, die Börse müsse den vielen Nullen Respekt zollen; jetzt sind wir betrübt, sie tut es nicht. Offenbar haben dieselben Leute, die gewohnheitsmäßig die Macht der Börse anerkennen, den Reichtum der Gesellschaft zu bewerten, und es ganz vernünftig finden, dass ihr Auf und Ab als das Erfolgskriterium der Volkswirtschaft gewürdigt wird, überhaupt kein Problem damit, dem dort stattfindenden Treiben jede Vernunft abzusprechen. Wenn die Börse den fälligen Dienst am Vertrauen nicht erbringt und just da nicht steigt, wo sie es unbedingt soll, dann spielt
derselbe Markt, den man als Olymp des kapitalistischen Reichtums anhimmelt, eben verrückt
.
Zeitgleich streiten sich die Volksaufklärer über die korrekte Dosis von Entwarnung und Alarm. Das 1-Billion-Versprechen
ist zwar die vermutlich größte Garantie der Weltgeschichte
(Bild); Sorgen erspart das Kanzler-Ehrenwort den Inhabern von Girokonten und Lebensversicherungen aber nicht.
Wie sicher ist mein Geld?
Experten bei Jauch oder Plasberg, die die Ängste der Leute ernst nehmen
, antworten auf Zuschauerfragen nach der heutzutage richtigen Anlageform – und geben mit jedem Tipp zu Protokoll, was für eine trostlose Figur die Opfer der Geldwirtschaft auch als Sparer sind: Von Sachverständigen erfahren sie, dass man sich in der eigenen Armut tatsächlich mehr oder weniger geschickt einteilen kann!
Der SZ reicht da schon
Die Merkel-Garantie
zur Beruhigung unnötiger Ängste: Welchen Wert hat das Wort einer Kanzlerin? Fünf Milliarden? Zehn? Hundert? Es gibt dafür keine Waage, keinen Umrechnungsfaktor, keine Wertanalyse. Die Garantie, die Angela Merkel für private Bankguthaben abgegeben und bekräftigt hat, ist nicht einklagbar, sie hat keinerlei juristische Bedeutung. Sie ist keine Anspruchsgrundlage für einen Sparer, wenn der sein Geld verliert. Und trotzdem: Die Merkel-Garantie ist wichtig und richtig. Sie ist kein politischer Leerverkauf, sondern eine vertrauensbildende Maßnahme; sie ist ein politisches Großversprechen, keine Großmäuligkeit. Sie soll den Deutschen sagen: Die Regierung bleibt gefasst, bleibt ihr es auch.
Vertrauen auf die Macht ist die erste Bürgerpflicht, darum Obacht vor verkehrten Bauernfängern: Fernsehsendungen, die die Frage ‚Welches Geld, wie viel ist abgesichert?‘ deklinieren, liegen an der Grenze zur Volksverdummung, das schafft nur Konfusion.
Der kluge Staat dagegen gaukelt den Leuten erst gar keine Sicherheit vor, nur das schafft Klarheit, weil alle gefasst sind. Der reine Wein ist es, den die Leute eingeschenkt haben wollen, auch wenn er sauer ist. Das macht ja lustig.
*
Um uns herum befinden sich Staaten allerdings in einer weniger kommoden Lage:
Island kurz vor dem Staatsbankrott
Eine Frage stellt sich da sofort: Ist das jetzt bloß Island oder das erste Land, das vom Bankrott erwischt wird? Weltwirtschaftlich belangloser Inselstaat mit warmen Geysiren und Zocken als Volkssport
(FR) oder Vorbote eines unheilvollen Trends, der noch andere in den Sog der Spekulation
reißt? Dafür, das zu entscheiden, hat die deutsche Presse ein festes Kriterium: Wer alles – außer den Bewohnern, die im Supermarkt vor leeren Regalen stehen – ist betroffen von der Staatspleite? Am Ende gar wir? An dem spannenden Gesichtspunkt hängt, ob man mehr oder weniger besorgt sein soll. Wer entwarnen will, bebildert den Beinahe-Bankrott mit außergewöhnlicher Kleinheit, Gier, Wetterlage etc., wonach keinen mehr wundert, dass die Krise dort zugeschlagen hat. Die Warner zeigen auf die Verstrickung
hiesiger Anleger, die kräftig auf lokale Anleihen spekulierten, und fürchten, das Desaster betreffe auch Deutschland. Wichtig zu wissen ist vor allem eines noch: Russland könnte Islands Staatsbankrott abwenden, weil es auf einen Sympathie-Bonus hofft
– und das gehört sich ja wohl nicht für einen Staat, der mit seinem unerträglich ‚neo-imperialistischen‘ Georgien-Krieg unsere Sympathien gründlich verscherzt hat.
Ganz wichtig in dieser Zeit des Untergangs ist die Erinnerung an einen Staatsbankrott, den wir nie vergessen dürfen, weil wir ihn über alles schätzen.
Nie wieder DDR!
ruft die FAZ in die Nation hinein, deren Jugend, wie man hört, mehrheitlich glatt vergessen hat, welches Unrechtswesen sich da auf deutschem Boden breit gemacht hatte: Rückschläge sind kein Grund, an der grundsätzlich segensreichen Wirkung der Marktwirtschaft zu zweifeln. Wer ernsthaft glaubt, die DDR sei die bessere Lebensform, der möge sich melden und dann nach Nordkorea auswandern.
Geh doch nach Pjöngjang!
*
Einstweilen wird in der besten aller möglichen Lebensformen weiter gerettet. Die Notenbanken zücken ihr schärfstes Schwert! Frankfurt und Washington stemmen sich mit einer konzertierten Leitzinssenkung gegen die Finanzmarktkrise. Aber der Dank der Anleger fällt sehr verhalten aus
– was schade ist, weil die segensreichen Märkte, da macht die FAZ uns nichts vor, zu mehr Risiko ermuntert werden sollen: „Nur wenn das Vertrauen wieder wächst, wird die Bereitschaft größer werden, neue Risiken einzugehen. Die für ein gedeihliches Wachstum unentbehrliche Kreditvergabe wird aber erst wieder in Gang kommen, wenn sich die Banken gesundgeschrumpft haben“. Und weil das – Banken dermaßen gesund zu pflegen, dass sie wieder Wachstum generieren! – eine Herkulesaufgabe ist, seufzt die Nation an jedem Schwarzen
Freitag oder Montag nach Führern, denen sie im Fach Krisenmanagement
gute Noten geben kann.
Ein Fall für Zwei!
„Merkel (CDU) & Steinbrück (SPD) zeigen, wie stark eine Große Koalition sein kann. SIE – zielstrebig, pragmatisch und Bundeskanzlerin: Angela Merkel (54, CDU). ER – nervenstark, selbstbewusst bis an die Grenze zur Arroganz und Finanzminister: Peer Steinbrück (61, SPD). Zusammen sind sie DAS Krisenteam der Nation.“ (BamS, 12.10.)
Endlich! Der Wunsch nach Führung, zu der an Schwäche und Zerrissenheit
der Herrschaft leidende Meinungsmacher das Publikum anstacheln, erfüllt sich im Bild nicht mehr aussitzender, sondern zielstrebiger Politiker. Die Sehnsucht nach Führern, an deren Mittelmäßigkeit
die Leute ebenso leiden sollten wie an Arbeitslosigkeit, Inflation oder Gammelfleisch, ist befriedigt mit der guten Figur
in der Krise. So fein kann Große Koalition sein! Alles, was die Chefs in der Sache durchsetzen und wie sie sich dabei präsentieren, ist Material des demokratischen Personenkults, der in der Finanzkrise extra boomt. Durchsetzungsfähigkeit und glaubwürdiges Auftreten der Macher, beim wählenden Volk wie auf internationaler Bühne: Die Krisenbewältigung ist bei den beiden in besten Händen! Und weil das so ist, setzt einer noch eins drauf und will im Namen aller Sparer auch noch schwer hoffen, dass dem auch wirklich so ist:
„Lieber Sparer, jeder gesparte Euro im Land ist sicher, garantiert die Kanzlerin. Das will ich schwer hoffen, auch für die Sparschweine unserer Kinder. Es ist die erste Bank des Kindes, man hortet späteres Glück. Es ist auch die Bank der Entsagung und des Verzichts. Beten und Sparen. Heute klingt das altmodisch, aber ich wuchs mit diesen Sprichwörtern auf: ‚Auf Sparen folgt Haben‘, ‚Aus kleinen Bächen werden große Flüsse‘, Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!‘. Wir leben nun alle in der Sünde des Verschwendens. Wir brauchen die Kultur des Sparschweins. Kinder, die auf Süßigkeiten verzichten, Kinder, die sich kein Playmobil kaufen. Das Prinzip Sparschwein rettet die Welt. Ihr F. J. Wagner“
Dieser Intellektuelle macht sich und anderen gar nichts darüber vor, dass Sparen etwas anderes wäre als die Tugend der Armut und die Technik des Einteilens beim Verzichten. In grenzdebilem Tonfall macht er sich seine Leser als die moralischen Kindsköpfe zurecht, als die er sie haben will, verklärt die praktische Not, die jeder kennt, zur sittlichen Kultur der Entsagung, verdammt den Sündenfall des Materialismus, verhimmelt das Sparschwein zum Inbegriff menschlicher Kultur – und leitet dann aus all dem den einen Anspruch ab, den ein Volk an seine Herrschaft noch richten mag: Sie möge es doch in seiner Tugendhaftigkeit belohnen und ihm weiterhin das Leben in seiner kindlich-gemütlichen Sparschweinkultur sicherstellen!
Gehört so moralisch gesehen gerade das ärmere Volk zu den Gewinnern der Finanzkrise
, so darf sich nach gut informierten Kreisen auch
Gott
zu denen zählen:
Gott soll die Finanzen richten
, berichtet N24 über den Run auf die Kirchen durch Banker und ruinierte Kleinanleger, die im Crash das Beten lernen.
„In der Nikolaikirche, mitten im Zentrum der Bankstadt Frankfurt, hat der Gemeindepfarrer einen Krug aufgestellt, der einlädt, ‚Fürbitten und Sorgen‘ in das Gefäß zu legen“.
Der Papst, Apotheker und Psychologen sind sehr gefragt. Das kriegt echt kein anderes System hin: Der moderne Kapitalismus produziert nicht nur Figuren, die sich in den guten Zeiten ihres Geschäfts als Masters of the Universe
vorkommen; für den GAU steht sein Heer berufsmäßiger Tröster auch gleich als moralisches Auffangbecken parat. Der Abschwung der Kurse bewirkt den Aufschwung innerer Werte: Von diesem Gesetz der kommunizierenden Röhren zwischen den Werten in der freien Marktwirtschaft leben ihre Sinnstifter, Persönlichkeitspfleger und andere Muntermacher; im Beichtstuhl und auf der Couch, mit Antidepressiva oder 3 Rosenkränzen sind große wie kleine Versager
der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft bestens bedient.
*
Internationale Krisengipfel stehen an, alle nationalen WIRs fiebern dem Ereignis entgegen – das ist schon eine eigene Meldung wert:
Die Erwartungen sind groß!
Die FAZ berichtet aus Berlin:
„Alle Blicke richten sich nun auf das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in Amerika an diesem Wochenende. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich am Sonntag zu einem Krisengipfel treffen, wie das ZDF unter Berufung auf einen Regierungssprecher in Berlin meldet“. (FAZ, 13.10)
Der Spiegel (NOT! HALT! Weltwirtschaft: Wer stoppt den freien Fall des freien Marktes?
) und die SZ stimmen uns ein auf bedeutende Weichenstellungen, weil es bei der Kernschmelze der Finanzsysteme nicht nur um ökonomische Korrekturen geht, sondern um harte Geopolitik, um die Verschiebung der politischen Gewichte auf der Welt
. Die darin enthaltene Kampfansage an die Staatenwelt irritiert den Schreiber solcher Zeilen nicht: Er begrüßt das Projekt ‚Krisenbewältigung als Aufmischen der Kräfteverhältnisse‘ und begutachtet, ob die Staaten – namentlich die Europäer und insbesondere Deutschland – dabei Fortschritte verzeichnen. Gelingt es, ihre Ambitionen auf ökonomische und strategische Weltgeltung in die diplomatische Waagschale zu werfen? Schaffen sie es, die Schäden der Krise möglichst anderswo zu platzieren? Gemessen an solchen Ansprüchen bezüglich Führungskunst und Tatkraft ihrer Herrschaften kehrt Zufriedenheit naturgemäß nie ein. Der Spiegel bleibt auch diese Woche gewohnt skeptisch und muss der globalen Performance deutscher Politik leider schlechte Noten geben: Das Krisenmanagement der Bundesregierung stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Es ist geprägt von Zögerlichkeit, Fehleinschätzungen und abrupten Meinungsänderungen. Seit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers wirken Kanzlerin und ihr Finanzminister eher wie Getriebene denn wie Gestalter.
Und das ist in Zeiten, in denen unsere Führer Kompetenzteam Geopolitik
heißen, schon nicht so erfreulich. Immerhin attestiert die SZ Merkel, Brown und Sarkozy erste Schritte in die richtige Richtung: Ein starkes und harmonisiertes Europa
ist Bedingung für die angesagte Feindschaft gegen das niedergehende Imperium der USA
.
Dennoch kehrt nach dem überfälligen Kursfeuerwerk
am 13.10. wieder Katzenjammer ein:
5. Die Rettung kommt nicht in Gang: Alte Schuldige und neue Opfer!
Die Finanzkrise erfasst ein Land nach dem anderen. Immer mehr Regierungen sehen sich genötigt, rettend einzugreifen – Ungarn, Österreich, Russland, China; selbst der Finanzplatz Schweiz verliert den bislang unerschütterlichen Ruf als ‚sicherer Hort des Geldes‘, wie nicht ohne Schadenfreude gemeldet wird. Bekanntlich ist diese ‚Steueroase‘ Steinbrück schon lange ein Ärgernis.
Auch die deutsche Regierung beschließt einen milliardenschweren Bankenrettungsplan. Endlich – so der allgemeine Tenor. Die Kanzlerin verkündet offiziell, dass dieser Plan alternativlos
sei, der Finanzminister stellt unter öffentlichem Beifall klar, dass erst einmal gelöscht werden muss
, später aber die Brandstifter zur Rechenschaft gezogen und der Brandschutz verbessert
werden sollen. So bringen die zuständigen Politiker die gewünschte Sichtweise über das vorliegende Desaster und über ihre eigene Rolle darin in Umlauf: Sie präsentieren sich als tatkräftige Krisenmanager, die ‚Rettung‘ ausgerechnet für den Finanzsektor versprechen, der den ‚Brand‘ ausgelöst hat, damit der nach Löschung des Brandes wieder dort weiter machen kann, wo er vorher aufgehört hat. So verpflichten sie die Nation auf die bedingungslose Anerkennung der dringlichen Bedürfnissen der Finanzwelt: Das dort zum Stillstand gekommene Geschäft muss um jeden Preis wieder in Gang gebracht werden, sein Scheitern ist bedrohlich für uns alle, weshalb Kanzlerin und Finanzminister dieser Drohung jetzt mit staatlichen Milliarden alternativlos und tapfer entgegentreten – und ihr Engagement für die Rettung der guten Spekulation dem Gerechtigkeitssinn des Volkes mit dem Versprechen versüßen, gnadenlos gegen die schlechten Spekulanten vorzugehen.
Die Öffentlichkeit nimmt die Sache so konstruktiv auf, wie man das in schwerer Stunde erwarten kann. Die wichtigen Blätter widmen sich also einmal mehr der Frage, wie es um das
Vertrauen in die Retter in der Not
steht. Die FAZ lässt an ihrem Urteil, ob Kanzlerin und Finanzminister beim Retten auch die ordentliche Figur machen, auf die es ankommt, keine Zweifel zu: Frau Merkel hat im entscheidenden Moment ... das Heft des Handelns an sich gerissen. Steinbrück ... hat sich als beherzter und kompetenter Brandmeister gezeigt.
(FAZ, 16.10.) Die SZ lobt das Wahlvolk dafür, dass es nicht zulässt, dass die Linken von der Finanzkrise profitieren.
Sie besteht darauf, dass das Vertrauen des Volkes in die Führung intakt bleibt. Und dass gemeinsam bedrohte Deutsche ihrer volkstümlichen Tradition treu bleiben und im Auge des Orkans ... nicht nach Parteien (rufen), sondern nach Rettung. Das ist die Stunde der großen Koalition
– wie die Bild-Zeitung ja schon die Woche vorher zu melden wusste. Neu ist, was die SZ von den Deutschen weiß, die keine Parteien, sondern nur noch Vertrauen in ihre Führer kennen: Sie sind die Helden der Finanzkrise
.
*
Noch ehe das Regierungsvorhaben parlamentarisch abgesegnet ist und die genauen Konditionen festgelegt sind, drängt sich den Beobachtern allerdings schon die Sorge auf, ob die Finanzwelt reagiert: Wird das Rettungspaket angenommen? Da kann sich die SZ zunächst nur wundern:
„Was ist denn mit den deutschen Banken los? Erst rufen ihre Spitzenkräfte in der Krise nach staatlicher Unterstützung und jetzt, da die Regierung allein Kapitalspritzen von 100 Milliarden Euro verteilen will, zieren sie sich.“ (SZ, 16.10.)
Wollen die sich etwa nicht retten lassen?! Und das, wo mit den Bankhäusern wir alle am ‚Abgrund‘ stehen und eine allgemeine ‚Katastrophe‘ abgewendet werden muss! Dann aber klärt die SZ ihre Leserschaft darüber auf, was hinter den Konkurrenzberechnungen der Banken steckt, denen man, gerade als Kenner der Verhältnisse, ein gewisses Verständnis nicht verweigern kann: Die Spieltheorie!
„Das Verhalten der Banken ist aus dem Blickwinkel der Spieltheorie durchaus rational. Spieltheoretisch befinden sich die Banken im sogenannten Nash-Gleichgewicht. Würde eine Bank vorpreschen und ihren Bedarf anmelden, würde wahrscheinlich der Aktienkurs einbrechen.“
Und das kann ja wohl keiner wollen! Also im Nash-Gleichgewicht bleiben, solange es geht!
*
Bloß: Irgendwann geht es eben nicht mehr – Nash hin, Gleichgewicht her. Das staatliche Rettungswerk muss ein Erfolg werden. Am nächsten Tag sagt es die SZ überdeutlich:
„Die Aktion von Merkel & Co. ist mehr oder weniger der letzte Schuss gegen das Monster. Dieser Schuss muss sitzen.“ (SZ, 17.10.)
Ob aber der ‚Schuss sitzt‘ und die ‚Aktion‘ das Krisenmonster stoppt, hängt von dem in Misskredit geratenen Stand der Finanzmanager, Aufsichtsräte und Großspekulanten ab, und das soll ja auch nach dem politischen Willen von Merkel & Co. so sein. Die müssen von den staatlichen Rettungsangeboten Gebrauch machen. Was heißt, dass diese vor dem prüfenden Blick ihres finanzkapitalistischen Geschäftsinteresses Bestand haben müssen, und da gibt es an der Qualität des staatlichen Eingreifens so manches auszusetzen. Die FAZ, die sich in die Sicht der gefragten Banker leicht einfühlen kann, hat, bezogen auf die staatlichen Beteiligungsangebote an gefährdeten Instituten, ernste Bedenken:
„Wie werden es die Aktionäre oder Anleihebesitzer goutieren, wenn der Staat bei einer Bank plötzlich direkt mitbestimmen darf? ‚Peer Steinbrück im eigenen Aufsichtsrat zu haben, das ist das Letzte, was die Spitzenmanager in den obersten Etagen anstreben‘, sagt ein erfahrener Branchenbeobachter.“ (FAZ, 17.10.)
Ziemlich unangemessen findet man in Frankfurt überdies die Höhe der Gebühr, die der Staat für seine Absicherung des Geldhandels zwischen den Banken verlangen will
, und auch die beschlossene Aufweichung der staatlichen Bilanzierungsvorschriften, die den Banken die Abschreibung von Verlusten ersparen soll, ist nicht unproblematisch:
„Das Problem, dass man den Bewertungen in den Bilanzen nicht traue, sei damit noch nicht aus der Welt geschafft, heißt es. Deshalb lehnen die Analysten auch die vorgesehene Lockerung der Bilanzierungsregeln ab.“
Das alles wirft die Frage auf, ob man sich als Bank nicht sogar schadet, wenn man sich unter den staatlichen Rettungsschirm begibt:
„Wenn Geschäftsbanken die Garantien der Regierung in Anspruch nehmen müssen, dann dürfte sich die Wettbewerbsposition dieser Banken wegen der staatlichen Auflagen signifikant verschlechtern.“
Eine Annahmeverpflichtung wie in den USA? Das geht schon gleich nicht:
„Eine solche Zwangssolidargemeinschaft käme in der deutschen Finanzwelt überhaupt nicht gut an.“
Den Widerspruch, dass der Staat mit seinen Angeboten das ruinierte Vertrauen in die Geschäftsfähigkeit der Konkurrenten wiederherstellen will, damit aber zugleich den schlechten Stand von deren Finanzgeschäften aufdeckt, also die politische Vertrauensstiftung unweigerlich zugleich das Misstrauen in die ökonomische Verfassung des jeweiligen Kandidaten bestätigt, kreidet die FAZ mithin ganz dem schlecht gemachten Rettungspaket an. Man wüsste zwar eine Lösung für das Dilemma – wenn genügend Banken sich vom Staat Eigenkapital besorgen, dann bleibt auch kein Makel bei einem einzelnen Institut hängen, lautet die Devise
–, aber ob sich genügend finden, damit dann bei ihnen allen derselbe Makel hängen bleibt und der derart verallgemeinerte Makel bei keiner einzelnen Bank mehr ins Gewicht fällt: Das zu entscheiden bleibt natürlich trotz der klugen Idee dem weiteren Gang der Dinge überlassen.
*
Sehr hoch gehängt wird die im Hilfspaket vorgesehene Deckelung der Managergehälter. Ein läppisches Detail, das zwar nichts zur Bankensanierung beiträgt, aber – von der Politik als moralischer Prüfstein eingeführt und propagiert – als Ausweis gilt, dass der Staat die Finanzchefs materiell in die Pflicht nimmt. Entsprechend hohe Wellen schlägt diese Rechtsbestimmung: An der 500 000 Euro-Grenze scheiden sich jetzt Gier und Verantwortungsbewusstsein bzw. Respekt vor der oder Angriff auf die Freiheit der Wirtschaft.
Soviel steht fest: Der deutsche Bürger hat ein Anrecht darauf, dass die Agenten des Finanzwesens ‚Verantwortung‘ für ihr Scheitern übernehmen, und darf von ihnen daher persönlichen Verzicht als demonstrativen Akt der Wiedergutmachung verlangen. Es findet sich auch ein Prominenter, der – zumindest nach dem Geschmack von Bild – mit gutem Beispiel vorangeht und öffentlich freiwillig auf seine Boni verzichtet:
„Es ist eine Nachricht, die Nachahmer verdient! Josef Ackermann, Vorstandschef der Deutschen Bank, verzichtet wegen der Finanzkrise auf Millionen! Tragen eigentlich die anderen Banken auch etwas zur Rettung ihrer Branche bei? Bild fragte gestern bei den Großbanken nach, was sie zum Rettungs-Plan beitragen. Ergebnis: Fehlanzeige! Die Steuerzahler sollen’s richten.“ (Bild, 17.10.)
So leicht ist dann doch, ein Lob zu bekommen. Auch wenn bekannt ist, dass der Bonus wegen des Misserfolgs der Bank geringer ausgefallen wäre als sonst. Ackermanns Verzicht wird immerhin als Beitrag zur Rettung der Branche gewürdigt, den andere nicht erbringen. Das ist zwar ökonomisch kompletter Unsinn, die moralische Wucht aber ist ungeheuer.
*
Damit der kleine Anleger vor lauter Finanzkrise seine Zukunftssicherung nicht vergisst, macht die FAZ ihn damit vertraut, dass er nicht immer nur fragen kann, wo sein Geld noch sicher ist. Für seine künftige Rente ist schon die richtige Mischung von Risiko und Sicherheitsbewusstsein entscheidend. Zwar sollte man nach Expertenmeinung
„nur Finanzprodukte kaufen, die man auch wirklich versteht und die zudem konkurssicher sind. Auf Dauer reichen die Renditen dieser Papiere und die Zinsen der klassischen Spareinlagen aber nicht aus, um zum Beispiel eine private Altersvorsorge aufzubauen.“
Die FAZ hat Nerven: Mitten in der Krise, in der massenhaft private Versorgungsrechnungen auffliegen, erteilt sie den guten Rat, dass ohne ein bisschen risikofreudige Spekulation nicht einmal die Rente sicher ist! Mit ihr aber – wie man gerade sieht – auch nicht. Ein Problem mehr für den kleinen Langfristanleger, der an der privaten Säule seiner Altersarmut baut. Aber die Ratgeber von der FAZ werden ihn sicher auch in Zukunft damit nicht alleine lassen.
Die politische Einstellung des Volks wird ständig mit beobachtet. Die FAZ ist in dieser Angelegenheit allerdings bedeutend weniger optimistisch als die SZ mit ihrem Lob des gegen linke Einflüsterungen gefeiten Bürgers:
„Sozialistische Schalmeienklänge treffen wieder auf offene Ohren, während die Erinnerung an den Ruin des realen Sozialismus in der DDR verblasst. Ein Grundprinzip der Marktwirtschaft gerät in der Finanzkrise in Verruf: der Wettbewerb.“
Gerade weil der gute Ruf der Marktwirtschaft wegen des geschäftlichen Einbruchs gelitten hat, ist es umso wichtiger, an ihrer prinzipiellen Einzigartigkeit nicht irre zu werden: Die Warnung vor den Ex-Stasi-Rattenfängern, die aus der Krise ein Anrecht auf Kritik und auf Wählerstimmen für ihre politischen Verbesserungsversprechen ableiten, ist da einfach nie verkehrt.
Auch Besinnliches und Nachdenkliches kommt nicht zu kurz: Im SZ-Feuilleton widmet sich ein Kulturvertreter der in der Spekulationswelt herrschenden falschen Einstellung der Akteure, bekanntlich der Grund aller Probleme. Er sieht da statt reiner ‚Gier‘ eher die sportliche Seite der Finanzwirtschaft
: Nicht Habgier, allenfalls eine Art Spielsucht
(noch eine Spieltheorie?) ist da am Werk. Ganz nebenbei liefert er eine höchst originelle Auflösung des heißen Rätsels,
„wo das viele Geld geblieben ist. Nicht bei den Banken. Geblieben ist das Geld bei den amerikanischen Häuslebauern. Wenn die heute sogar die laufenden Kosten für ihre neuen Häuser nicht mehr aufbringen könnten, könnte man die Finanzkrise als eine gewaltige soziale Umverteilungsmaßnahme von oben nach unten deuten.“
Wenn man also mal vergisst, dass die besagten ‚Häuslebauer‘ heillos verschuldet und ihre Häuser los sind, wenn also die Krise nicht einen gewaltigen Verarmungsschub für zahlungsunfähig gewordene Amis mit sich brächte, könnte
man sie glatt als gewaltig
bereichert deuten
und die ganze Finanzkrise als eine geradezu unverschämt soziale Angelegenheit.
Freilich kann man dem Phänomen Finanzkrise auch noch mit ganz anderen Deutungen beikommen: Dann erschließt sie sich etwa als Ausfluss einer Menschennatur, die mit so äußerlichen gesellschaftlichen Gegebenheiten wie Kapitalismus, Geld etc. nichts zu tun hat, vielmehr ureigentlich in der schlecht bewältigten Überwindung der Tiernatur des Menschen besteht. Jedenfalls dann, wenn man mit einem Psychiater statt auf die Börse, wo sich garantiert keine Erklärung in Sachen Finanzkrise findet, besonders tief in die menschliche Seele blickt, die in all ihren verschiedenen Äußerungen von Natur aus zu dem immergleichen irrationalen Verhalten neigt:
„Bei Geldanlagen kennt sich Borwin Bandelow nicht gut aus, dafür aber mit allen Arten von Ängsten. Wer mit Bandelow spricht“, wie die SZ, „der versteht, welchen Einfluss archaische Verhaltensweisen wie die Angst vor dem Verhungern bei der Finanzkrise spielen. Da werden Banker, die sonst völlig rational ihre Kurse rauf und runterschieben, plötzlich von Emotionen befallen. Man kann diese Verhaltensänderung auf den banalen Gedanken zurückführen, dass sie plötzlich Angst vor dem Verhungern haben.“
*
Von den aktuellen Sorgen um das Bankenrettungsprogramm muss man zwischendurch auch einmal Abstand gewinnen. Das Wochenende ist die Zeit, da man dem Leser Buntes, Tröstliches und Lehrreiches in Sachen Krise mitgeben kann. Die FAZ, noch ganz nah am Geschehen, strickt einfach mal zwei Spalten lang lustvoll weiter am Bild des Flächenbrandes:
„Noch lässt sich die Situation mit einem Großbrand vergleichen. Die Menge steht bangend vor der brennenden Stadt. Die Menschen atmen auf, denn die Feuerwehr ist angekommen und packt die Schläuche aus. Das sollte man nicht gering schätzen: Es hätte ja auch sein können, dass der Zugführer im Urlaub ist, dass die Telefone nicht funktionieren oder es an Wasser fehlt. Aber man sollte die Ankunft der Katastrophenkräfte auch nicht zu hoch bewerten. Denn bis jetzt sind nicht einmal die Hydranten gefunden, noch hat niemand gerufen: ‚Wasser marsch!‘“ (FAZ, 18.10.)
Wir haben, genau genommen, trotz der laufenden Katastrophe noch mal Glück gehabt. Merkel und Steinbrück waren nicht im Urlaub. Und an den Finanzen fehlt es offenbar auch nicht. Jetzt müssen sie nur noch den Geldhahn finden! Hätte doch wirklich noch schlimmer kommen können.
Der Blick, den die SZ in die Geschichte wirft, trägt zwar auch nichts zur Sache, aber vielleicht etwas zur Moral der Truppe mitten im unberechenbaren Geschehen bei:
„Bankenkräche hat es immer wieder gegeben. Und oft sind die Zeitgenossen überrascht, wie schnell die Krise dann doch zu Ende gegangen ist.“
Wenn das im Kapitalismus schon immer so war, blicken wir mal einen Augenblick lang einfach nicht in den Abgrund, sondern gelassener in die Zukunft und lassen uns überraschen. Abträglich für diese Moral könnte es allerdings sein, wenn sich die Repräsentanten des Reichtums im Lichte der Finanzkrise aufführen wie immer. Das bespricht die SZ anlässlich eines Blickes in die Welt der Reichen, auf der Millionärsmesse in München. Der Klatschreporter aus der VIP-Welt lässt sich regelrecht hinreißen:
„Im größten Wirtschaftschaos seit 1929 sind im Angebot: Lederbezogene Strandkörbe mit integriertem Ventilator und Wohnmobile mit Champagnervitrine oder ein elektrischer Schuhwärmer vom Aussehen einer erleuchteten Mülltonne. Man möchte die Blondine im Negligé-artigen Abendkleid gerne fragen, ob sie es nicht mal mit Wollsocken versuchen will und überhaupt, ob sie sich ausgerechnet momentan solche Dinge kaufen muss. Frau Effenberg busselt zwei russische Windhunde ab, sie finde die Tiere ‚voll süß‘. Die Finanzkrise findet sie wahrscheinlich ‚voll doof‘.“ (SZ, 18.10.)
Ja, wenn die nicht gerade Milliarden verspekuliert hätten! Aber so haben sie einfach kein Recht, ihren Reichtum so schamlos zur Schau zu stellen. Vorbildlich dagegen das Rollenspiel
von Reichen in den USA: Einen Tag lang muss Savannahs High Society in die Rollen arbeitsloser Väter, verarmter Kinder und alleinerziehender Mütter schlüpfen, ein Leben am Rande der Gesellschaft führen.
Nach dem kurzen Ausflug in die Welt der Armut dürfen sie sich wieder, natürlich geläutert und ihrer sozialen Verantwortung bewusst, ihrem Reichtum widmen. So mögen wir sie, unsere Reichen!
Der FAZ-Anleger darf eine trostreiche Expertenweisheit mit ins Wochenende nehmen:
„Es wird wieder aufwärts gehen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es ist noch immer aufwärtsgegangen.“
*
Aber: Aufwärts geht es eben nicht von alleine. Die Krise muss tatkräftig bewältigt werden von denen, die – auch dafür – an der Spitze der Nation stehen. Deswegen geraten bald wieder die politischen Heldenfiguren und ihr schwieriges Werk ins Blickfeld. Zum Auftakt der neuen Woche ist die Öffentlichkeit wieder einmal einen Tag lang mit ihren Politikern ziemlich zufrieden – es geht schließlich um die verantwortungsvolle Daueraufgabe der nationalen Vertrauensstiftung. Und da gehört auch die erfolgreiche Verbreitung von Zuversicht mit dazu. Bild meldet es dem einfachen Volk kurz und bündig:
„Die Politik hat eine riesige Bewährungsprobe mit Bravour bestanden. Denn nur die Politik konnte die Voraussetzungen für Stabilität und Vertrauen schaffen.“ (Bild, 20.10.)
Und die SZ stimmt wortreich zu: Hier hat die große Stunde der Politiker geschlagen – und, mehr denn je, die ihrer internationalen Konkurrenz:
„Nachdem Amerika die Finanz-Führungsrolle abgetreten hat, sucht Europa nach einem eigenen Helden. Jede Krise sucht ihren Helden, für jede Not findet sich ein Retter. Schwierig nur, wenn gleich mehrere den Job der Lichtgestalt für sich beanspruchen: Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, Angela Merkel – eine europäische Helden-Trias in Zeiten der Finanzkrise, die den Spitzenplatz noch unter sich ausmachen muss.“ (SZ, 20.10.)
Fest steht also, dass nicht nur eine Finanzkrise zu bewältigen ist und Politikern damit die Gelegenheit geboten wird, sich als ‚Retter‘ zu profilieren; hier gilt es, das verlangen Krise und drohende nationale Notlage, zugleich die Gelegenheit zu einer vorteilhaften Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen den Nationen zu nutzen. Von ‚unseren‘ Repräsentanten erwarten die aufmerksamen Beobachter der SZ nämlich, dass sie bei der Vergabe des ‚Spitzenplatzes‘ ein gewichtiges Wort mitreden. Sie fühlen sich so involviert in diese hochinteressante Frage, dass sie sich sogar einmal ein wenig einfühlsame Ironie leisten. Die Konkurrenz der europäischen Führungsnationen wird jedenfalls mit so viel teilnahmsvoller Solidarität verfolgt, dass den USA schon vorab der Verlust ihrer vormaligen Führungskompetenz wie ein selbstverständliches Faktum attestiert wird. Steinbrücks Spruch vom Ende der Wall Street ist also voll angekommen.
Die sorgenvolle Debatte über den Erfolg des Staatsprogramms hört natürlich auch am neuen Wochenanfang nicht auf. Den einen gibt zu denken, dass es in Krisen keine mathematischen Abläufe
(SZ) gibt, die anderen wissen auch nicht, ob die Notoperation
an der Wirtschaft etwas hilft. Eines aber wissen sie genau: Die Deutschen
, die es sich bisher immer so geradezu unverschämt gut gehen ließen, müssen sich auf das Ende der Gemütlichkeit
und härtere Zeiten
einstellen. (Spiegel) Kein Wunder, dass mancher Beobachter bei der Kanzlerin eine echte Blut-, Schweiß- und Tränen-Rede
vermisst hat, die die Deutschen in ihrem nicht mehr haltbaren Wohlleben gehörig aufscheucht.
*
Tags darauf gilt die öffentliche Aufregung wieder dem Thema: Ackermann und die fehlenden Solidarität der Banken.
Nachdem das ‚Rettungspaket‘ nun schon seit Tagen steht und in seinen Einzelheiten ausgiebig bekannt gemacht ist, kommt immer mehr Unruhe über die Frage auf, ob die Banker die nationale Pflicht erfüllen, die die Öffentlichkeit von ihnen erwartet, und die Staatshilfe ‚annehmen‘. An die Adresse des Steuerzahlers ergeht die Mitteilung, dass er sich über die 500 Milliarden keine Sorgen zu machen braucht; wenn alles gut geht, wird es unterm Strich weit billiger. Dafür ist es aber nötig und deswegen hat der Bürger jetzt ein Anrecht darauf, dass die Banker das Rettungspaket massenhaft in Anspruch nehmen. Bild redet den Bankern im Namen des Volkes von Bankkunden ins Gewissen:
„Kaum zu glauben, dass plötzlich viele Geldhäuser die staatlichen Hilfen angeblich nicht in Anspruch nehmen wollen. Auf dieses staatliche Hilfsangebot zu verzichten ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein Zeichen von Überheblichkeit und vielleicht sogar von Gier. Denn möglicherweise geht die Aktie einer Bank, die Staatshilfe will, deutlich ins Minus – und damit auch der Bonus des Vorstands. Doch darum geht es jetzt nicht, sondern um die vielen verunsicherten Kunden. Deshalb sollte jeder verantwortungsvolle Bankchef sorgfältig prüfen, ob die Milliardenhilfen und Garantien in Anspruch genommen werden können. Genau das wäre im Sinne der Kunden.“ (Bild, 21.10.)
Schon nett: Die Öffentlichkeit drängt die Banken, neulich noch der hemmungslosen Geldgier bezichtigt, im Verein mit der Politik dazu, gefälligst die vom Staat angebotenen Milliarden anzunehmen, und entdeckt die Gier nun darin, dass Banker mit dem Angebot ihre eigenen Berechnungen anstellen und es nach Möglichkeit vermeiden. Da ist schon wieder pure private Bereicherungssucht statt Verantwortung für das Bankgeschäft am Werk.
Der Chef der Deutschen Bank, Ackermann, gibt sich stark: Ich würde mich schämen, wenn wir in der Krise Staatsgeld annehmen würden,
und redet damit die Konkurrenten, die das Staatsangebot in Anspruch nehmen wollen und müssen, gründlich schlecht.
„Natürlich dürfe es nicht dazu kommen, dass hilfsbedürftige Banken aus falschem Prestigedenken die von der Regierung angebotene Hilfe nicht in Anspruch nehmen.“
Er tut alles dafür, die Krise als Gewinner zu überstehen. Und macht damit stellvertretend deutlich, dass die Adressaten des staatlichen Programms bei ihren Geschäftskalkulationen keineswegs auf dem Standpunkt einer nationalen Rettung stehen, den die Öffentlichkeit ihnen anträgt. Die aber lässt sich von ihrem Standpunkt nicht abbringen.
„Das sind völlig neue Töne. Hält das Gesetz des Stärkeren Einzug in die privat organisierten Banken?“,
entrüstet sich die SZ. Das sollen ‚neue Töne‘ sein? Offenbar hat der Verfasser des Artikels bisher die höfliche Heuchelei der diversen ‚Beraterbanken‘ mit der Konkurrenz im real existierenden Kreditgeschäft verwechselt. Dabei muss ihm entgangen sein, dass die Krise erst recht nicht das Ende der Bankenkonkurrenz ist, sondern den Kampf um Krisengewinne und die Verteilung des Schadens richtig in Schwung bringt. So klagt denn die SZ erbittert, dass der Vorstand der größten deutschen Geschäftsbank mit der ihm durch die Größe seines Finanzgeschäft zugewachsenen ökonomischen Macht so wenig ‚verantwortlich‘ umgeht:
„Wer sich schämen muss? Josef Ackermann gefährdet den Erfolg des Rettungsfonds ... Die Finanzkrise so mitverursacht zu haben, wäre ein Anlass, sich zu schämen – nicht eine Inanspruchnahme staatlicher Hilfe.“ (SZ, 21.10.)
Derselbe Mann, der uns und die Weltwirtschaft in verantwortlicher Position mit an den Rand des Abgrundes geführt hat, stößt uns mit seiner destruktiven Haltung jetzt möglicherweise noch ganz hinunter! Er sollte sich also schämen für sein Verhalten und damit für einen moralischen Neustart im deutschen Bankgewerbe sorgen! Dann stünde dem Erfolg des Rettungsfonds nichts mehr im Wege, außer natürlich die unberechenbare Bankenkrise ...
*
Zur Vertiefung des Gesamtthemas meldet sich aus dem Reich der Wissenschaft einer, der das Bild von der drohenden Katastrophe längst konsequent bis zum bitteren Menschheits-Ende vorangedacht hat:
„‚Die Menschen verlangen der Erde so viel ab, dass ihre Tragfähigkeit überschritten ist‘, lautet die Kernthese Meadows. Es gibt mehrere 100 000 Lebensformen auf der Erde. Alle haben gelernt, dass sie im Einklang mit der Natur leben müssen, wenn sie überleben wollen. Es gibt nur eine Ausnahme: der Mensch. Wird ein bestimmtes Niveau überschritten, kommt es zum Kollaps, alles bricht zusammen. Das gilt auch für das Finanzsystem. Schrumpfen ist nicht vorgesehen, das macht die Sache so instabil. Der Treiber ökonomischen Wachstums ist der persönliche Konsum. Es geht darum, den Leuten zu vermitteln, dass sie weniger konsumieren müssen. Dann benötigen wir weniger oder auch gar kein Wachstum und sparen Ressourcen und auch Geld. Diese Botschaft ist aber sehr unpopulär.“ (SZ, 21.10.)
Mitten in einer Welt des entfalteten kapitalistischen Reichtums, wo die Beherrschung der Natur und die Entfaltung der Produktivkräfte für den Zweck der Profitvermehrung ständig voranschreitet, wo auf der anderen Seite kein Konsumbedürfnis gilt, wenn es nicht zahlungsfähig ist, und immer größere Teile der ‚Menschheit‘ mit ihren Lebensnotwendigkeiten an ihrer beschränkten Kaufkraft scheitern, macht der Mann eine beschränkte Natur vorstellig, gegen die wir alle uns ständig vergehen. Im kapitalistischen Getriebe mit seinen Folgen entdeckt er ausgerechnet den ausufernden Konsum einer ‚Menschheit‘ am Werk, die sich damit an ehernen Naturschranken versündigt. Und diese verhängnisvolle Konsumgier soll dann auch für die exorbitanten Finanzgeschäfte verantwortlich sein. Wie der Konsum das hinkriegt, die schönsten Derivate platzen zu lassen? Egal. Jedenfalls ist alles zu viel – Konsum und Spekulation und sonst so einiges –, so dass die Natur das einfach nicht mehr aushält. Die Krise beweist es doch! So gehen wir also alle dem verdienten Untergang entgegen. Eine zwar nachhaltig blöde, aber durch und durch populäre kulturkritische Botschaft!
*
Doch die drängenden praktischen Fragen des täglichen Krisenmanagements stehen bald wieder auf der Tagesordnung: Wie sollen wir mit unseren Bankern umgehen? Welchen Beitrag zur Bankenrettung sollte man ihnen abverlangen?
Die Bild vom 22.10., dem Gerechtigkeitsempfinden ihrer Leserschaft gegenüber den Gemeinwohlschädlingen aus den Banktürmen genauso verpflichtet wie dem Gemeinwohl selber, ventiliert einen radikalen Vorschlag, wie der Staat die gebotene finanzielle Beteiligung der Finanzchefs sicherstellen könnte. Das Blatt schlägt ganz konstruktiv vor, einfach alle Gehaltsbestandteile
über 500 000 Euro vollständig einzuziehen
, damit könnte der Fiskus die Einkommenssteuerverluste vermeiden, die ihm bei einer einfachen Begrenzung von Vorstandsgehältern entstünde. Clever mitgedacht!
Die FAZ dagegen – nicht nur der Kapitalismus, auch der Pluralismus lebt! – bricht eine Lanze für Ackermann und Kollegen und sieht beim Manager-Schelten niedrigste Instinkte
am Werk. Wenn die deutsche Sozialstaats-Kundschaft auch so schamhaft wäre gegenüber staatlichen Geschenken wie Ackermann, dann wären die Sozialkassen saniert
. Das sitzt.
*
Da Regierungen aller möglichen Länder Konjunkturprogramme auf die Tagesordnung setzen, muss die SZ rechtzeitig warnen. Der Unterschied zwischen den Banken und dem Rest des nationalen Getriebes darf nämlich keinesfalls verwischt werden, wenn es ums richtige Geldverteilen geht:
„Seit die Regierung den Banken 500 Milliarden Euro versprochen hat, vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Politiker oder Lobbyist irgendein Programm vorschlägt, um darbenden Branchen oder Gesellschaftsgruppen zu helfen. Sollte der Staat ihnen mehr Geld geben, werden die Bürger es sparen. Aus Angst, die Krise könne noch schlimmer werden.“ (SZ, 22.10.)
Was im einen Fall ein Muss ist, geht es doch ums nationale Geldwachstum, sind im anderen Fall nur kostspielige und nutzlose Geschenke ausgerechnet an Bürger, die sich mit ihrer gesellschaftlichen Aufgabe, dem Arbeiten, Konsumieren und Sparen für dieses Wachstum, nie richtig einteilen – in der Krise schon gleich nicht. Vor ein paar Tagen drohten sie noch ihr Geld abzuheben, statt ordentlich weiterzusparen, ihre Gewerkschaften wollen mitten in der Krise mehr Lohn, und statt zu kaufen, sparen sie jetzt wieder tendenziell viel zu viel, um als Konjunkturmotor zu taugen. Also Hände weg von Geldgeschenken, mit denen sie in ihrer Krisenangst ohnehin nichts Rechtes anzufangen wissen!
*
Daneben berichtet das Blatt ungerührt über den aktuellen Armutsbericht der OECD:
„Armut wächst in Deutschland am schnellsten – in jedem fünften Haushalt hat niemand einen Job. Kinder sind am stärksten betroffen, Rentner gewinnen am meisten dazu. Die Wissenschaftler nennen mehrere Ursachen: Arbeitslosigkeit; die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich lässt die Armutsquoten steigen.“
Die Kluft zwischen Arm und Reich soll also für die steigende Armutsquote verantwortlich sein? Oder ist es die Quote, die die Kluft wachsen lässt? Da muss die OECD wohl noch weiterforschen. Nichts spricht jedenfalls dem Bericht zufolge dafür, dass die geltenden Prinzipien kapitalistischer Geldvermehrung und Lohnabhängigkeit, in der all die aufgeführten sozialen Verhältnisse eingeschlossen sind, mit der Armut etwas zu tun haben. Auch ein Ergebnis.
*
Außerdem lässt uns die SZ auch noch mit einem Philosophie-Professor alle miteinander in einen Abgrund
hinab- und dann zum Staat aufschauen, der uns mit ordentlichen globalen ‚Regeln‘ vor dem Absturz retten muss. Ein paar Seiten weiter allerdings erfahren wir, dass es gar nicht an globaler Kontrolle fehlt, sondern am Gegenteil: nämlich an persönlichen Beziehungen zwischen Schuldnern und Gläubigern im Bankensystem
, etwa in der Art eines in Chinas Armutshaushalten vormals üblichen Schuldbuchs, also an menschennahen und damit vertrauensschaffenden Lösungen. Wer ruft schon beim IWF an, um Missstände bei einer Bank in seinem Dorf zu melden
. Stimmt!
*
Dann allerdings, nachdem die Aktienmärkte am Vortag noch stabil waren, ist wieder Katastrophenstimmung angesagt: Angst und Unsicherheit in allen Ecken der Welt
, Aktienmärkte hochnervös
. Die Öffentlichkeit auch. Die Banker lassen nämlich bei der Annahme des ‚Rettungspakets‘ mehrheitlich immer noch auf sich warten. Also nimmt sich die SZ die Freiheit, mit ihrem ‚Thema des Tages‘ über Konsequenzen aus der Schuldfrage nachzudenken:
„Täglich neue Milliardenverluste. Kreditinstitute stehen vor der Pleite. Kleinanleger verlieren ihr Erspartes. Millionen Bürger müssen mit ihren Steuern Banken retten. Doch was ist mit den Verantwortlichen für das Desaster? Müssen jetzt auch all die Spitzenmanager der Kreditinstitute die Zeche zahlen für ihre gravierenden Versäumnisse und Fehleinschätzungen? Einer hat sogar schon gezahlt. Aber so richtig an den Kragen geht es kaum jemandem.“ (SZ, 23.10.)
Da breitet der Schreiber vor unseren Augen ein kunterbuntes Szenario von Krisenopfern aus: Alle zusammen ergeben sie das inzwischen sattsam bekannte nationale Desaster. Das ist der geeignete Vorlauf dafür, einmal mehr dem unbefriedigten Bedürfnis nach strafender Gerechtigkeit gegen die Schuldigen – die Manager! – Ausdruck zu verleihen. Diese Rufschädigung ist – moralisch betrachtet – einerseits sehr befriedigend, zieht aber andererseits doch – spätestens im Wirtschaftsteil – das Bedürfnis nach einer gewissen Rehabilitierung der Verfemten nach sich: Die von fachmännischer Seite geäußerten Zweifel, dass man mit einer festgelegten Gehaltssumme die besten Manager bekommt, die man braucht, um die Aufräumarbeiten zu machen
, überzeugen den in der Metaphorik des Brandlöschens gut eingelesenen Bürger davon, dass man das Schlechtreden unserer verdienten Wirtschaftselite auch nicht zu weit treiben soll.
*
Mittlerweile ist allen klar: Die Krise weitet sich aus! Was tun? Daimler und VW melden Absatz- und Gewinneinbrüche, kündigen Zwangsurlaub und Entlassungen von Leiharbeitern sowie Verzicht auf Sonder- und Wochenendschichten an:
Automobilindustrie in der Krise
Bild bietet gleich Orientierung: Was droht uns da als abhängigen Proleten?
„Folgen der weltweiten Finanzkrise immer dramatischer: Alles knallt runter! Bild fragte Experten: Warum stürzt jetzt alles ab? Euro. Aktien. Gold. Niedrige Kurse bedeuten, dass ausländische Großinvestoren unsere Top-Konzerne zum Schnäppchenpreis kaufen könnten. Was bedeutet das für Mitarbeiter und Jobs? Wie groß ist die Gefahr, dass deutsche Firmen geschluckt werden?“ (Bild, 24.10.)
Ja, da droht einiges, aber das Wichtigste von all dem ist, von wem das Übel ausgeht: ‚Alles knallt runter‘ – und die spannendste Frage daran ist, ob nicht das Ausland das zu seinem Vorteil nutzt! Und deutsche Arbeiter dann von Kapitalisten entlassen werden, die hier gar nichts verloren haben!
Die FAZ ist am selben Tag vor Ort:
„Daimler-Chef Dieter Zetsche versucht, seiner Mannschaft Mut zu machen. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft für die Mitarbeiter wie auch die Aktionäre des Stuttgarter Autoherstellers an diesem Tag: dass dem unter seinem markanten Walrossbart ewig freundlich wirkenden Daimler-Vorstandschef das Lachen offenbar noch nicht ganz vergangen ist. Zugleich mit den Finanzmärkten informiert er auch die Mitarbeiter – und fordert von ihnen, was er selbst am besten verkörpert: Kampfgeist und Durchhaltevermögen.“
Vorbildlich, wie endlich einmal ein Manager – es handelt sich hier eben nicht um einen zwielichtigen Finanzer, sondern um einen Betriebsführer von der ehrlichen Ausbeutungsfront – in schwerer Stunde allen Betroffenen zur Seite steht. Sowohl denen, die für die Behauptung des Unternehmens in der Krisenkonkurrenz mobil gemacht werden, wie denen, die vom Unternehmenserfolg zu profitieren gewohnt sind! Die entlassenen Leiharbeiter und die in Zwangsurlaub geschickte Stammbelegschaft dürfen ihm für den Appell an ihre Belegschaftstugenden danken. Sie werden sie noch brauchen.
*
Die SZ weiß dagegen, dass jetzt mehr gefragt ist, um das nationale Durchhaltevermögen zu stärken, denn: Die Rettungsaktion für die Banken hat gewirkt, aber nun droht eine weltweite Rezession.
(SZ, 24.10.) Nach der bewährten Logik, dass Krise und Not nach dem staatlichen Retter verlangen, der mit seiner Gewalt das kapitalistische Wachstum fördert und betreut, das die Krisen produziert, steht damit fest:
„Dies ist die Stunde des Staates, und es ist die Stunde von John Maynard Keynes. Alle erwarten, dass alles viel schlimmer kommt. Hier ist es Aufgabe der Regierungen zu sagen: Schluss mit der Panik, es wird nicht alles immer schlechter.“
Ein Konjunkturprogramm braucht es, meint die ‚Süddeutsche‘ im Gegensatz zu vorgestern heute, aber genau so wichtig ist die Ansprache an den Gemütszustand der Bevölkerung, die, ganz gleich wie ernst die Lage wirklich ist, jedenfalls eine positive Grundeinstellung braucht. Da muss man als verantwortliche Öffentlichkeit der Regierung einfach ab und zu ihre ‚Aufgaben‘ in Erinnerung bringen. Optimismus, Zutrauen in die Macher und unsere Zukunft ist gefragt. Das gilt es herbeizuregieren! Die Frage ist nur: Wie macht man das?
, wie schafft man Vertrauen? Klare Antwort: Indem man es tut: Worauf es ankommt, ist, Vertrauen zu schaffen, schnell und auf globaler Ebene.
*
Dagegen warnt wiederum Barbier von der Wirtschaftsredaktion der FAZ wie die SZ zwei Tage vorher vor grundfalschen populistischen Tendenzen in der aktuellen Parteipolitik. Unter dem beziehungsreichen Titel Ganz ohne Scham
liest er Politikern die Leviten, die seine ökonomischen Leitfiguren öffentlich derzeit so schlecht behandeln:
„Nun aber das Konjunkturprogramm. Ein guter und erfahrener Ökonom würde sich schämen, mit einem solchen Programm an die Öffentlichkeit zu treten. Ein Programm zur Besänftigung des Verteilungsneids kleiner Leute. Und es ist – wieder mal – der Verteilungsneid, den nicht die kleinen Leute artikulieren, sondern den die Politiker ihnen unterstellen, um Anlass zu haben, ihn mit Geld zu bedienen. Es ist nicht das Volk, das nach einem Konjunkturprogramm zum Ausgleich für das Rettungsprogramm ruft. Es sind die Hinterzimmerstrategen der Parteien, die sich nicht vorstellen können, das Finanzwesen eines Landes zu retten, ohne dem kleinen Mann die vorgezogene Anschaffung eines umweltfreundlichen Autos oder die Sanierung der Außenwände seines Hauses zu subventionieren. Aber schämen tun die sich nicht.“ (FAZ, 24.10.)
So kann man ein paar hundert Euro Steuerersparnis, die das Autogeschäft und die Bauwirtschaft beleben sollen, also auch sehen: Da werfen Politiker, die sich nicht zur nationalen Ausnahmestellung der Banken bekennen wollen, aus Kleinmut dem Volk Geld in den Rachen, statt sich auf dessen bessere Einsicht in die Notwendigkeit einer nationalen Bankenrettung zu verlassen, für die der FAZ-Mann schließlich wochenlang agitiert hat. Den Massen konzediert er ausnahmsweise einmal Einsicht in seine uralten Grundüberzeugungen, was sich fürs Volk, was für die Politik gehört und was der Finanzwelt zusteht, um den Politikern den Vorwurf zu machen, sie würden den ‚Verteilungsneid‘ überhaupt erst provozieren, nur damit sie populistisch tätig werden können. Die gerade mit einer 500-Milliarden-Garantie bedachten Banker – Opfer von Politikern, die mit ein paar Hundert Millionen Wirtschaftsförderung das Volk gegen seine Bankerelite aufhetzen! Offenbar hält der Mann den im Zuge der Finanzkrise verschlechterten Leumund seiner nationalen Lieblingsbürger im Kopf nicht mehr aus.
*
Am nächsten Tag wird konstruktiv umgedacht. Dieselben, die jeweils genau gewusst haben, dass die Krise auf ein paar missratene Kreditpapiere in Amerika, dann auf ein paar unfähige Finanzinstitute dort, dann auf die Finanzwelt beschränkt war, wissen es auch jetzt genau: alles naive Täuschung! Die Krise hat die „Realwirtschaft erreicht“
Die SZ kann nur den Kopf schütteln:
„Noch bis in das Frühjahr hatten die Anleger naiv daran geglaubt, die Probleme der Banken würden die Realwirtschaft kaum berühren.“ (SZ, 25.10.)
Und die FAZ verkündet es in großen Lettern:
„Die Finanzkrise erreicht die Realwirtschaft. Noch vor wenigen Wochen hielten es viele Volkswirte für wahrscheinlich, dass Westeuropa von einer Rezession in Amerika kaum betroffen wäre.“
Bis neulich haben Journalisten wie Volkswirte noch glauben machen wollen, Finanzkapital und ‚Realwirtschaft‘ könne man in der Krise vielleicht doch irgendwie auseinander dividieren und die Krise bei den Banken würde den Rest der Wirtschaft ‚unberührt‘ lassen – weil sie eben die Abteilungen der kapitalistischen Geschäftswelt wie zwei getrennte Welten begreifen: In der einen werden Güterberge produziert, und die andere erledigt die Versorgung dieser Abteilung sowie des Restes der Gesellschaft mit Geld und Kredit, damit alle eifrig produzieren und konsumieren können. Jetzt wissen sie es nachträglich natürlich von Anfang an besser, ohne auch nur irgendwie von der Auffassung abrücken zu müssen, Finanz- und ‚reale‘ Wirtschaft stünden zueinander im Verhältnis zweier funktionell für das Gelingen der Volkswirtschaft insgesamt wirkender Sphären:
„Es war immer klar, dass die Finanzkrise mit ihren Verheerungen für die Realwirtschaft nicht ohne Folgen bleibt.“
Für das, was ihnen schon „immer klar“ war, haben sie gar kein anderes ‚Argument‘ als die jetzt eben eingetretene Lage – aber warum sollten sich ausgerechnet Wirtschaftsjournalisten um ihr dummes Geschwätz von gestern kümmern?
*
Viel wichtiger ist jetzt, sich auf die aktuellen Probleme zu konzentrieren. Da drohen gerade die Börsianer jedes Augenmaß für rationales Spekulieren zu verlieren! Die FAZ klagt:
„Leider kommt das irrationale Element in diesen angespannten Oktobertagen weiterhin nicht zu kurz. Die Verunsicherung, die Angst vor immer neuen unangenehmen Überraschungen sitzt so tief, dass starke Kursschwankungen für die kommenden Monate ein treuer Wegbegleiter bleiben sollten.“ (FAZ, 25.10.)
Die SZ sieht noch schwärzer: Die Anleger scheinen geradezu von einer Rezessions-Sehnsucht gepackt. Die Deutschen neigen nun einmal besonders dazu, pessimistisch in die Zukunft zu blicken.“
Den bis neulich ‚naiv‘ optimistischen Anlegern wird jetzt vorgehalten, dass sie die Hoffnung der SZ-Auguren auf eine positive Spekulation, die sie als Beweis gelungener ‚Vertrauensstiftung‘ herbeisehnen, so arg enttäuschen. Das ist ‚irrational‘ und eine höchst gefährliche ‚Neigung‘ zum ‚Pessimismus‘. Könnten die nicht mal auf Optimismus setzen, wenn die Nation so sehnsüchtig darauf wartet?! Das wäre der gesunde Börsenrealismus und das rationale Element in diesen Oktobertagen, das wir jetzt bräuchten!
*
Aber es hilft ja nichts. Man muss den unausweichlichen Folgen ins Auge sehen:
„Ein Blick auf die Automobilbranche lässt jedoch erahnen, was dem Land noch blüht. Nach Absatzeinbrüchen und Gewinnwarnungen sind Tausende Zeitarbeiter bedroht. Morgen kann es schon um Stammbelegschaften gehen.“ (FAZ)
Und die SZ meldet sachkundig, warum als erste die Leiharbeiter gehen müssen: ‚Damit lasse sich die Beschäftigtenzahl ‚unkompliziert abbauen, wenn eine Produktionsspitze vorbei ist‘, sagte ein Sprecher.
Bild fasst sich wie immer kurz und bündig:
„Weltwirtschaftskrise trifft deutsche Unternehmen – Experten befürchten drastischen Anstieg der Arbeitslosenzahlen – In Deutschland geht wieder die Job-Angst um. Gibt es bald wieder fünf Millionen Arbeitslose? Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft: ‚So schlimm wird es selbst in diesen schwierigen Zeiten nicht mehr kommen.‘“
So prägnant kann man seine Informationspflicht für proletarische Leser erfüllen. Man teilt den abhängig Beschäftigten mit, was nach berufener Auskunft alles auf sie zukommt, nennt ihnen die Krise des kapitalistischen Geschäfts als unwidersprechlichen Grund und wiegelt zugleich ab. Und bekommt von den Gewerkschaften öffentlich recht: Die Metall-Gewerkschaft signalisiert, dass sie von einer Forderung nach Lohnerhöhung um 8 % Abstand nimmt, also anerkennt, dass in der Krise die Gewerkschaften der Arbeitsplätze wegen gegenüber ihren Mitgliedern in der Pflicht sind. Verdi bereitet ebenfalls die Beschäftigten darauf vor, was auf sie zukommt:
„Wir haben einen verhaltenen Optimismus, dass man die Beschäftigten halten kann oder dass es zumindest nicht zu Massenentlassungen kommt.“
Die Einstimmung ist also fertig: Das Kapital führt vor, wie mobil und einsatzfähig moderne Belegschaften sind, wenn es gilt, sich der Konkurrenz in der Krise zu stellen. Die atmende Fabrik beginnt kräftig auszuatmen, und zeigt, was an Potenzen für die Steigerung der Rentabilität in ihr steckt, die es braucht, um sich auf kontrahierten Märkten zu behaupten: Hire and fire auf deutsch. Und von der versammelten Öffentlichkeit werden die Opfer schon vorsorglich als unvermeidliche nationale Lasten der Krisenkatastrophe verbucht. Die ist über ‚die Wirtschaft‘ hereingebrochen, macht ihr das Arbeitgeben schwer, und allen anderen, vom reichsten Anleger bis zum letzten Proleten, so unendliche Schwierigkeiten. So ist das, wenn Deutschland Probleme hat.
*
Daher stellt sich mit neuer Dringlichkeit die alte Frage: Warum nehmen die Banken das Rettungspaket nicht an, obwohl sogar die Kanzlerin dazu aufruft? Die SZ weiß, woran das liegt: Nicht zuletzt sie hat mitzuverantworten, dass die Banker just dann, wenn sie als entschlossene Finanzakteure gebraucht werden, so kleinlaut und handlungsunfähig sind, also ist statt der ewigen Kritik an deren ‚Gier‘ auch einmal Selbstkritik der Öffentlichkeit geboten:
„Wem nützt es, wenn Banker jetzt in Sack und Asche gehen und aus Angst um ihr Image keine Hilfe anzunehmen wagen? Wenn die Banken aus Scham keine Hilfe annehmen und lieber die Kreditvergabe einschränken, könnte auch das den Abschwung verschärfen.“
Angst vor Größenwahn hat man in der Münchener Redaktion offenbar nicht. Man meint glatt, mit den Beschwerden über die Arroganz unfähiger Banker habe man den Stand um sein Selbstwertgefühl gebracht, legt sich die Frage vor, wem das nun nütze, und geht davon aus, dass die Banker die neue Milde der Zeitung unverzüglich mit entschlossenem Zugreifen auf die staatlichen Gelder beantworten werden. Und wenn die Waffenruhe an der moralischen Kampffront schon wirkt wie ein Konjunkturprogramm, sichert sie ja auch Arbeitsplätze, weswegen der Vorstand von ver.di nur beipflichten kann:
„Das Klima der Häme gegen Banken, die eine Inanspruchnahme der Hilfe erwägen, muss abgestellt werden.“
6. Die Krise als neue Normalität: Viel moralischer Einordnungsbedarf – und ein zukunftsweisender deutscher Blick in die Welt
Der Monat geht seinem Ende zu, und jeder kann die Krise jetzt auch sehen, an jener Branche
nämlich, die
, laut SZ, als das Herz der deutschen Wirtschaft gilt. Alle Bänder stehen still. Bei Mercedes in Sindelfingen. Bei BMW in Leipzig. Bei Opel in Bochum.
Das ist sichtbar
, im Unterschied zur bisherigen Krise, deren Folgen viele Menschen erahnen, die aber – weil sie sich bislang vor allem in den Türmen der Banken in Frankfurt, London und New York abgespielt hat – für den normalen Bürger bislang nicht sichtbar war. Doch die Menschen ahnen, dass die düsteren Nachrichten, die jeden Tag auf sie niederprasseln, auch sie irgendwann erreichen werden.
(SZ, 28.10.)Wenn die Krise da ist, gebietet die journalistische Sorgfaltspflicht zu berichten, dass sie da ist. Weil nämlich nicht zuletzt die sorgfältigen Journalisten bis neulich noch die Sichtweise ausgegeben hatten, dass es in den Türmen
wahrscheinlich nicht die Falschen trifft. Und weil sie auch in Sachen Autoindustrie vor nicht allzu langer Zeit noch anders gehofft hatten: Die Optimisten dachten noch im Sommer, die Krise träfe in erster Linie die amerikanischen Hersteller.
Europäische Schadenfreude heißt also neuerdings Optimismus. Aber wenn jetzt das Herz der deutschen Wirtschaft selber dran ist, ist es damit schon wieder vorbei.
*
Wo nichts dringlicher geboten ist als starke politische Führung, heißt es höllisch aufpassen, dass die Posten nicht schlecht besetzt sind und falsche Figuren die Lage unberechtigterweise ausnutzen. Die Krise hätte sich doch nun wirklich zu einem passenderen Zeitpunkt, z. B. unter deutscher EU-Präsidentschaft einstellen können; nun aber muss die deutsche Presse mit Säuernis zusehen, wie sich immer wieder dieser Franzmann in den Vordergrund spielt. Spiegel – großes Ego
– und FAZ bemühen sich darum, den aktuellen Europa-Vorstand auf die Größe zurückzuschrauben, die ihm aus deutscher Sicht zusteht. Seine Idee, den kommenden Ratsvorsitz der europaskeptischen Tschechen unschädlich zu machen, indem er sich daneben als Vorsitzender der Euro-Gruppe und eigentlicher Führer des Vereins Europa installiert, hat mit unserer Vorstellung von guter Führung nun aber auch überhaupt nichts gemein. Er hat sie ja auch nicht vorab mit der Bundesregierung besprochen, sondern lauthals in die Mikrofone der Weltpresse hinausgerufen.
Aber das kennen wir ja schon. Sarkozys Aktionismus läuft ins Leere, Sarkozys Welt ist nun einmal nicht das beharrliche Bohren dicker Bretter. Er muss die Welt jeden Tag mit mindestens einer neuen Idee versorgen.
(FAZ, 27.10.) Der Ärger, dass ausgerechnet Frankreich im Namen Europas das Wort führt, wurmt auch noch am nächsten Tag weiter in der FAZ herum:
„Unstrittig hat sich der französische Präsident einen Namen als Krisenmanager gemacht und einen europäischen Konsens über die Bewältigung der Krise zustande gebracht. Diesen Konsens hat er seither missbraucht. Was er an neuen Vorschlägen – stets auf eigene Rechnung – präsentierte, hat mit den Finanzmärkten wenig zu tun, sehr viel dagegen mit uralten französischen Vorstellungen. Er nutzt die Finanzkrise als Vorwand, um seine Forderungen nach mehr Staat allüberall zu rechtfertigen.“ (28.10.)
Bei den Chefs anderer Nationen lässt sich jedenfalls gut unterscheiden, wo ihre Leistung Europa gilt und wo sie bloß an sich oder an zu viel Staat denken. Solche unangenehmen politischen Krisengewinnler gibt es allerorten. Auch Berlusconi nutzt die Lage zum Machtgewinn
, hat die FAZ ermittelt, während sie im Wirtschaftsteil dem deutschen Finanzminister eine ganze Seite einräumt, auf der dieser anhand devoter Stichworte demonstrieren darf, wie er die Lage im Griff hat, wie schwer aber auch seine Aufgabe ist, was sich an ihrer Beinahe-Unmöglichkeit ermessen lässt: Steinbrück sucht das magische Dreieck der Wirtschaftspolitik.
(29.10.)
*
Wie kommt die Krisenbewältigung voran?
Beim Rettungsprogramm darf weiter mitgefiebert werden. Gespanntes Warten, ob sich Banken melden, aber keine Bange, die FAZ meldet:
„Steinbrück macht Druck. Berlin drängt Banken zur Annahme des Hilfspakets. Steinbrück: Unverantwortlich, wenn Schutzschirm nicht genutzt wird. Kritiker fürchten, dass Bankvorstände wegen drohender Gehaltskürzungen und einer Stigmatisierung der Institute auf die Inanspruchnahme verzichten.“ (27.10.)
Am Dienstag meldet sich die Postbank: Die Postbank schockiert die Branche.
(SZ, 28.10.) Auch sie hat Derivate und Lehman Brothers
in ihren Bilanzen zu verdauen. Das hätte die Süddeutsche von unserer braven Postbank nicht gedacht. Aber immerhin: Unternehmen will dennoch keine Staatshilfe in Anspruch nehmen.
Sehr anständig im Unterschied zu amerikanischen Banken und Versicherern, die die Gelegenheit zu dem völlig banken-untypischen Laster nutzen, sich zu bereichern. Die Rettung ist auch in Sachen Realwirtschaft schon unterwegs, wie SZ und FAZ am Mittwoch melden: EU will Autoindustrie mit Krisengipfel helfen
, Einigkeit über Kfz-Steuerreform. Steinbrück: Das hilft!
(FAZ, 29.10.) Das Programm ist nicht nur nützlich, sondern auch noch gut zur Umwelt: Wärmedämmen gegen den Abschwung. Mit Förderprogrammen für umweltfreundliche Häuser und Autos will die Regierung die Konjunktur beleben.
(SZ, 30.10.) Und gut zum Mittelstand: Steuerbonus auf Handwerkerarbeit verdoppelt. Die Weichen für das Konjunkturpaket sind gestellt.
(FAZ, 1.11.)Zwischendurch verteilt die Süddeutsche auch noch eine große Portion Lob fürs Volk. Es übt sich tapfer in der Tugend des Konsums:
„Deutsche trotz Finanzkrise in Kauflaune. Die Deutschen reagieren erstaunlich gelassen. Die meisten machen sich keine Sorgen um das Ersparte und vertrauen ihren angestammten Geldinstituten.“ (SZ, 29.10.)
Es bleibt ihnen zwar auch nicht viel anderes übrig, aber dennoch, alle Achtung! Stillhalten, das Geld, wie immer, in Banken und Kaufhäuser tragen, das ist die Gelassenheit, die den minderbemittelten Teilnehmern am Wirtschaftskreislauf gut zu Gesicht steht. Gleichzeitig wird besichtigt, wie die Realwirtschaft ihre Krise durch Kostensenkung angeht. Dass dadurch die gerade noch gelobte Fähigkeit zum Konsumieren irgendwie beschädigt werden könnte, gehört als Gesichtspunkt nicht hierher. Stattdessen wird durchgenommen, was es da alles für maßgeschneiderte Instrumente gibt, die der Rendite drohende Beschädigung auf andere abzuwälzen: Zustimmung für die Zwangspause. Längere Werksferien, Arbeitszeitkonten, Kurzarbeit
. (FAZ, 29.10.) Wenn das Kapital die Wirkung der Krise ganz selbstverständlich von seinen Beschäftigten ausbaden lässt, dann nur mit größter Behutsamkeit. Manchmal allerdings müssen sich die Berichterstatter schon sehr wundern:
„Jahrelang wurden Leiharbeiter händeringend gesucht – in der Krise verzichten die Firmen nun als Erste auf sie. Im Aufschwung galt die Zeitarbeit als gelungenes Beispiel der Arbeitsmarktreformen der rot-grünen Bundesregierung. Der Nachteil dieser höheren Flexibilität zeigt sich allerdings im Abschwung: Dann können die Unternehmen die Zeitarbeiter nämlich genauso rasch wieder zurückgeben.“ (SZ, 29.10.)
Wer hätte das gedacht. Genau dafür ist die Institution Leiharbeit zwar erfunden worden. Aber weil man bei der Süddeutschen die Sache genau umgekehrt sehen wollte und noch jetzt große Loblieder auf die Leiharbeit singt – sie hat vielen Menschen einen neuen Job gebracht. Zeitarbeitsfirmen verzeichneten Wachstumsraten von mehr als 20 % und verdienten glänzend. Die Zahl der Zeitarbeiter hat sich seit 04 mehr als verdoppelt. Und bis vor kurzem sah die Zukunft noch glänzend aus. Experten erwarteten einen Anstieg auf 4 bis 5 Millionen Leiharbeiter
–, darf man jetzt den Enttäuschten mimen und – interessanterweise – den Vorwurf nicht bei Erfindern und Anwendern der Leiharbeit, sondern bei der Gewerkschaft abliefern: Ungünstige Tarifverträge
hätte die vereinbart.
*
Das Hauptereignis der Woche ist aber ein Fall von Spekulation, der die Nation wegen des unvorhergesehenen Booms einer Aktie und des Dax aufscheucht: Porsche als Spekulant
– ist jetzt Porsche eine Heuschrecke? Eine ganze Woche lang spielt die Börse verrückt. Bild erklärt den Aktien-Irrsinn. Warum war VW gestern der wertvollste Konzern der Welt?
Die Kommentatoren wissen im ersten Anlauf nicht so recht, in welche Schublade sie das Ereignis jetzt einsortieren sollen:
„Mitten in der Finanzkrise scheint das Wunder noch unverständlicher, das Porsche vollbracht hat: ein kleiner Sportwagenbauer bringt den größten deutschen Autohersteller unter seine Kontrolle.“
Der Fall Porsche bringt die lieb gewonnenen Unterscheidungen durcheinander, alles, was sie zur Orientierung des Publikums so aufgebaut haben. Nix ist’s mit notleidender Autoindustrie, nix mit tüchtiger Realwirtschaft und verantwortungslosen Finanzgeiern, die die ersteren ins Unglück mit hineinreißen... Aber vielleicht blickt ja der Fachmann durch. Der erstaunt als erstes mit der Auskunft, dass ihm die Personalidentität einer ehrbaren Autofabrik mit einem Börsenhai durchaus geläufig ist: Kernstück sind sogenannte ‚cash gesettelte Optionen‘. Der Effekt ist einleuchtend
(28.10.), befindet die FAZ, denn Porsche hat entweder die Aktien für die VW-Übernahme oder verdient ein Schweinegeld mit dem Verkauf der Optionen. Wenn man schon länger zu würdigen weiß, dass jede Autofirma mindestens eine Finanzabteilung, meistens eine Bank ihr eigen nennt und die Gewinne aus solchen Finanzoperationen nicht nur die jeweiligen Strategien zur Eroberung der Märkte beflügeln, sondern zuweilen das ‚Basisgeschäft‘ in den Schatten stellen, kann man auch diesem Geniestreich die Bewunderung nicht versagen: ein brillanter Finanzalchemist
. (29.10.) Ein gelungener Fall von Gier ist eben für Fans dieser Wirtschaft kein Fall von Gier! Die Kollegen aus München wiederum finden es zwar erst einmal klasse, wie Porsche es den dubiosen Hedge Fonds mal gezeigt hat: Die Krise entzaubert auch Hedge Fonds, denn bei VW haben sich viele mit Wetten auf fallende Kurse eine blutige Nase geholt.
Bloß fällt ihnen dann auf, dass auch ein seriöses deutsches Institut unter den Geschädigten auftaucht: Doch selbst die Münchner Rück wird als möglicher Leerverkäufer von VW-Aktien genannt.
Und vor allem – was heißt das für VW?!
„Seit dem Einstieg von Porsche ist der Preis der VW-Aktie kein klares Indiz mehr für die echte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Trotzdem ist die Entwicklung von VW in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte.“ (29.10.)
Im Wirtschaftsressort der SZ möchte man doch nicht gleich auf die liebgewordene Gewohnheit verzichten, vom hohen Stand der Aktie auf die Klasse unseres Vorzeigeunternehmens zu schließen, bloß weil der jetzt das Produkt einer Finanzmachenschaft von Porsche ist. Wenn aber mit der VW-Aktie der ganze Dax eine Fieberkurve
einlegt, ist die Süddeutsche sauer und attestiert Wiedeking Fehler
:
„So mancher Beobachter amüsiert sich darüber. Denn inzwischen erkennt auch der Laie, dass hier die Jongleure des Finanzmarktes mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden. Aber dann beging Wiedeking den ersten Fehler. Er verspielte das Vertrauen der VW-Mitarbeiter. Nun steht das Vertrauen der Anleger auf dem Spiel. Es droht Fehler Nr. 2.“ (30.10.)
Zu bewerten hat man die Affäre also streng parteilich, und das heißt: je nachdem! Wenn böse Hedge-Fonds geschädigt werden, geschieht es denen recht; wenn die SZ dieselben aber als ehrbare Anleger identifiziert hat, muss sie sich über Porsche entrüsten. Und dass sich Porsche dann auch noch am Dax vergreift, geht endgültig zu weit: Die guten Anleger sind empört über die mysteriösen Vorgänge um die Aktie
, die zwar überhaupt nicht mysteriös, sondern in den Tagen schon mehrmals erklärt worden sind. Aber der Leitindex am Gängelband des Sportwagenherstellers
! Das ist des Guten zu viel, denn Wiedeking hat Geldanlagen im wichtigsten deutschen Aktienindex unkalkulierbar gemacht
, und das ist allerhand. Spekulanten mögen wir zwar überhaupt nicht leiden, aber unser Dax ist uns lieb und teuer und viel zu schade, um durch den Coup von Porsche in den Ruch eines unsicheren Datums fürs Spekulieren zu geraten. Nachher tragen die Herren Spekulanten ihr Geld noch woandershin statt in unseren Dax. Die schönste Frage zum Thema hat sich Bild in der Abteilung Lebenshilfe ausgedacht: Ist mein VW-Golf jetzt mehr wert als früher? Nein, die Kursexplosion macht VW-Autos nicht wertvoller.
(29.10.) Der Zaubertrick, Werte explodieren zu lassen, gelingt leider nur in der Hand von Fachkräften und nicht dem Laien.
*
In der Abteilung freiberufliches Strafgericht über Banken und Manager wird unermüdlich weitergearbeitet. Die SZ hat gleich zwei neue Vorschläge parat. Einen radikalen: Warum nicht an die Größe der Banken rangehen? Die ist doch das Problem, oder? Warum werden die Großbanken beispielsweise nicht zerschlagen?
; und eine vom Sportteil inspirierte Idee: Heuern und Feuern, wie es die Bundesliga bei ihren Trainern schon lange praktiziert
. Und dann noch mal draufrumtrampeln:
„Was Manager von Erwin Huber lernen können. Diese Manager haben zwar austeilen können. Jetzt in schwarzen Zeiten verfallen sie in Weinerlichkeit.“ (27.10.)
Andererseits hat sich zu Wochenbeginn ein verbitterter Liebhaber des Systems mit einer Kritik an der Schuldfrage zu Wort gemeldet. Professor Sinn, dessen ganzes Institut der Erforschung der Stimmungslage jenes kostbaren Berufsstands gewidmet ist, von dessen Erfolgen als Wirtschaftsführer wir doch schließlich alle leben, kann nicht länger an sich halten, wenn die Wirtschaftselite am Pranger steht. Schließlich wird das Fundament seines Weltbilds, die Triebkraft des Fortschritts, der homo oeconomicus mit seinem Nutzenstreben, vulgo: die Manager durch den Schmutz gezogen. Also greift er zur schärfsten Waffe in der deutschen Öffentlichkeit, der Erinnerung an 29 und all das Schlimme, was daraus gefolgt sein soll, und beklagt ein öffentliches Managerpogrom:
„In jeder Krise wird nach Schuldigen gesucht, nach Sündenböcken. Auch in der Weltwirtschaftskrise von 1929 wollte niemand an einen anonymen Systemfehler glauben. Damals hat es in Deutschland die Juden getroffen, heute die Manager“. (SZ, 27.10.)
Er bekommt, was er gewollt hat, ganz viel Öffentlichkeit, aber anders als er die sich gewünscht hat, nämlich einen Sturm der Entrüstung. Merke: Im Zusammenhang mit Juden ist jeder Vergleich mit den Tätern erlaubt, sofern das Abstandsgebot in Sachen Singularität gewahrt bleibt, mit den Opfern jedoch in keinem Fall, gleichfalls wegen ihrer Singularität. Auf das übliche fassungslose Entsetzen angesichts von unerlaubten Vergleichen, vom Zentralrat der Juden bis zum Sprecher der Bundeskanzlerin, folgt die Entschuldigung. Sinn
„wollte ‚das Schicksal der Juden nach 33 in keiner Weise mit der heutigen Situation der Manager vergleichen‘. Ihm sei es allein darum gegangen, dass die wirklichen Ursachen Systemfehler seien, die aufgedeckt und beseitigt werden müssten. Die Suche nach vermeintlichen Schuldigen führe stets in die Irre.“ (FAZ, 28.10.)
Wegen der Aufregung über verletzte Anstandsregeln des Vergleichens wird ganz übersehen, wie originell Sinn mit dem Argument System hantiert: Um die Manager zu entschuldigen, führt er einen „anonymen Systemfehler“ ins Feld und bringt damit immerhin das System in eine gefährliche Nähe zum Vorwurf der schuldhaften Verursachung einer Weltwirtschaftskrise. Das macht aber nichts, denn die andere Seite, auch nicht faul, stürzt sich lieber auf die kenntliche Absicht der Entschuldigung; anhaltende Proteste kommen von Bischöfin Käßmann, die ihre Domäne der Moralkritik an gierigen Bankern verteidigt. Gegenwehr kommt auch aus den Feuilletons, in denen der hohe Nutzen der Schuldfrage verteidigt wird. Eine Stimme aus dem Wirtschaftsteil der FAZ kommt dem unglücklichen Vergleicher zu Hilfe und gibt am Dienstag mit der Dialektik von Einzelnem und System erstmal beiden Seiten recht: Es ist wahr, dass die Verurteilung Einzelner zu kurz greift. Das ändert aber nichts daran, dass es immer wieder Einzelne und ihr Handeln sind, die zum Versagen des Systems führen
. Von diesen Einzelnen würde sich der Kommentator mehr selbstkritische Beschäftigung
wünschen; er empfiehlt die bewährte Technik, sich selbst zwecks Entschuldigung zu beschuldigen:
Manager wie Unternehmer müssen darauf endlich reagieren, um nicht noch stärker in eine Defensive zu geraten, die intelligente Menschen wie Sinn zu hilflosen Vergleichen greifen lässt.
(28.10.)
Dann hätten es ihre Apologeten auch nicht so schwer. Im Feuilleton geht das gepflegte Leiden am unseligen Juden-Vergleich dann erst so richtig los: Der historische Vergleich führt in die Irre und erzeugt erst die Folgen, vor denen er warnt.
Wie das? Soll man sich fürchten, dass Professor Sinn womöglich wieder einen Faschismus herbeiredet? Irgendwie schon, denn der Chef des FAZ-Feuilletons wartet mit einer äußerst erlesenen Sorge auf. Um die zu lancieren, verwechselt er Vergleiche mit Metaphern, um dann davor zu warnen,
„dass wir uns immer in einem symbolischen System absoluter Metaphern bewegen ... 1929 ... Wir reden vom Brutofen der Jahrhundertkatastrophe ... Die Frage ist, inwieweit diese Analogie ... erst die Realität schafft, von der sie redet.“
Er hat vielleicht zu viel Harry Potter gelesen, kann sich aber auch auf Autoritäten berufen: Kahnemann (ein Wirtschafts-Nobelpreisträger) hat experimentell gezeigt, dass sich ökonomische und soziale Urteilsfindung in Wahrheit in einem Raum der Poesie abspielen.
Und da ist der Herr des Feuilletons schließlich in seinem Metier, die Verlängerung in erkenntnistheoretischen Unfug geht ihm locker von der Hand:
„Koppeln sich hochtraumatisierte Begriffe (selbst das Wort ‚krank‘) mit der Sphäre des Geldes, verändern sich erst die assoziativen Strukturen und schließlich die Moral der Handlungen.“
Kranke Begriffe sind hochgefährlich:
„Verbindet sich die Sphäre des Geldes mit der Sphäre der Traumatisierung und ihrer Metaphern – und was wäre traumatischer als ’1929‘ – schaffen Metaphern völlig neue Reaktionsmuster. Es entstehen immer mehr Gründe die Metapher mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Die Politik wäre gut beraten, den Menschen zu sagen, dass sie nicht in der Lage von 1929 sind.“ (28.10.)
Das Ganze ist dann doch nur – unter gebührender Herausstellung des immensen Tiefgangs, mit dem der Verfasser zu Werke geht – eine reichlich umständliche Warnung vor zu viel Kapitalismuskritik: Wenn immerzu schlecht übers Geld geredet wird, kann das zu Faschismus führen. Am Donnerstag meldet sich im Feuilleton der SZ ein Professor für deutsche Literatur zu Wort. Er hat was von Fiktionen läuten hören; da ist seine Fachwissenschaft gefragt:
„Die jähen Ausschläge an der Börse erinnern unsanft daran, welche Rolle Fiktionen für das alltägliche Funktionieren moderner Gesellschaften spielen. Sie sind nicht bloß in Filmen, Schauspielen und Romanen, in den Rückzugsgebieten der Unterhaltungsindustrie oder Ästhetik zu Hause, sondern wohnen im Herzen der Volkswirtschaften.“
Nach längeren Erwägungen über Vor- und Nachteile von Fiktionen für Gesellschaften
, und der kühnen Vermutung, dass das moderne Wirtschaften nicht länger gut gehen konnte, wird man auf einen ganz neuen intellektuellen Bedarf aufmerksam gemacht, an dem wohl auch die Krise schuld ist:
„Auf welche alternativen Fiktionen kann eine Gesellschaft zugreifen, die sich nicht wie bisher als Zugewinngemeinschaft versteht? Und auf welchem kulturellen Nährboden gedeiht sie?“ (30.10.)
An welche utopischen Entwürfe oder auch nur Märchen über den Sinn der Bescheidenheit und die Reize der Armut der Herr Professor denkt, verrät er nicht. Jedenfalls hat er seinen originellen Beitrag geliefert zum Streit um die zur Krise passende Fassung des Menschenbilds, der im Feuilleton seinen Aufschwung nimmt. Eine solche Gelegenheit wie diese Mordskrise haben die Sinnhuber aller Fakultäten lange nicht geboten bekommen. Voller Eifer sind sie damit unterwegs, an einem Paradigmenwechsel zu stricken, Fragen zu wagen, ob man nicht im homo oeconomicus außer Nutzenstreben noch ganz andere Kräfte vermuten muss, also neue Karrieren mit der Ausformulierung des passenden Zeitgeists zu bestreiten.
*
Die Deutsche Bahn ruft zu Wochenbeginn ein Drittel ihrer ICE-Züge zur Überprüfung in die Werkstätten
. Es wird zwar erwähnt, dass die Bahn Meldungen über möglicherweise fehlerhafte Achsen wg. des guten Eindrucks, den sie an der Börse machen wollte, im Sommer noch bestritten hat; für weitaus bedenklicher aber werden die immer schlechteren Aussichten für den Börsengang der Bahn befunden. Womit man dann auch wieder beim Kern des ganzen Übels angekommen wäre: Um unverdiente Bonuszahlungen für schlechtes Finanzmanagement soll es bei der Deutschen Bahn gegangen sein!
„Wenn es aber stimmt, dass der Vorstand um Hartmut Mehdorn schon dafür entlohnt werden soll, dass der Börsengang gerade mal 3,5 Milliarden Euro abwirft, dann ist der Bonus kein Bonus mehr. Dann wird er zu Mehdorns Malus. So handelt keiner, der sich seiner Verantwortung für das Eigentum der Republik und ihrer Bürger bewusst ist. Bleibt es bei einer Belohnung fürs Verramschen, dann ist Mehdorn nicht der Richtige für den Verkauf der Bahnanteile.“ (SZ, 27.10.)
Vor lauter Ingrimm erklärt der Autor der Süddeutschen die Bahn nachgerade zu Volkseigentum, während der Spiegel für die Ausdehnung der Managerkritik auf misslungene Börsengeher plädiert. Es kann doch nicht sein, dass wir bei Bankmanagern hart durchgreifen, aber die Chefs unserer eigenen Unternehmen dafür belohnen, wenn sie Bundesvermögen verschleudern.
Nach eingehender Befassung mit der Frage, wer wann was gewusst haben kann, hält man es sich noch offen, ob die Affäre insgesamt mehr an Mehdorn oder Tiefensee hängen bleibt. Das sind schließlich die Themen, die die Demokratie so lebendig machen. Gleichzeitig steht natürlich Ackermann weiterhin unter scharfer Beobachtung. Zum Wochenende aber meldet sich Barbier, der in der FAZ als fleischgewordene Altersweisheit eine eigene Kolumne Zur Ordnung
bewohnt, mit einer menschheitsgeschichtlichen Rettung des in Verruf geratenen Kredits:
„Eine andere Frage ist, ob Sparen und Investieren als bürgerliche Attitüde der Lebens- und Erwerbsplanung durch eine solche Vertrauenskrise nachhaltig in Misskredit geraten können.“
Was natürlich gar keine Frage ist, wenn man sich nur einmal daran erinnert, dass
„schon in der vorindustriellen Zeit der Rhythmus des Säens, des Erntens und Verbrauchens keinen Zweifel daran aufkommen ließ, dass vor dem Investieren das Sparen zu stehen habe. Heute sparen, um für morgen zu investieren: Die dämmernde, auf Erprobung drängende Idee, dass man im Wald gefundene Nüsse nicht nur verzehren, sondern alternativ auch als Saatgut für das Heranziehen von Nussbäumen verwenden kann, darf als bewegendes Detail aus der Frühgeschichte der kulturellen Evolution des Menschen begriffen werden. Die Kultur erstickt nicht an einer Finanzierungskrise.“ (31.10.)
Und so dürfen wir getrost darauf hoffen, dass Herr Wiedeking seine cash-gesettelten calls und puts nicht mehr aufisst, sondern im Rhythmus des Säens und Erntens von Porsches auf bewegende Weise die kulturelle Evolution im Dax vorantreibt.Gäbe es bloß nicht soviel Unvernunft in der Jetztzeit.
„Die Weltwirtschaft kommt in eine Rezession, die so lang und tief sein wird wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber die hessischen Möchtegern-Regierungswechsler juckt das nicht. Was sie zum Ausbau des Frankfurter Flughafens beschlossen haben, wird Land und Leute teuer zu stehen kommen.“ (1.11.)
Schon 3 Tage später ist dann der Jubel in der FAZ-Redaktion riesig. Ob die Weltwirtschaft dankend zur Kenntnis genommen hat, dass der Anschlag von Frau Ypsilanti auf sie gerade noch einmal abgeschmettert wurde, ist noch nicht bekannt.
*
Inzwischen ist die Krise überall, genauso global wie das Wunder von Weltmarkt, das man in den letzten Dekaden anstaunen sollte. Und die sachkundige Presse weiß sofort, was da zur Klärung ansteht.
Von der Abschätzung von Schäden zur Berechnung imperialistischer Krisengewinne
wird der Fragebogen gespannt: Wo überall müssen wir
damit rechnen, dass unsere Geschäftsfelder wegbrechen
? Welche Schäden stehen uns in Haus wegen den Versagern anderswo? Was hat man von fremden Regierungen alles an Gewaltakten gegen die dortigen Völker im Namen unserer Krisenbewältigung zu verlangen? Das ist ja wohl selbstverständlich, dass beim Blick in die Welt das Wohl und Wehe der eigenen Nation den geistigen Maßstab abgibt; denn ohne deutsches Wachstum und deutsche Weltpolitik steht ja wohl auch der Rest der Welt ziemlich blöd da.Was müssen wir da aber hören aus Ländern wie Indien und China, die „Deutschlands Unternehmen“ schon fest verplant hatten?
„Indien – Land der großen Erwartungen ... Deutschlands Unternehmen sollen vom Wachstumsmarkt Indien profitieren, und die deutsche Regierung möchte den neuen ‚global player‘, wie sie sagt, stabilisieren. Das alles geht indes nur, wenn die Wachstumsraten der vergangenen Jahre sich fortsetzen.“
Wenn schon hier Krise ist, können die uns doch nicht auch noch ihr Wachstum vorenthalten! Stattdessen vermehren sie aber die ohnehin notorische Armut
und das gefährdet nicht die Armen, sondern ein höheres Gut:
„Kein Mensch wisse, wie lange das Land deshalb noch stabil bleibe.“ (SZ, 27.10.)
Die FAZ – Asien im Abwärtssog
– teilt die Sorge um die politische Stabilität unserer Wachstumsmärkte, sieht aber auch eine gute Gelegenheit, der chinesischen Führung wieder einmal Versäumnisse in Sachen Demokratie vorzuhalten. Denn ihr Modell hat kein Ventil
. Dort ist wachsender Wohlstand
„Kernstück eines sozialen Paktes mit der Regierung. Letztere sorgt für Stabilität und eine Verbesserung der Lebensverhältnisse, dafür begehren die im relativen Wohlstand Geborenen nicht auf. Wird dieser Pakt einseitig aufgelöst, vermag niemand die Folgen vorherzusagen. Abschwung und Aufruhr sind hässliche Brüder. In Indien wird sich dies auf dem Wahlzettel niederschlagen. In China gibt es keine Wahlen als Ventil.“ (27.10.)
Das florierende chinesische Kapitalwachstum mit seiner nicht minder florierenden Verelendung: ein Wohlstandswachstum für alle Chinesen – der Mann ist nicht zimperlich, wenn er den chinesischen Massen lauter gute Gründe für Zufriedenheit mit ihrer bisherigen sozialen Lage attestiert! Und ein Kompliment für die Demokratie als beste Herrschaftstechnik, unzufriedene Massen still zu halten – alle Achtung, was Demokraten sich so trauen, zu Papier zu bringen! Am nächsten Tag wird Brasilien durchgenommen, ein Fall, bei dem der Spekulation ernsthafte Vorwürfe gemacht werden: Beispiellose Kursverluste auf Brasiliens Aktienmarkt.
Schuld sind
„Liquidationen der kaum regulierten Hedge Fonds. Die Hausse des Real hat Hedge Fonds zu sogenannten Carry Trades bewogen, in deren Rahmen sie sich nach dem Verkauf von japanischen Yen und auch amerikanischen Dollar im Real engagierten. Die Auflösung von Restpositionen aus diesen Carry Trades gilt als einer der Gründe für die Schwäche der Aktienkurse und des Real.“
Das Geschäft mit unterschiedlichen Zinsraten in verschiedenen Nationen ist zwar genau der Grund, aus dem die Spekulanten den Real erst steigen und dann fallen lassen. Das hält der Wirtschaftsbetrachter hier aber für sehr ungerecht, zumindest für ungeschickt. Er würdigt eingehend
„das Exportpotenzial des Landes, eine konkurrenzlos breite Palette von Rohstoffen, von denen sich besonders Agrargüter wie Sojabohnen, Fleisch, Kaffee, Kakao und Orangensaft aller Erfahrung nach auch in konjunkturell schwierigen Zeiten recht robuster internationaler Nachfrage erfreuen“.
Nach seiner Auffassung
„gelten für Brasilien die makroökonomischen und monetären Chancen als vergleichsweise gut. Dass die Börse in Sao Paulo diese Einschätzung allem Anschein nach ignoriert, wird mit der globalen Panik an den Aktienmärkten begründet“ (FAZ, 28.10.) –
einfach blöd, dass die Spekulanten der internationalen Finanzwelt die „Daten“ ignorieren, die der Fachmann einer senkrechten Spekulation ihnen zur Berücksichtigung ans Herz legt. Die Süddeutsche kümmert sich um die neuen EU-Mitglieder im Osten. Wir waren doch so gut zu denen und haben ihnen ihr Wachstum praktisch geschenkt: Westliche Investoren finanzierten die hohen Wachstumsraten
. Nicht etwa, dass diese Investoren an den Ländern gut verdient hätten. Und jetzt, wo die Investoren befinden, dass ihr Geld und Kredit im Osten nicht mehr so gut aufgehoben sind, was müssen wir da entdecken?
„Ein ganzes Volk hat auf Kredit gelebt. Estland und Lettland, lange Zeit Vorbilder für den Umbau in Marktwirtschaften, aber eben auch abhängig von ausländischem Geld.“
Man mag gar nicht fragen, wer denn eigentlich diese windigen Staatsprojekte bis neulich noch zu Vorbildern erklärt hat; wer bis gerade neulich noch das Herrichten zur Anlagesphäre für Euro-Kapitale, die Attraktion von ausländischem Geld zu dem nationalen Erfolgsweg erklärt hat. Spätestens jetzt ist klar, wie ungesund das dortige Wachstum war. Große Enttäuschung über diese verantwortungslosen Brüder macht sich breit, irgendwie haben sie uns ja all die Jahre hinters Licht geführt: Erst galt die Entwicklung Mittelosteuropas als Erfolgsgeschichte, nun erweist sich, dass sie auf Sand gebaut war – ein Leben auf Pump mit Hilfe fauler Kredite.
Aber: das eigentliche Problem liegt noch woanders, Cathrin Kalweit weiß, wo genau:
„In Osteuropa geraten etliche Volkswirtschaften ins Taumeln, was die Demokratie gefährden könnte. Die Wähler in vielen jungen Demokratien sind ohnehin desillusioniert. Wenn nun die nötigen Einschnitte und eine radikale Sparpolitik erzwungen würden, könnte das einen Zuwachs ganz anderer Art befördern: einen Zuwachs an Populisten und Anti-Europäern.“ (SZ, 29.10.)
Blöd, dass wir den Völkern dort auch noch die Demokratie geschenkt und das Missverständnis haben durchgehen lassen, dass die Bekehrung zum rechten System sich für sie irgendwie auch materiell auszahlen müsste. Jetzt müssen wir uns auch noch Sorgen machen, dass sie von der Demokratie einen Gebrauch machen, der uns überhaupt nicht passt. Aber auch alte EU-Partner sind ordentlich in der Krise, und das geschieht ihnen nach Auffassung der SZ ganz recht:
„Euro-Feinde im Abseits. Währungsunion stärkt die Mitgliedsstaaten in der Finanzkrise. Vor 8 Jahren feierten die Dänen die Ablehnung des Euro. Island ist schon untergegangen.“ (28.10.)
Warum haben sie sich auch dem Dienst an unserem Europa und der Stärkung unserer Währung entzogen. Im Fall Russland wiederum ließe sich zwar, analog zu Brasilien, auch eine letztlich robuste internationale Nachfrage für dessen Rohstoff diagnostizieren, aber der Eigentümer fällt nun mal bei uns immer wieder unangenehm auf, so dass man dem Preisverfall beim Öl einiges abgewinnen kann:
„Der Anstieg des Ölpreises hatte das ressourcenreiche Russland einst gemästet, nun trifft es der schnelle Fall besonders hart.“
Außerdem macht die Regierung schon wieder alles verkehrt: Mit Zusagen und Krediten in Milliardenhöhe füttert die staatliche Entwicklungsbank die angeschlagene Industrie und weckt bei manchen die Sorge
– wer mögen die „manchen“ bloß sein?! – der Kreml nutze die Krise, um eine Welle der Verstaatlichung auszulösen.
Was woanders ein Konjunkturpaket wäre, heißt in Putins Reich: Rückkehr zum Staatsdirigismus; wo hier der Mittelstand und Deutschlands Schlüsselindustrien gerettet werden, heißt es dort: Russland stützt seine Oligarchen.
Wo so vieles falsch läuft, birgt die Krise die Hoffnung, dass sie in Russland das Verhältnis von oben und unten mal gründlich aufmischt. Noch hält sich die Bevölkerung mit Attacken gegen die politische Führung zurück.
(FAZ, 28.10.) Aber schon einen Tag später ist die Hoffnung der FAZ fast Wirklichkeit: Gefahr für das System Putin!
Alles wird aufgelistet, was jetzt am in Russland geplanten kapitalistischen Aufbau in die Binsen geht, und das ist gut und nicht schlecht, denn:
„Bislang galt, ‚denen da oben‘ freie Hand in der Politik zu lassen, solange sie für wachsenden Wohlstand sorgten. Das könnte sich ändern, wenn Russland in eine Rezession geriete. ... liberale Kräfte hoffen geradezu darauf, dass die Finanzkrise zum Katalysator für eine freiheitlichere Entwicklung wird.“ (29.10.)
Schon schön, dass jemand über die Krise auch mal positiv denken kann. Jedenfalls erwärmt sich der FAZ-Schreiber sichtlich beim Ausmalen dieser von ihm propagierten, aber auch bei Nationalisten russischer Machtart eher seltenen Gemütshaltung. Aber einem Land, das es uns nicht recht macht und deshalb zurecht „System“ heißt, kann man einen richtigen Aufruhr nur wünschen – im Gegensatz zu unserem politischen Gemeinwesen, bei dem ein paar Prozent Linkswähler schon eine drohende Gefahr für die Demokratie darstellen, der man gar nicht entschieden genug begegnen kann.
*
Der Chefökonom der SZ besichtigt das weltweite Krisenpanorama unter dem immerhin moralisch wertvollen Gesichtspunkt von Schuld und Sühne: Der Flächenbrand gefährdet viele Staaten, die mit den Exzessen im Finanzsektor überhaupt nichts zu tun hatten... Zu den Krisenopfern gehören zunächst einmal Mitschuldige.
Nämlich: Island. Die baltischen Republiken finanzierten ihren Boom durch leichtes Geld und Immobilienspekulation
– ja, wie konnten sie nur?! Die zweite Kategorie umfasst all die Staaten, die bisher vom globalen Rohstoffboom profitierten. In Südafrika verstärkt die Krise die Instabilität des politischen Systems
, das ist betrüblich, in Russland und Venezuela geraten die Autokraten Putin und Chavez unter Druck
, was wiederum erfreulich ist. Und schließlich gibt es all jene Länder, die mehr oder weniger unschuldig in den Strudel geraten sind.
Ob man jetzt als Rohstoffexporteur zu den Schuldigen oder Unschuldigen gehört, ergibt sich schlicht und einfach daraus, ob man in der SZ-Redaktion die Staaten leiden kann oder nicht. Weiter geht es mit Brasilien, Mexiko
und der Türkei
. Die wurden teilweise Opfer der Rettungsmaßnahmen der Industrieländer: Deren Banken sind jetzt geschützt.
Weshalb es nur logisch ist, genau an dieselben Länder den Antrag zu stellen, die Schwellenländer zu retten.
„Die Industrieländer müssen die Schwellenländer wie ihresgleichen behandeln. Mittelfristig sollte der IWF mit einer neuen großzügigen Kreditlinie einspringen. Dabei wird es nicht zu vermeiden sein, dass auch Länder gestützt werden, die das gar nicht verdienen.“
Schade, dass da Moral und Wirtschaft doch wieder nicht dasselbe sind.
„Zweitens gehört China mit an den Tisch. Asien ist die einzige Region der Welt, in der noch große Mengen an Kapital zur Verfügung stehen.“
Jedenfalls stehen sie ideell schon mal dem Wirtschaftsstrategen aus München zur Verfügung, der sich im übrigen auch in Chinas Interessen viel besser auskennt als China selbst: China sollte, im eigenen Interesse, dieses Kapital in die Zukunft Weltwirtschaft investieren.
(30.10.) Und nicht nur er. Deutsche Leitartikler verstehen sich darauf, Vorschläge für einen gesamteuropäischen Rettungsfonds als Angriff auf das gute deutsche Geld abzuschmettern; sie verstehen sich noch besser darauf, über die Fonds anderer Nationen zu disponieren. Leider sind nicht alle Nationen so vernünftig und hilfreich wie wir Deutschen:
„Knauserei im Königspalast. Beim saudischen Herrscher wirbt Außenminister Steinmeier um großzügige Hilfe für Pakistan – doch Abdallah plaudert lieber über Religion“ (30.10.),
muss die SZ am Donnerstag berichten. Samstags liefert die FAZ noch einen Nachtrag zur Gerechtigkeit der Krise:
„Der scharfe Rückgang der Preise für Rohstoffe und Agrarprodukte bringt vor allem Länder wie Venezuela, Ecuador und Bolivien in Schwierigkeiten, die am meisten von der Hausse profitierten – und deren Regierungen gleichzeitig am lautesten gegen den Kapitalismus hetzten.“ (31.10.)
Was soll jetzt eigentlich gesagt sein? Hätten sie nicht so gehetzt, hätte der Kapitalismus sie nicht in die Krise gestürzt? Oder geschieht ihnen gleich recht, dass der Kapitalismus sich genauso ruinös aufführt, wie sie in ihrer Hetze es ihm schon immer nachgesagt haben? Egal, jedenfalls trifft es die Richtigen.Wenn die Verhältnisse global aufgemischt werden, hält es die professionellen Politikberater jedenfalls kaum noch auf ihrem Sessel, sie spekulieren ungerührt auf neue Chancenund mögliche Krisengewinne, auf eine neue Aufteilung der Welt Das ökonomische Desaster kann gar nicht so groß sein, die Folgen für die Statisten in aller Welt gar nicht so schlimm, dass ihr imperialistischer Verstand Schaden leiden würde. Im Gegenteil! Er wird durch die Krise beflügelt.