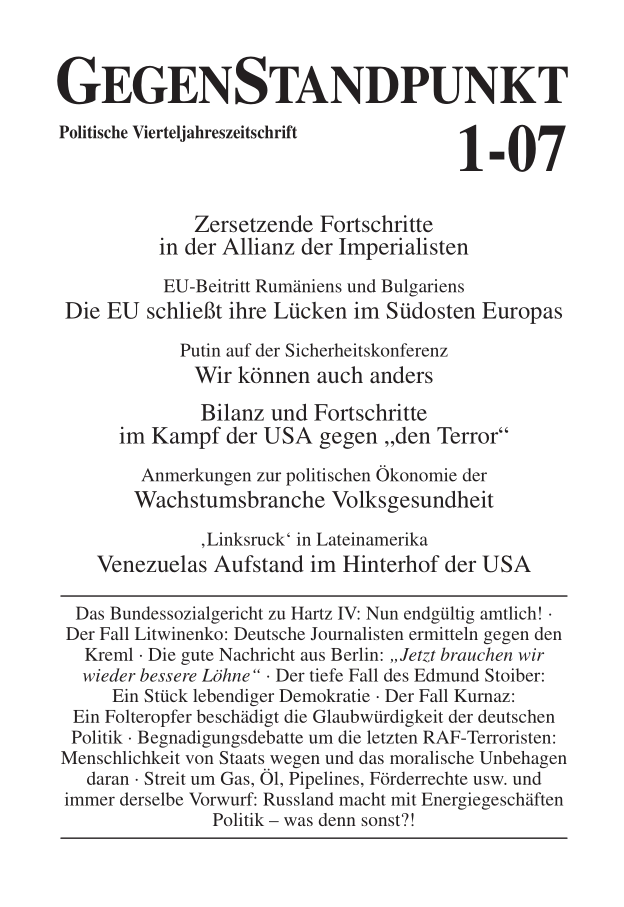Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Die gute Nachricht aus Berlin:
„Jetzt brauchen wir wieder bessere Löhne“
Die Überraschung ist gelungen: „Mut zu höheren Löhnen“ fordert Vize-Kanzler Müntefering; und auch Frau Merkel wünscht sich „angemessene Lohnerhöhungen“. Schließlich, so versichert sie, sei es ja nur „selbstverständlich, dass die Arbeitnehmer an der guten wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt werden“.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die gute Nachricht aus Berlin:
Jetzt brauchen wir wieder bessere Löhne
Die Überraschung ist gelungen: Mut zu höheren
Löhnen
fordert Vize-Kanzler Müntefering; und auch
Frau Merkel wünscht sich angemessene
Lohnerhöhungen
. Schließlich, so versichert sie, sei
es ja nur selbstverständlich, dass die Arbeitnehmer an
der guten wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt
werden.
(SZ, 5.12.).
SPD-Chef Beck erläutert den Vorstoß der Regierung:
Wegen der wirtschaftlichen Schwäche und der
internationalen Konkurrenz waren Lohnerhöhungen eine Zeit
lang nicht möglich. Aber jetzt ist es Zeit für eine
Lohnpolitik, die den Arbeitnehmern angemessene
Lohnerhöhungen zubilligt ... Die gegenwärtige
Auseinanderentwicklung der Einkommen und Vermögen in
Deutschland ist auf Dauer ein Sprengsatz. Hier müssen wir
ein Stück mehr Gerechtigkeit schaffen
(BamS, 3.12.).
1.
Lohnerhöhungen, die eine Zeit lang nicht möglich
waren
: Damit spielt der oberste Sozialdemokrat darauf
an, dass Staat und Kapital die Löhne und Gehälter der
Arbeitnehmer seit über einem Jahrzehnt systematisch
gesenkt haben. Die Unternehmer haben sich Lohn durch
Entlassungen erspart und die verbliebenen Arbeiter dazu
gezwungen, für den Erhalt ihrer Einkommensquelle auf
Einkommen zu verzichten und für immer weniger Geld immer
mehr zu arbeiten. Der Staat hat den Unternehmern dabei
nach Kräften den Rücken gestärkt und die „gegenwärtige
Auseinanderentwicklung der Einkommen und Vermögen“
gezielt herbeiregiert. Die Politik hat sich die Förderung
des Wachstums
auf die Fahnen geschrieben, als
entscheidendes Hindernis dafür die Lohn- und
Lohnnebenkosten im „Hochlohnland“ ausfindig gemacht und
sich um eine entsprechende Therapie für den
„Sanierungsfall Deutschland“ bemüht. Die Verarmung des
Volks hat die Regierung als Rezept zur Schaffung von
nationalem Reichtum eingesetzt und in schöner
Regelmäßigkeit aus dem unterbliebenen – den nationalen
Anforderungen jedenfalls nicht genügenden –
Kapitalwachstum geschlossen, dass das Volk wohl immer
noch über seine „Verhältnisse“ lebt, der Staat also noch
viel zu wenig für die Schaffung gesunder
marktwirtschaftlicher Zustände auf dem Arbeitsmarkt
unternommen hat. Entsprechend dem Motto: „Sozial ist, was
Arbeit schafft“, hat sie mit einer ganzen Serie von
Gesetzen den Sozialstaat umgemodelt und dabei das
Arbeitslosenschicksal so abschreckend gestaltet, dass
sich auch die arbeitende Bevölkerung der gebieterischen
Devise „Hauptsache Arbeit!“ weniger denn je entziehen
kann und allen betrieblichen Vorschlägen zur
Neufestsetzung des Verhältnisses von Lohn und Leistung
aufgeschlossen gegenübersteht. Und für all diese
Maßnahmen hat die Regierung von den Betroffenen Duldung
und Zustimmung verlangt und ihnen dazu ihre Abhängigkeit
vom Profit ihrer Arbeitgeber unter die Nase gerieben.
2.
Nach jahrelanger angestrengter Reformpolitik ist es
endlich soweit: Der Aufschwung ist da! Die Unternehmen
machen Gewinne wie schon lange nicht mehr
, und in
einigen Branchen und Betrieben soll es, wie man hört,
sogar richtig brummen
. Jetzt, wo es der
Wirtschaft
wieder gut geht, wird alles wieder gut:
Deutschland kann seine Rolle als Exportweltmeister weiter
verteidigen und ist wieder ordnungsgemäß die
Wachstumslokomotive
in Europa; die Staatseinnahmen
steigen, und der Staatshaushalt erfüllt wieder alle
nationalen und europäischen Erfolgsmaßstäbe. Die
Wirtschaft bewährt sich als nationale
Reichtumsmaschinerie; damit ist grundsätzlich auch in der
Welt der Politik alles in Ordnung.
Aber: Die Umfragewerte für die Regierungsparteien
verharren – allen Erfolgsmeldungen zum Trotz – auf einem
historischen Tiefstand, und die Stimmung in der
Bevölkerung will einfach nicht zusammen mit den
Unternehmensgewinnen steigen. Noch bevor die
Unzufriedenheit lautstark geäußert wird, haben die
politischen Führer sich bereits zu ihrem Sprachrohr
gemacht und erklären, wo der Schuh drückt: Das Volk
leidet an einer
Gerechtigkeitslücke
, weil sich
Löhne und Gewinne in einem bisher nicht gekannten Maß
„auseinander entwickeln“. Auch wenn weit und breit keine
staatsgefährdenden Umtriebe ersichtlich sind: SPD-Chef
Beck lässt es sich nicht nehmen, Berücksichtigung der
Arbeiter im Namen der Stabilität des Gemeinwesens
anzumahnen, andernfalls sozialer Sprengsatz
hochgehen könnte. Dass die Löhne sinken, Arbeitszeiten
verlängert, Arbeitsbedingungen verschlechtert werden
müssen, wenn es um die Gewinne des Kapitals schlecht
steht, ist selbstverständlich – so gehört es sich für die
„Schicksalsgemeinschaft“, in der alle vom Erfolg des
Unternehmerinteresses abhängen. Und auch wenn die Gewinne
dank „Lohnzurückhaltung“ dann wieder steigen, bleibt der
systemgemäße Vorrang des Gewinns vor dem Lebensunterhalt
der Arbeitskräfte anerkannt und lange außerhalb jeder
Kritik. Irgendwann einmal aber sollte dann doch
irgendeine materielle Anerkennung für die nachrangigen
Mitglieder der Schicksalsgemeinschaft drin sein. Auf
Dauer explodierende Gewinne und immer weiter
sinkende Löhne: Diese Kombination passt nicht
gut zu dem Bild, das sich die Lohnabhängigen von der
Sozialpartnerschaft machen und machen sollen. Ihre
Unterordnung unter den Gang der Geschäfte dürfen und
sollen sich die Arbeitnehmer nicht nur negativ
vorstellen, als eine schicksalhafte Bedrohung ihrer
gesamten Lebensverhältnisse, sondern auch als eine
positive Verknüpfung, durch die auch ihr Wohlergehen im
Erfolg des Ganzen mit aufgehoben ist. Die Opfer, die
ihnen in schlechten Zeiten abgepresst werden, sollen die
Belegschaften sich mit der Erwartung versüßen, dass sie
in guten Zeiten auch am allgemeinen Wohlstand beteiligt
werden. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es
auch den Menschen gut
– für eine Enttäuschung, die
auf Basis dieser Lebenslüge der Marktwirtschaft erwächst,
haben treusorgende Landesväter und -mütter sogar ein
gewisses Maß an Verständnis.
3.
Die Politik beschließt, dass es jetzt an der Zeit ist,
etwas gegen die schlechte Stimmung im Land zu
unternehmen. Sie gibt dem Unmut der Lohnabhängigen
öffentlich Recht – und hat damit schon den ersten Schritt
zur Entschärfung des „Sprengsatzes“ getan. Darüber hinaus
signalisiert sie den Tarifparteien, dass in der nächsten
Tarifrunde für die Arbeitnehmer ein wenig mehr
drin
sein muss, damit sie sehen, dass der
Lohnverzicht der letzten Jahre sich auch lohnt. Dabei
behalten verantwortliche Politiker von Anfang an im Auge,
dass – auch wenn die Kombination von hohen Gewinnen und
niedrigen Löhnen nicht zu dem Bild passt, das die
Bevölkerung sich von der sozialen Marktwirtschaft machen
soll – die beiden Größen in der Sache ganz hervorragend
zusammenpassen. Deshalb haben sie auch ein offenes Ohr
für die Sorgen der Unternehmerschaft, die sofort warnt,
dass überzogene Lohnforderungen die aktuell bessere
konjunkturelle Entwicklung gefährden oder sogar beenden
könnten
(Arbeitgeberpräsident
Hundt, SZ, 5.12.). Dezent weisen die Arbeitgeber
darauf hin, dass man den Zusammenhang zwischen
Lohnerhöhungen und Entlassungen
– den sie tatkräftig
herstellen –immer im Auge behalten muss
, und
erinnern daran, dass der schönste Lohn für den
Lohnverzicht ja wohl darin besteht, dass sich die Arbeit
wieder lohnt. Jedenfalls für sie selbst – sie nehmen
wieder Neueinstellungen vor und lassen sich dafür als die
Vollbringer eines kleinen Wirtschaftswunders
feiern. Darf man das alles aufs Spiel setzen? Frech
machen die Kapitalisten also darauf aufmerksam, dass es
sich ihre Belegschaften überhaupt nicht leisten können,
von einer wirtschaftlichen Entwicklung profitieren zu
wollen, die nur auf ihre Kosten zustande gekommen ist und
nur auf ihre Kosten aufrechterhalten wird.
Dieser Hinweis ist so alt wie der Kapitalismus. Darüber
hinaus kennen die Regierungsparteien auch ein aktuelles
Argument dafür, warum die Beschäftigten die Sache mit dem
sozialen Ausgleich
auf keinen Fall missverstehen
dürfen:
Die CDU bekennt sich zur Sozialen Marktwirtschaft und
Sozialpartnerschaft. Das heißt auch, dass die
Arbeitnehmer einen fairen Anteil am Volkseinkommen
erhalten müssen. Doch gerade der internationale
Wettbewerb macht zur Sicherung von
Arbeitsplätzen Standortvereinbarungen, betriebliche
Bündnisse und Zugeständnisse der Beschäftigten in der
Nominallohnpolitik notwendig.
(CDU-Parteitag)
Unsere
Wirtschaft steht in einem
internationalen Wettbewerb – das sagt ja wohl
alles! Für eine christliche Volkspartei ist es eben
selbstverständlich, dass die wachsende Verarmung der
Bevölkerung, die sie herbeiregiert, allenfalls unter dem
Gesichtspunkt einer Sorge um den nationalen
Gemeinschaftsgeist kritisiert werden könnte – und
diese Kritik ist durch den Hinweis auf den
internationalen Wettbewerb
tatsächlich entwaffnet:
Wenn die Niedriglohnpolitik für die Selbstbehauptung des
nationalen Kollektivs unabdingbar ist, dann ist die
Auseinanderentwicklung der Löhne und Gewinne
keine
Entzweiung der nationalen Schicksalsgemeinschaft, sondern
ein Akt der nationalen Solidarität. Wo die Konzerne sich
weltweit Marktanteile und Gewinne streitig
machen, da ist es für die Belegschaften nicht nur die
erste Arbeiter-, sondern auch die erste Bürgerpflicht,
sich den Konkurrenzmanövern ihrer Arbeitgeber durch
betriebliche Bündnisse
und Zugeständnisse in
der Nominallohnpolitik
unterzuordnen.
Damit ist die Generallinie klar: Die Niedriglöhne sind
und bleiben die Basis des Aufschwungs; die
Auseinanderentwicklung von Kapital und Einkommen
ist nicht nur eine gegebene Tatsache
, sondern auch
künftig ein Trend
, auf den die Beschäftigten sich
gefälligst einzustellen haben. Das Bekenntnis der
Regierungspartei zum sozialen Ausgleich ist nicht der
Auftakt zur Korrektur der beklagten Lage, sondern
umgekehrt die Klarstellung, dass alle Gerechtigkeitstitel
gegen diese kein Einwand sind.
*
Ein fairer Anteil der Arbeitnehmer am
wirtschaftlichen Erfolg
muss dennoch sein.
Die Kanzlerin – in der alten DDR dialektisch geschult –
möchte, dass die Arbeitnehmer von der
Auseinanderentwicklung der Einkommen und Gewinne
stärker profitieren
(Focus,
4.12.). CSU-Chef Stoiber sucht nach einem
Ansatz für Gerechtigkeit in der Globalisierung
(Die Welt, 6.12.), die
Lohnerhöhung ja eigentlich überhaupt nicht erlaubt, und
stellt damit klar, wie diese Gerechtigkeit auszusehen
hat. Jeder Gedanke an eine Teilhabe der Beschäftigten
am Erwirtschafteten
muss sich darauf überprüfen
lassen, ob sie auch auf
wettbewerbsverträgliche Weise
gewährleistet
ist (CDU-Parteitag), also die Gewinnrechnung
der Unternehmer fördert oder sie – und das ist das
Wenigste – jedenfalls nicht belastet. Unter der Parole:
den sozialen Ausgleich ermöglichen
basteln die
Regierungsparteien an dem Kunststück einer
Lohnkonzession, die den Wettbewerbsbedürfnissen der
Unternehmen garantiert nicht schadet, eingedenk dessen,
dass Zugeständnisse noch allemal schaden.
4.
In diesem Geist bereiten dann auch die Organe der
Öffentlichkeit die kommende Tarifrunde vor. Noch ehe die
Gewerkschaft Gelegenheit hat, ihre Forderungen
aufzustellen, macht sich schon eine wohlwollende Presse
zum Fürsprecher der Beschäftigten: Wann aber, fragen
sich immer mehr Arbeitnehmer, sind wir dran, an diesem
Boom gebührlich teilzuhaben?
. Mit dieser Bekundung
von Verständnis reklamiert die SZ die Zuständigkeit, um
nach ihrem Motto: Mehr Geld – aber
wie
, (SZ,
22.12.) und Mehr Geld – aber nicht für
alle
, (SZ,
30.1.) festzulegen, was in dieser Tarifrunde
„geht“ und was zu unterbleiben hat:
Nichts wäre schlimmer als Lohnerhöhungen auf breiter
Front. Selbst eine vor Glück taumelnde Branche wie der
Stahl wird dem nächsten Abschwung nicht entkommen und
darf sich deshalb keine unwiderruflichen zusätzlichen
Belastungen ans Bein binden. Nichts spricht andererseits
dagegen (und alles dafür), Arbeitnehmer über weiterhin
maßvolle Tarifanpassungen hinaus in Form von
Einmalzahlungen und Gewinnbeteiligungen
an der guten Ertragslage teilhaben zu lassen. Nur diese
Methode bietet beim nächsten Abschwung einen gewissen
Puffer, bevor Stellenabbau und Entlassungen nötig
werden.
(SZ, 22.12.)
Der Leitartikel thematisiert den Versuch der
Arbeitnehmer, den Angriffen auf den Lohn
entgegenzutreten, die die Arbeitgeber seit der letzten
Tarifrunde geführt haben: Durch das Streichen
übertariflicher Zulagen und durch Abgruppierungen, die
nicht zuletzt ein neuer Entgeltrahmentarif ermöglicht
hat, haben sie die Löhne in einem weit stärkeren Umfang
gesenkt, als der Blick auf die ohnehin bescheidenen
Tarifabschlüsse verrät. Auf der anderen Seite haben die
Unternehmer nicht nur die Produktivität, sondern auch die
Intensität der Arbeit erhöht und zudem in zahlreichen
Betrieben die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich verlängert.
Den Versuch, durch Lohnerhöhung wenigstens einen Teil der
bereits eingetretenen Schäden auszugleichen, stellt der
Leitartikel unter den imposanten Titel einer Teilhabe
an der guten Ertragslage
, ignoriert also zunächst den
Gegensatz der Beschäftigten zu dem aus ihnen
herausgeholten Reichtum, um diesen Gegensatz in
verwandelter Form – als Liste der Bedingungen,
unter denen das schöne Recht auf Teilhaberschaft nur
gewährt werden kann – wieder einzuführen. Mit der
Kombination von verlogenem Idealismus und sachkundigem
Realismus weist der SZ-Autor die Forderung der
Gewerkschaft nach Kompensation bisheriger Lohnverluste in
Bausch und Bogen zurück. Mehr Lohn: Das gibt es nur für
die Beschäftigten in ausgewählten Branchen und Betrieben.
Und auch da sollen die Arbeitnehmer bei dem Aufstellen
ihrer Forderungen gleich an den nächsten Abschwung
denken und das ausgerechnet für ein Argument halten, auch
den Aufschwung als eine Gelegenheit zur Korrektur der
eingetretenen Verschlechterungen zu verpassen. An Stelle
von prozentualen Lohnzuwächsen sollen sie sich mit einer
Einmalzahlung
abspeisen lassen, die – angesichts
der bleibenden Steigerung der Arbeitsleistung
und der anhaltenden Verringerung der Kaufkraft
durch Inflation – die stattgefundene Lohnsenkung als
Regel festschreibt; von der es nur eine einmalige
Ausnahme geben soll und dies auch nur dann, wenn eine
ungewöhnlich gute Ertragslage des Unternehmens es
problemlos zulässt.
Mehr Lohn, aber richtig: Das ist Lohn in Form einer
Gewinnbeteiligung, die – gleichgültig gegen jedes
Interesse der Beschäftigten an einem Lohn, der zum Leben
reicht – allein das Interesse der Arbeitgeber zur
Richtschnur der Bezahlung macht. Einerseits ist das schon
immer der Fall: Die traditionellen Formen der Bezahlung
nach Arbeitsleistung – Akkord, Zeitlohn, Prämien –
stellen ein Gewinn versprechendes Verhältnis von Lohn und
Leistung sicher, indem sie jeden Euro Lohn von dem Ausmaß
abhängig machen, in dem die Arbeit nach den
Leistungsvorgaben der Firma verrichtet wird; diese Weise
der Bezahlung nötigt dem Arbeiter das Interesse auf,
möglichst lang und intensiv zu arbeiten. Die
Gewinnbeteiligung
setzt noch eins drauf: Sie
bezahlt auch die bereits geleistete Arbeit nur nach der
Maßgabe, dass die produzierte Ware sich auch tatsächlich
auf dem Markt bewährt. In dieser Form ist der Arbeitslohn
garantiert wettbewerbsverträglich
: Die Unternehmer
bestreiten sich auf dem Markt wechselseitig den Nutzen
aus der von ihnen kommandierten Arbeit – und machen den
Lohn ihrer Belegschaften für den Ausgang ihrer
Konkurrenzaffären haftbar. Aus der Perspektive der
Freiheit, Lohn als konjunkturabhängige Gewinnbeteiligung
zahlen zu können, erscheinen die herkömmlichen Formen des
Leistungslohns schon wieder wie eine Belastung
der
Gewinnrechnung mit unflexiblen Kosten, die ein
Unternehmer sich auf keinen Fall ans Bein binden
lassen sollte. Wenn die Unternehmer ihre Beschäftigten
schon nicht an dem kapitalistischen Reichtum beteiligen:
An den Risiken, die aus dieser irrationalen Form
der Reichtumsproduktion entstehen, beteiligen sie diese
gerne und reichlich.
*
In diesem Sinn haben die Metallarbeitgeber längst
gehandelt. In der Lohnrunde 2006 haben sie neben einer
dreiprozentigen Lohnerhöhung eine Einmalzahlung von 310
Euro vereinbart, die je nach wirtschaftlicher Lage des
einzelnen Unternehmens per Betriebsvereinbarung
verdoppelt oder auch gekürzt oder gestrichen werden
konnte. Jetzt kämpfen sie darum, diesen Lohnbestandteil
auszubauen und an die Stelle einer prozentualen Anhebung
des Lohns zu setzen: Unsere einzige Forderung für die
Tarifrunde ist die Fortsetzung der gewinnorientierten
Lohnpolitik.
Sonst verlangt Gesamtmetallpräsident
Kannegiesser (Handelsblatt, 8.12.) nichts! Nur eben, dass
seine Verbandsfirmen immer größere Teile der Lohnsumme
nach Einschätzung ihrer Konkurrenzlage festsetzen können.
5.
Noch besser als eine Lohnerhöhung in Form einer stets
widerruflichen Einmalzahlung ist eine Lohnerhöhung, die
den Unternehmer überhaupt nichts kostet. Wie das geht,
erklärt uns SPD-Chef Beck, und zwar auf Antrag von Bild
so, dass wir alle es verstehen
:
Beim Investivlohn geht es darum, die
Spielräume, die in der Wirtschaft für
Einkommensverbesserungen zur Verfügung stehen, zu
erweitern. Das funktioniert dann, wenn ein Teil dessen,
was die Beschäftigten erhalten, im Unternehmen verbleibt.
Einigen Unternehmen wird es im kommenden Jahr
wahrscheinlich nicht möglich sein, über zwei Prozent
Lohnsteigerung hinauszugehen. Ein zusätzlicher
Prozentpunkt wäre aber unter Umständen möglich, wenn er
als Kapital im Betrieb verbleiben würde. Dieses Geld
wirkt dann wie Eigenkapital, wie erhöhte Liquidität.
Genutzt werden kann der Kapitalstock, den man sich dann
über 20 oder 30 Jahre anspart, im Alter. Dann dient er
zur Absicherung des Lebensstandards oder man lässt ihn im
Unternehmen und kann ihn vererben
(Beck, BamS, 3.12.).
Zusammengenommen wäre das schon einmal eine Lohnerhöhung
von sage und schreibe 3 %. Also in etwa so viel, wie der
Staat durch die laufende Mehrwertsteuererhöhung den
Leuten gleich wieder wegnimmt. Soviel Gerechtigkeit wäre
unter Umständen
tatsächlich möglich – wenn die
Unternehmer die Lohnerhöhung nicht auszahlen müssen. Der
Investivlohn, dieser Klassiker der sozialen
Marktwirtschaft, ist geeignet, die Forderung nach
sozialer Teilhabe mit dem Gebot marktwirtschaftlicher
Vernunft zu versöhnen. Er beteiligt die Arbeitnehmer an
der wirtschaftlichen Entwicklung und schützt das
Erwirtschaftete
zugleich davor, in höchst
zweckwidriger Weise von den Produzenten verkonsumiert zu
werden. Die Arbeiter bekommen einen gerechten Anteil am
Kuchen – unter der Voraussetzung, dass sie darauf
verzichten, ihn zu essen. Anders ausgedrückt: Die
Arbeitnehmer bekommen ein Entgelt, das die Firma behält.
Ihr Lohn wirkt im Unternehmen als Kapital, investiert, um
noch mehr Kapital zu werden. Sie bekommen dafür einen
Eigentumstitel, von dem noch näher festzulegen ist, wann
und in welchem Umfang sie darüber verfügen können. Ob er
dann noch etwas wert ist und wie viel, das werden die
Arbeitnehmer dann schon sehen.
Die frohe Botschaft, dass der Investivlohn die
Arbeitnehmer in gleicher Weise wie das Management am
Erfolg des Unternehmens beteiligt
(Presseclub, 4.2.), ignoriert einen
kleinen Unterschied in der Höhe der Bezahlung wie der
Boni. Bei Managern deckt schon das Grundgehalt die
Unkosten auch einer anspruchsvollen Lebensführung; die
zusätzliche Zuteilung von Aktienpaketen in Millionenhöhe
macht sie tatsächlich zu Teilhabern am Erfolg ihres
Unternehmens und zu Nutznießern der Ausbeutung, die sie
organisieren. Bei den einfachen Bediensteten des Kapitals
ist der Investivlohn hingegen ein Abzug von einem Gehalt,
das schon zum normalen Lebensunterhalt immer weniger
reicht. Ausgerechnet wegen der Auseinanderentwicklung der
Löhne und Gewinne sollen die Arbeiter ihre Kapitalisten
auch noch kreditieren und ihnen die Freiheit einräumen,
sie an Stelle eines „Barlohns“ mit fiktivem Kapital
abzufinden.
Wenn die Arbeitnehmer dann die Erlaubnis haben, ihre
angesammelten Rechtstitel zu versilbern – so etwa in
20 oder 30 Jahren
–, dann weiß SPD-Chef Beck für
das Geld schon einen prima Verwendungszweck: Es dient
der Absicherung des Lebensstandards im Alter
. Das
werden die Arbeitnehmer dann wegen der Reformwut der
Regierung („Rente mit 67“) auch bitter nötig haben.
*
Über eine mangelnde öffentliche Anteilnahme an ihrer miesen Lage brauchen die Arbeitnehmer sich nicht zu beklagen. Dass die Reallöhne seit über einem Jahrzehnt sinken, das ist der Presse manche Schlagzeile wert. Dass immer mehr Beschäftigte von ihrem Lohn nicht mehr leben können, das wird allgemein registriert und bedauert. Dass die Beschäftigten angesichts der sich öffnenden Einkommensschere in ihrem Gerechtigkeitsempfinden verletzt sein müssen, das wird ihnen in Talkshows, Leitartikeln und politischen Communiques vorbehaltlos zugestanden. Nichts wird an der Lage der arbeitenden Klasse beschönigt, alle Rechtstitel auf Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum sind und bleiben in Kraft, jede Unzufriedenheit der Beschäftigten wird anerkannt und aufgegriffen – und das alles nur, um für jede Zumutung des Kapitals tonnenweise Verständnis abzuladen und nach der sorgfältigen Überprüfung aller Umstände und Möglichkeiten zu dem immergleichen Ergebnis zu gelangen: Das alles ist nötig. Im Interesse von Wachstum und Wirtschaftsmacht kann das Land auf die fortschreitende Verarmung der Lohnabhängigen einfach nicht verzichten. Kann man ihnen das nicht auch einfacher sagen?