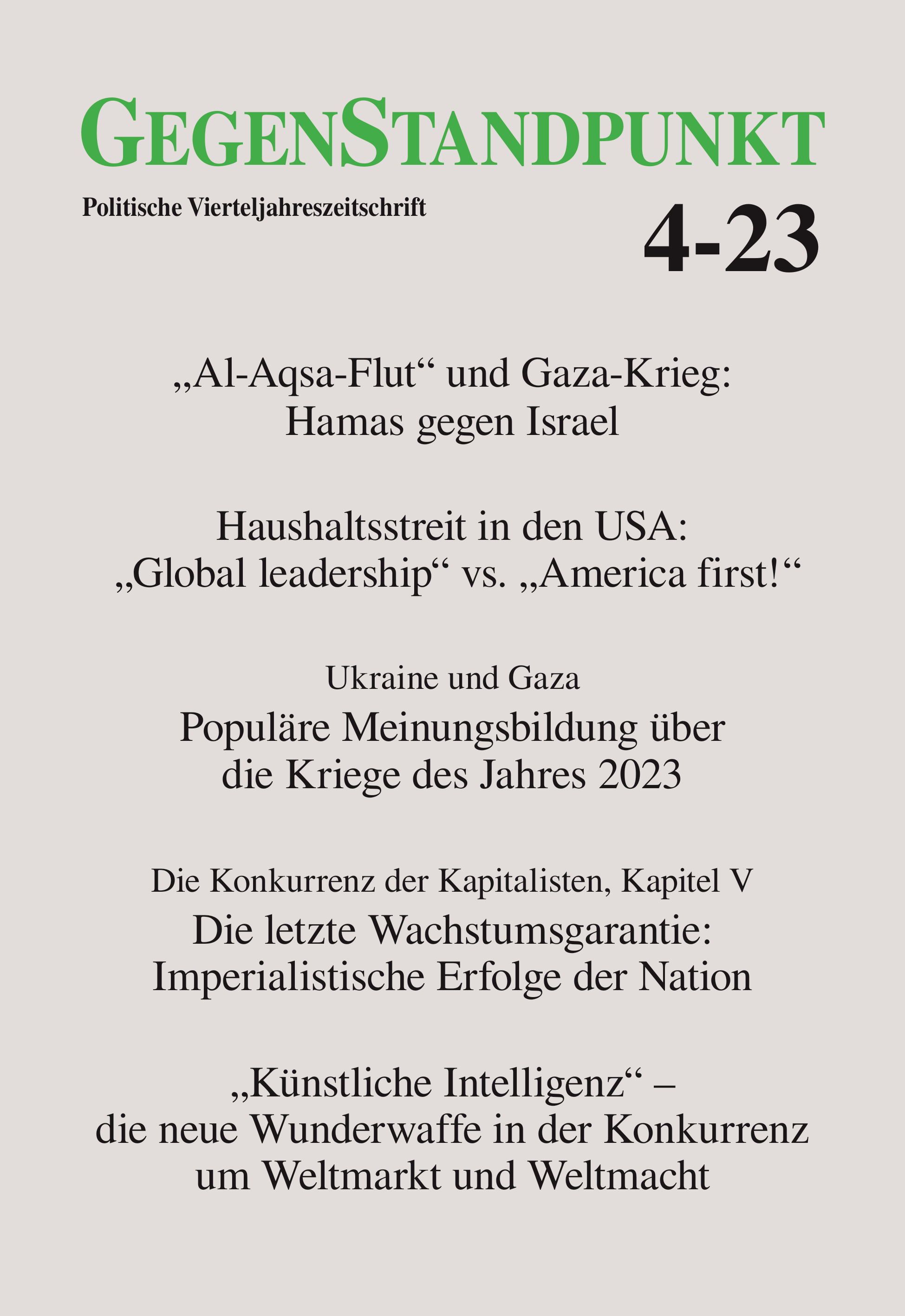Wann kommt die Viertagewoche?
Eine trostlose Debatte um eine trostlose Forderung
Wann kommt die 4-Tage-Woche endlich auch in Deutschland?“, fragt – die IG Metall! Natürlich nicht, um das einfach abzuwarten, sondern um ihre für die Tarifrunde am Jahresende geplante Forderung nach einer 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich zu rechtfertigen. Ihre Argumente fügen sich nahtlos ein in eine nicht zuletzt durch ihre Forderung befeuerte Debatte zwischen Feuilleton und Wirtschaftsteil, in der Befürworter und Gegner der Viertagewoche nüchtern betrachtet nichts als lauter Einwände gegen die Produktionsweise liefern.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Wann kommt die Viertagewoche?
Eine trostlose Debatte um eine trostlose Forderung
„Die 4-Tage-Woche wird derzeit weltweit diskutiert, in vielen Staaten wird experimentiert: Beschäftigte arbeiten motivierter, produktiver und gesünder – und können Arbeit und Leben besser vereinbaren, Stichwort ‚Work-Life-Balance‘. Betriebe werden durch die 4-Tage-Woche attraktiver für Fachkräfte – und können damit in Krisen Arbeitsplätze sichern. Und schließlich ist die 4-Tage-Woche auch gut fürs Klima, spart Arbeitswege und Energie. Wann kommt die 4-Tage-Woche endlich auch in Deutschland?“,
fragt – die IG Metall! Natürlich nicht, um das einfach abzuwarten, sondern um ihre für die Tarifrunde am Jahresende geplante Forderung nach einer 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich zu rechtfertigen. Ihre Argumente fügen sich nahtlos ein in eine nicht zuletzt durch ihre Forderung befeuerte Debatte zwischen Feuilleton und Wirtschaftsteil, in der Befürworter und Gegner der Viertagewoche nüchtern betrachtet nichts als lauter Einwände gegen die Produktionsweise liefern.
I. Die Viertagewoche in der öffentlichen Debatte
Ursula Weidenfeldt greift für ihre Polemik „Das Märchen von der Viertagewoche“ (Der Spiegel, 12.4.23) auf Keynes zurück, der sich vor Urzeiten einmal den Widerspruch geleistet hat, beim Blick auf die Ökonomie für einen Moment ganz vom kapitalistischen Zweck allen Produzierens zu abstrahieren.
„Der berühmte Ökonom John Maynard Keynes meinte vor nicht ganz 100 Jahren, dass die Menschheit im Jahr 2030 vermutlich mit 15 Wochenstunden Arbeit auskommen werde. Der Produktivitätszuwachs werde so hoch sein, dass man nach zwei Arbeitstagen genug erledigt habe, um ein schönes Leben zu führen. Viel Zeit bleibt nicht mehr, denkt sich offenbar die Industriegewerkschaft Metall – und fordert für die kommende Stahl-Tarifrunde die Viertagewoche.“
Der Umstand, dass der immense technische Fortschritt – immerhin die Reduktion des Arbeitsaufwands je hergestelltem Gebrauchswert – überhaupt nicht zu einer entsprechenden Reduktion der Arbeitszeit geführt hat, spricht also nur für eines, nämlich gegen alle, die meinen, weniger Arbeit wäre doch drin. Da blamiert sich nicht die Ökonomie, da macht sich die Gewerkschaft so lächerlich wie die Prognose des alten Ökonomen. Das setzt schon einmal den rechten Ton für die nachfolgende Auseinandersetzung mit den Argumenten der Träumer:
„Studien über die angeblich erfreulichen Wirkungen einer rigoros verkürzten Wochenarbeitszeit werden gerne zitiert. Britische Wissenschaftler ließen 60 Firmen mit 2 900 Mitarbeitern einen Arbeitstag pro Woche aus dem Kalender streichen. In Island wurde in einem Feldversuch in einigen Unternehmen die Arbeitszeit von 40 auf 35 Stunden reduziert, bei vollem Lohnausgleich. Das Ergebnis war in beiden Studien ähnlich: Die Beschäftigten fühlten sich offenbar wohler, arbeiteten motivierter und konzentrierter, waren weniger gestresst, seltener krank. Manche hatten weniger Ärger zu Hause, andere machten mehr Sport. Umsatz und Produktivität stiegen. Die meisten beteiligten Unternehmen wollen das Experiment nach der sechsmonatigen Laufzeit fortsetzen.“
Die für sich wenig rätselhaften positiven Wirkungen verkürzter Wochenarbeitszeit auf die Beschäftigten werden nur daran gemessen, wie sie sich auf die Bilanzen der Unternehmen auswirken, die allein darüber entscheiden, ob weniger gearbeitet wird oder nicht. Dass die Unternehmen in diesem Fall sogar bereit sind, dauerhaft so weiterarbeiten zu lassen, ist für die Frau vom Spiegel aber nur die Steilvorlage, sich von diesen „angeblich erfreulichen Wirkungen“ demonstrativ unbeeindruckt zu zeigen:
„Wäre es also richtig, die Wochenarbeitszeit generell zu kürzen, wie es die IG Metall jetzt für die Stahlarbeiter will? Da tun sich grundsätzliche Fragen auf. Eine Arbeitszeitverkürzung um drei Stunden entspricht bei einer 35-Stunden-Woche einer Lohnerhöhung von etwas mehr als 8,5 Prozent. Das liegt zwar ungefähr in der Bandbreite der Abschlüsse, die in diesem Jahr gemacht werden, allerdings in der Regel für zwei Jahre. Würde also eine reine Arbeitszeitrunde verhandelt, wäre die 32-Stunden-Woche nur bei einem längeren Lohnverzicht bezahlbar.“
„Grundsätzliche Fragen“ tun sich dann doch nicht auf, stattdessen eine schlichte Feststellung: Die IG Metall hat ihre Forderung mit Lohnverzicht zu finanzieren! Denn vom Standpunkt des privaten Bereicherungsinteresses betrachtet, dem jede seriöse Betriebsrechnung folgt, fällt die beantragte Arbeitszeitverkürzung unter die Rubrik Kosten für den Faktor Arbeit und damit unter das Gewohnheitsrecht der Unternehmen auf Tarifanpassungen nur im Rahmen des für den Betrieb Verträglichen. Der Rest ist Mathematik, alles andere Teil der Märchengeschichte:
„In den Studien zur Viertagewoche wird vorgeschlagen, unproduktive Zeiten aus der Wochenarbeitszeit herauszupressen und diese in Freizeit umzuwandeln. Also weniger Meetings, kürzere Konferenzen, keine Störungen konzentrierter Arbeitsphasen mehr. So bezahle sich die Sache quasi von selbst. Doch wie viele Meetings und Konferenzen hat der Stahlarbeiter?“
Von der schönen Vorstellung, das entscheidende Verhältnis zwischen Lohnkosten und dem Überschuss, den die Arbeit produziert, intakt zu lassen, lässt die Kritikerin sich nicht blenden. Die Idee, es gäbe da bei den Stahlarbeitern noch viel „herauszupressen“, hält sie für ziemlich abwegig. Und selbst wenn es so wäre:
„Einer Branche, die gerade mit Milliardenzuschüssen zukunftsfähig gemacht werden soll, würde man lieber einen anderen Vorschlag machen. Wie wäre es, mehr Stahl zu kochen, bessere Betriebsergebnisse zu erzielen und damit weniger Subventionen zu beanspruchen? Das Ziel sollte doch sein, die unproduktiven Phasen in produktive umzuwandeln. Oder will man behaupten, es gebe ein implizites Recht auf Zeitvergeudung am Arbeitsplatz, das auch in einen Freizeitanspruch umgewandelt werden könne?“
Wenn die Studienautoren schon von der Existenz unproduktiver Phasen ausgehen, müssen sie sich daran erinnern lassen, dass die keine Ansprüche der Arbeiter, sondern Ansprüche der Unternehmen an die Arbeit begründen: Letztere haben ein explizites Recht darauf, dass alle Arbeitszeit im Betrieb ihnen dient; wofür werden die Leute schließlich bezahlt? Verpflichtet sind die Stahlmultis nur zu einem, dazu aber unbedingt: Sie haben mit der optimalen, also möglichst intensiven Inanspruchnahme der Arbeit ihrer Belegschaft Erfolge einzufahren. Die schulden sie dem Gemeinwesen, dessen Staat ihren Erfolg per Subventionen zu seiner Sache gemacht hat; und obendrein ist der sowieso das Gebot einer guten Betriebsführung, die mit Arbeitszeitverkürzungen einfach nicht zusammenpasst:
„In der britischen Studie setzten sich die Chefs der – meist kleineren – Betriebe mit ihren Mitarbeitern zusammen. Gemeinsam identifizierte man Produktivitätsbremsen, suchte nach Wegen, besser zu arbeiten. Es wäre interessant zu erfahren, wie sich die Unternehmen mit denselben Verbesserungen ohne Arbeitszeitverkürzung entwickelt hätten.“
*
Auch der Wirtschaftsweise a.D. Bert Rürup attestiert seinem berühmten britischen Vorgänger mit der 15-Stunden-Prognose in seiner Zurückweisung „Eine Vier-Tage-Woche ist populär, aber unrealistisch“ (Handelsblatt, 19.5.23) einen „gewaltigen Irrtum“. Dabei folgt sein Aufsatz einer These, die sich mit der Gleichung von gesteigerter Produktivität und verringerter Arbeitsmühe gar nicht erst befasst: „Weniger Arbeit für gleichen Lohn? Das erfordert riesige Produktivitätsschübe. Die aber sind in weiten Teilen der Wirtschaft überhaupt nicht erreichbar.“ Wo für Lohn gearbeitet wird, ist die Verringerung der Arbeitsmühe ohne materielle Einbußen der Arbeitenden ein Angriff auf den Zweck des Wirtschaftens. Denn an der Arbeitsproduktivität ist allein entscheidend, was sie dem Unternehmen an Erträgen im Verhältnis zu den Lohnkosten einbringt. Und dazu kann Rürup in all seiner Wirtschaftsweisheit eines ganz sicher sagen: So viel mehr kann die Wirtschaft aus den Beschäftigten überhaupt nicht herausschlagen, dass sie im Gegenzug ein paar Stunden auf sie verzichten könnte. Also Pech für die Arbeiter? Vielleicht aber ist das ja sogar ihr Glück. Denn fest steht ja nach Rürup, dass, selbst wenn die Wirtschaft zu den erforderlichen „riesigen Produktivitätsschüben“ imstande wäre, die Arbeiter davon am Ende nur Nachteile hätten. „Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich“ ist nämlich ein wahrer „Wohlstandskiller“! Das führt Rürup anhand eines Kurzdurchgangs durch die Nachkriegsgeschichte vor:
„Mitte der 1980er-Jahre setzte die IG Metall dann den Einstieg in die 35-Stunden-Woche durch, die aber flächendeckend erst 1995 in dieser Branche umgesetzt wurde. Die Folgen waren beachtlich. Der mit dem Tarifabschluss verbundene Arbeitskostenschub löste eine gewaltige Rationalisierungswelle aus – Maschinen ersetzten wo immer möglich Menschen, Arbeitsplätze wurden in Niedriglohnländer verlagert, was durch den Fall des Eisernen Vorhangs viel einfacher geworden war.“
So rückt Rürup gerade, welche Rolle der „technische Fortschritt“, mit dem Keynes seine Prognose begründet hat, in der besten aller Wirtschaftsweisen wirklich spielt. Er ist das Mittel des Erfolgs derer, die den Arbeitsprozess einrichten, beständig umgestalten und denen selbstverständlich alle Erträge der Arbeitsproduktivität zufallen. Wenn ihnen die Gewerkschaft kämpferisch Lohnkostensteigerungen abringt, haben sie im technischen Fortschritt ihr Mittel, damit souverän umzugehen: Im Zweifel machen sie aus ihrem permanenten Bemühen um „Rationalisierung“, also darum, mittels Investitionen in effizientere Produktionsmittel bezahlte Arbeit überflüssig zu machen, einfach eine „Welle“ – also auf einen Schlag massenhaft durch Maschinen ersetzte Arbeitskräfte einkommenslos. Oder sie machen den Laden im Inland gleich dicht und wandern dem Niedriglohn hinterher.
Im Anschluss macht der Ökonom sich die Mühe, zu ergründen, ob „weniger Arbeit für gleichen Lohn“ stattdessen auch mit weniger desaströsen Folgen zu haben wäre. Antwort: Nein!
„Der von Esken [am 1. Mai 2023] ins Spiel gebrachte Übergang zur Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich würde zur Kompensation des damit verbundenen Arbeitskostenschubs Produktivitätssteigerungen von 25 Prozent erfordern. Im verarbeitenden Gewerbe sind solche Produktivitätssteigerungen über einen Zeitraum von zehn Jahren denkbar, wenn man an die nicht ausgeschöpften Möglichkeiten der Digitalisierung denkt. So stieg etwa in den USA die Wirtschaftsleistung je geleisteter Arbeitsstunde von 1999 bis zum Ausbruch der Finanzkrise 2007 im Schnitt um 2,3 Prozent pro Jahr. Dieser theoretischen Möglichkeit steht der empirische Befund gegenüber, dass das Produktivitätswachstum in den meisten entwickelten Industrieländern in den vergangenen Dekaden niedrig war.“
Die Produktivität wird gemessen, wie sie praktisch zählt: als „Wirtschaftsleistung je Arbeitsstunde“, die sich in den Bilanzen der Unternehmen niederschlägt. Und auf dieser Grundlage bekommt man nüchtern vorgerechnet: In ihrer kapitalistischen Mission ist die Produktivität der Arbeit, die die Unternehmen eben noch so folgenreich zur Rettung ihrer Kapitalproduktivität vor dem Arbeitskostenschub durch die 35-Stunden-Woche eingesetzt haben, mit der Aufgabe, einen sozialen Fortschritt zu kompensieren, heillos überfordert. Die „theoretische Möglichkeit“ besteht zwar, aber die Empirie versagt daran nun einmal. Das zu missachten, so viel ist klar, würde schon wieder den Wohlstand der Arbeitnehmer treffen:
„In weiten Teilen des Dienstleistungssektors, etwa im Pflege- und Gesundheitsbereich, in der Gastronomie oder im Einzelhandel, sind hohe Produktivitätssteigerungen ohnehin unrealistisch. Somit bedeutete eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich dort einen kräftigen Anstieg der Arbeitskosten – was unweigerlich zu kräftigen Preiserhöhungen führen würde.“
Dies ist die nächste Fassung, in der die Unternehmen sich im Falle steigender Arbeitskosten nach Kräften mindestens schadlos halten, das nächste Sachgesetz, das schon wieder gar nicht gegen die Ökonomie sprechen soll, in der es gilt, sondern nur gegen die Gewerkschaften und alle, die das nicht vollumfänglich akzeptieren.
*
Die arbeitnehmerfreundlicher eingestellte Süddeutsche Zeitung zitiert in ihrer Überschrift zum Thema einen Handwerker: „Es gibt nichts Besseres als die Viertagewoche.“ (SZ, 19.5.23) So weltfremd, den Nutzen der Arbeitnehmer zum Argument zu erklären, ist sie allerdings nicht. Die Frage „Wie soll weniger Arbeit fürs gleiche Geld funktionieren?“ führt wieder schnurstracks auf die andere Seite des Beschäftigungsverhältnisses:
„Marco Hinderks und seine 30 Kollegen arbeiteten zuvor 38,5 Stunden. Ohne Überstundenzuschläge, obwohl der Tarifvertrag der IG Metall nur 36 Stunden vorsieht. Als sich Widerstand regte, schlug der Betriebsrat vor, künftig 36 Stunden an vier Tagen zu arbeiten. Der Chef war anfangs nicht begeistert. Heute werkeln die Handwerker in zwei Teams. Die einen haben montags frei, die anderen freitags. So ist die Firma jetzt fünf volle Tage für die Kunden da. Alle sind zufrieden, berichtet zumindest der Betriebsrat Benjamin Ackermann. Die Kunden erreichen die Handwerker länger und zahlten seltener Notfallaufschlag. Der Chef registriere bessere Stimmung bei trotzdem guter Auftragslage. Und die Mitarbeiter seien ausgeglichener und dadurch motivierter. Sie verdienen allerdings bei 36 Stunden weniger als vorher bei 38,5. Und das ist ein interessanter Punkt. Die Studien zeigen, dass die meisten Beschäftigten nur kürzer arbeiten möchten, wenn sie genauso viel verdienen.“
Zunächst einmal zeigt dieses alle Seiten zufriedenstellende Musterbeispiel entgegen der Ausgangsfrage zwar, wie weniger Arbeit für weniger Geld „funktioniert“. Aber gerade das findet die SZ „interessant“, wo doch die meisten Beschäftigten auf Nachfrage angeben, es eigentlich nur für das gleiche Geld tun zu wollen. Wenn diese subjektive Vorliebe schon empirisch so gut als Wunsch der Mehrheit belegt ist, dann fragt sie wohlwollend nach, ob er sich nicht doch irgendwie vor dem betrieblichen Zweck rechtfertigen lässt, der ihm entgegensteht.
Die SZ lässt Befürworter der Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich zu Wort kommen, die beteuern, dass Menschen, die kürzer arbeiten, „produktiver“ sind, außerdem „motivierter und gesünder, sie fallen weniger aus“; beides würde „den Firmen Einnahmen verschaffen, aus denen sie mehr Lohn zahlen könnten“. Gegner wenden andererseits ein, dass Gesundheitsverschleiß und Leistungskraft längst optimiert sind: „Gesünder und leistungsstärker würden Arbeitnehmer durch eine 32-Stunden-Woche nur, wenn sie vorher horrend lang gearbeitet hätten – und nicht nur 38 Stunden, oder 40.“ Auch nicht von der Hand zu weisen. Die SZ selbst positioniert sich mit dem salomonischen Urteil in der Mitte, es ließe sich „zumindest ein Teil-Lohnausgleich für jene erwirtschaften, die kürzer arbeiten möchten“.
Insgesamt haben diese Beschäftigten aktuell mit ihrem Wunsch nach weniger Arbeit das Glück einer Sondersituation: „Sie setzen das leichter durch, weil die Alterung einer kinderarmen Nation das Personal raubt und die Firmen ihren Leuten mehr zugestehen.“ Normal wäre ja eigentlich, dass die Firmen in den Einwohnern der Nation ihre stets passende Ressource haben, die Arbeitskraft mindestens in dem Umfang, der Ausstattung und zu den Konditionen liefert, wie sie sie für ihren immerwährenden Wachstumsbedarf brauchen. Deswegen ist ein „Fachkräftemangel“ – und das werden gerade die entschiedenen Arbeitnehmerfreunde nicht müde zu betonen – auch nicht einfach die gute Nachricht einer für Arbeitnehmer ausnutzbaren Lage, sondern ein gemeinsames Problem, und das Anliegen, weniger zu arbeiten, recht besehen ein Beitrag zu dessen Lösung:
„Mit kürzeren Arbeitszeiten gewinnt man mehr Fachkräfte. Viele Menschen sind unfreiwillig in Teilzeit tätig, etwa Mütter. Sie würden gerne länger arbeiten. Für sie kämen vielleicht 32 Stunden in Frage, aber nicht 40. Schon wegen der Kitazeiten. So erstaunlich das in manchen Ohren klingen mag: Eine Viertagewoche kann beitragen, den Fachkräftemangel zu lindern.“
Zu einer ausgewogenen Betrachtung gehört natürlich die kongeniale Gegenposition, dass mit der Arbeitszeitreduzierung nicht mehr, sondern weniger Arbeit aus der Gesamtbevölkerung herausgeschlagen und somit der Fachkräftemangel „verschärft“ werde. Inklusive Aufklärung in der Frage, wer damit welches Problem hätte:
„Wenn Busverbindungen, Pflegeheime oder Supermärkte einfach einen Tag weniger zur Verfügung stehen, ist das ein Verlust an Service. An Wirtschaftsleistung. Und damit an Einkommen.“
Die interessierte Verwechslung von Arbeits- und Öffnungszeiten belegt: Unter der Viertagewoche leidet einfach alles, worauf es ankommt.
*
Das hätten die Vertreter der Wirtschaft übrigens gleich sagen können. Gesamtmetallchef Wolf beklagt in der BamS vom 8.10.23
„eine zunehmende Abkehr vom Leistungsprinzip in Deutschland. Schon mit dem Begriff ‚Work-Life-Balance‘ habe er ein Problem, sagte der Gesamtmetall-Chef. ,Er sagt aus, Work ist schlecht, Life ist gut. Dabei sind Leben und Arbeit doch keine Gegensätze.‘ Das Thema Leistung und Arbeit müsse wieder positiv dargestellt werden, nicht nur von Arbeitgebern und Verbänden, vor allem in den Familien und an den Schulen.“
Warum macht man es sich in Deutschland nur immer so schwer? Man muss die Leute einfach länger arbeiten lassen und ihnen von klein auf und oft genug erklären, dass das gut so ist.
II. Die Viertagewoche in der Tarifrunde der Stahlindustrie
Die gewerkschaftliche Forderung: Sozialverträgliche Gestaltung der Transformation
In eindrücklichem Kontrast zum Gerede von der Work-Life-Balance erklärt der scheidende Vorsitzende im FAS-Interview, warum seine IG Metall in der Eisen- und Stahlindustrie das Thema Arbeitszeit aufmacht:
„Wir wollen mittelfristig die 32 Stunden als neue Normalarbeitszeit bei Stahl, nicht heute und morgen, sondern dann, wenn durch die Umstellung auf eine klimafreundliche Stahlproduktion Arbeitsplätze wegfallen. Damit rechnen wir ab 2026. Dann braucht es Instrumente, die Beschäftigung auffangen, indem Arbeit auf mehr Schultern verteilt wird, ohne dass es zu Entgeltverlusten kommt. Und 32 Stunden lassen sich im Schichtbetrieb nun mal am besten als Viertagewoche umsetzen.“ (Hofmann, FAS, 17.9.23)
Klimafreundliche Stahlproduktion als perspektivisch aufziehende Notlage für die Stahlarbeiter: Auf die Gewissheit, dass sich auch der grüne Fortschritt des Geschäfts selbstverständlich darauf reimt, Einkommen wegzurationalisieren, will sich die IG Metall rechtzeitig einstellen und sowohl Entlassungen als auch Einkommensverluste verhindern. Eine Viertagewoche wäre aber längst nicht nur dafür eine prima Idee:
„Zudem wird die Stahlindustrie durch kürzere Arbeitszeiten auch attraktiver für die Fachkräfte, die sie für die Transformation benötigt. Und schließlich belastet die Arbeit auch weniger und lässt mehr Zeit zum Leben: Bei 32 Stunden wäre auch eine 4-Tage-Woche möglich – und zwar eine gesunde, mit acht Stunden am Tag.“ (Papier zur Stahltarifrunde, 1.11.23)
Da sind sie wieder, die Fachkräfte, für die man „attraktiv“ sein muss. Die grüne Transformation, die todsicher viele Metallarbeiter den Job kostet, braucht doch andererseits auch viele von ihnen – nicht wahr? Auf beide Probleme wäre die Viertagewoche doch eine passende Antwort. Weil die Gewerkschaft um die Abhängigkeit ihrer Forderung nach weniger Wochenarbeitszeit von gelingenden Stahlgeschäften weiß, erklärt sie ihr Anliegen zu einem Beitrag zum Programm von deren Transformation. Dass auch das schönste gewerkschaftliche Argument den im Raum stehenden Interessengegensatz nicht aufhebt, weiß die Gewerkschaft natürlich auch. Deswegen gibt sie dann auch noch einmal explizit damit an, wie verträglich sie ihre Forderung gegenüber dem entgegenstehenden Interesse längst ausgestaltet hat:
„Die 4-Tage-Woche gibt es längst. Viele Tarifverträge der IG Metall ermöglichen die Absenkung der Arbeitszeit für Betriebe sowie Wahlarbeitszeiten für Beschäftigte – auch in der Eisen- und Stahlindustrie. Bei Thyssenkrupp etwa können die Beschäftigten ihre Wochenarbeitszeit zwischen 33 und 35 Stunden selbst wählen. Bei Arcelor Mittal in Bremen sind ebenfalls 32 Stunden möglich. Die beiden Konzerne machen schon fast die Hälfte der Stahl-Beschäftigten in Deutschland aus. ‚Mir kann also niemand erzählen, dass das nicht geht‘, erklärt Knut Giesler, Verhandlungsführer und Bezirksleiter der IG Metall NRW. ‚Wir wissen ja, dass es funktioniert.‘“ (Diskussionspapier, 5.4.23)
Es funktioniert längst, und zwar mit den Gewinnrechnungen der Stahlmultis. Was da wirklich funktioniert, weiß die IG Metall selbst am besten, sie hat die entsprechenden Arbeitszeitmodelle ja ausgehandelt: Im besten Fall sehen diese für die Beschäftigten die Möglichkeit von Arbeitszeitreduzierungen vor – unter der Bedingung, dass das Unternehmen mittels der im Gegenzug vereinbarten Flexibilität nach oben das je benötigte Arbeitsvolumen abrufen kann, und mit entsprechenden Lohneinbußen. Im schlechtesten Fall – wie schon anno ’93, „30 000 Arbeitsplätze hat die IG Metall damals bei VW gesichert“ – wird der Sanierungsbedarf des Unternehmens, i.e. die Einsparung bezahlter Arbeitszeit, auf alle Schultern gleichmäßig verteilt – zwecks ‚Sicherung der Arbeitsplätze‘. In jedem Fall ist die Rentabilitätsrechnung der Gegenseite die Richtschnur. Was also bisher gar nicht funktioniert, ist die geforderte verbindliche Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich.
Die Antwort der Arbeitgeber: Die Transformation geht nur auf Kosten der Beschäftigten!
„Es ist für mich schlicht nicht verständlich, wie man auf die Idee kommt, den Fachkräftemangel – den es ja zweifelsohne gibt – mit einer Verknappung und Verteuerung der Arbeit lösen zu wollen. Das passt nicht zusammen. Zwar werden im Zuge der Transformation perspektivisch Anlagen im Hochofenbereich abgebaut, ja. Nämlich jene, die besonders viel Kohlendioxid ausstoßen. Doch die Transformation bedeutet: Die Unternehmen bauen neue Anlagen – für Direktreduktionsanlagen, für grünen Strom, für Wasserstoff. Allein dafür brauchen wir Personal.“ (Gerhard Erdmann, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Stahl, in der Wirtschaftswoche, 7.9.23)
Das hat die Gewerkschaft davon, dass sie ihre Forderung der in Sachen Zukunft der Stahlproduktion wirklich zuständigen Seite als Beitrag zur Lösung von gemeinsamen Problemen präsentiert. Ganz ohne Sarkasmus konzediert deren Vertreter der Gewerkschaft, es sei davon auszugehen, dass demnächst die Arbeitsplätze abgebaut werden, die sich unter den neuen Bedingungen nicht mehr lohnen. Bloß folgt daraus nach Auskunft des guten Mannes ums Verrecken nicht das, was die Gewerkschaft fordert, sondern nur der freie Zugriff auf „Personal“ zu den von den Unternehmern festgelegten Konditionen. Entlastung für die belasteten Schichtarbeiter? Doch nicht ausgerechnet jetzt, wo sich „die Stahlindustrie derzeit um Subventionen für die Transformation hin zu einer grünen Stahlproduktion“ bemüht:
„Genau in dem Moment, in dem die ersten Bewilligungsbescheide auf dem Tisch liegen, eine Debatte über eine Verbesserung der Work-Life-Balance loszutreten, kann nur nach hinten losgehen.“ (G. Erdmann in der BamS, 1.10.23)
Inwiefern, das können sich die angesprochenen Gewerkschafter aussuchen: Ob sie damit mehr die öffentliche Meinung verspielen, also die Gunst gehässiger Steuerzahler, die wegen ihrer eigenen Inanspruchnahme auf Rücksichtslosigkeit gegenüber Stahlarbeitern bestehen. Oder ob sie mit ihrer Forderung nach Rücksicht die noch ausstehenden Bewilligungsbescheide für die Mittel aufs Spiel setzen, mit denen die Arbeitsplätze wegtransformiert werden. Verstehen müssen sie auf jeden Fall, dass die Notwendigkeit einer branchengerechten Work-Life-Balance keineswegs auf den Transformationsprozess beschränkt ist:
„Hochöfen und Kokereien dürfen nicht kalt werden, sie müssen 365 Tage im Jahr laufen. Wir haben hier keine Flexibilität, wir sind kein Dienstleister. Wir können die Frühschicht am Freitag nicht nach Hause schicken, weil die Nachtschicht vorher so fleißig war.“ (G. Erdmann in der Wirtschaftswoche, 7.9.23)
Das hat zwar auch keiner von den Stahlunternehmen verlangt, aber das macht die Botschaft nur umso klarer: Stahlproduktion geht nur als rentable rund um die Uhr; dem haben die Gewerkschaften nicht in die Quere zu kommen.
*
Den generellen Standpunkt seines Verbandes zur Viertagewoche erklärt BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter in der Fassung einer griffigen Antwort auf die feuilletonistische Frage, „wie wir in Zukunft arbeiten wollen“:
„Nur mit mehr Bock auf Arbeit und Innovationen werden wir unseren Sozialstaat und den Klimaschutz auf Dauer finanzieren können.“ (BamS, 30.4.23)
Transformation geht auf Kosten der Arbeiter, nicht bloß in der Stahlindustrie – zu diesem Gegensatz soll und muss man sich positiv stellen. Denn wenn er für die Unternehmen nicht aufgeht, lässt sich die notwendige Armut nicht einmal mehr abfedern. Und heißer wird es auch noch.